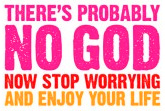»Bidler an der Dur«
Armut in der Geschichte - Bettler an der Tür
»Almosen für die Armen, Almosen für die Armen!« Dieser Ruf war dem mittelalterlichen Menschen zo allgegenwärtig wie heute der Verkehrslärm.
Schon am Stadttor streckten einem ausgemergelte Gestalten ihre hölzernen Bettelschalen entgegen, sie klopften des Abends an die Haustür der Reichen, um das Brot, das als Unterlage für die Speisen gedient hatte, zu bekommen.
Die Blinden hatten ihren Standplatz neben dem Dom, so daß jeder Gläubige beim Kirchgang an ihnen vorbei mußte, und noch während des Gottesdienstes konnte es geschehen, daß man um ein Scherflein angegangen wurde.
Bettler gehörten zum mittelalterlichen Alltag ebenso wie die allgegenwärtige Angst vor Krieg und Seuchen. Und weil jeder sich bewußt war, daß ihn ein Schicksalsschlag schnell und unverhofft um Arbeit und Brot bringen konnte, war Betteln nichts Ehrenrühriges. Es war eine durchaus legitime Möglichkeit, sich zeitweise durchzubringen, und deshalb gaben auch die, die etwas erübrigen konnten, einen Teil davon als Almosen. Freilich nicht nur aus Einsicht, daß ein ähnliches Schicksal einem selbst widerfahren konnte, sondern weil »Geben seliger denn nehmen« war, weil die Gaben an die Armen ein wichtiger, ja entscheidender Prüfstein für ein gottesfürchtiges Leben waren, einer der Schlüssel, die den Christenmenschen das Paradies öffneten.
»Arme und bidler an der dur« konnten einem in vielerlei Gestalt begegnen. Da waren zunächst all die, die nicht, nicht mehr oder noch nicht arbeiten konnten: Mit Blindheit und anderen Gebrechen Geschlagene, Kranke und Findelkinder. All diese hatten eine Unterkunft in einem der meist von der Kirche geführten Hospitäler oder Armenhäuser, manchmal ließen sie auch reiche Bürger unter der Treppe oder in einer kleinen Kammer wohnen oder stellten gar einen »gadem«, eines der winzigen Vorstadthäuschen, mietfrei zur Verfügung.
Behinderten blieb fast nicht anderes übrig als zu betteln
Freilich, für den Lebensunterhalt mußten und durften diese Armen betteln, ja es war oft üblich, daß sie ihren »Lohn« bei der sozialen Institution, wo sie wohnten oder sich an die »Armentafel« setzten, abgaben. Insofern war Betteln ihr Beruf, sie erhielten sogar - sei es von der Obrigkeit zugewiesen, sei es aus Gewohnheit - »Arbeitsplätze«: Manche »nur« am Stadttor oder in der Marktgasse, Blinde und Gebrechliche, aber auch die Findelkinder durften rings um den Dom oder die Kathedrale ihrem Gewerbe nachgehen, unschuldig in Not geratene Witwen, für die keine Zunft aufkam, klopften schon einmal an die Haustüren.
Das höchste Ansehen genoß sicher der »Pilgerbettler«. Auf dem Weg zu irgendeiner heiligen Stätte einem Gelöbnis folgend und zur Armut verpflichtet, war er auf die Wohltätigkeit seiner Mitbürger angewiesen. Und die gaben nicht immer reichlich und nicht immer gerne, aber doch wissend, daß sie sich vielleicht auch einmal auf Pilgerfahrt begeben mußten, sei es, um fur die wundersame Hilfe der Jungfrau Maria an einem ihrer Anverwandten zu danken, sei es nur um des eigenen Seelenheils willen.
Vom 13. Jahrhundert an gab es organisierte Bettelorden wie die Franziskaner. Mönche, Nonnen und auch Laienbrüder und -schwestern, die in Armut, wenn auch in geregelten Verhältnissen und damit in relativer sozialer Sicherheit lebten, sammelten Almosen und verwandten diese Gelder wiederum zur Armenfürsorge.
Daß das Bettelwesen wie überhaupt die Sozial- und Armenfürsorge einigermaßen funktionierte, setzte ein noch heiles, tief religiöses christliches Weltbild voraus. Und das hieß, daß der- oder diejenige, die sich ihren Lebensunterhalt mit ihrer Hände Arbeit verdienen konnten dies auch taten, so, wie es die Bibel und der Pfarrer von der Kanzel vorschrieben. Und daß nur die vom Schicksal und Gott Geschlagen, die nicht mehr arbeiten konnten oder keine Arbeit erhielten, Bettelschale und Bettelstab nahmen. Schlitzohren, die das Bettel»privileg« - als solches wurde es durchaus verstanden - ausnutzten, waren noch die große Ausnahme. All dies war - wenn überhaupt in dieser idealen Form - nur im Hochmittelalter der Fall und vielleicht auch da nur in guten Zeiten ...
Im Spätmittelalter änderte sich dies alles. Mit Kriegen und Seuchenzügen zerbrach das festgefügte christliche Weltbild, vor allem aber in den Städten geriet das von den Zünften sorgfältig bewahrte Einkommensgleichgewicht durcheinander. Die Bevölkerungsexplosion, aber auch die Erschütterungen der Zeit ließen nicht mehr zu, daß für jeden »Nahrung und Ehre« vorhanden war, die Möglichkeit, sich auf ehrliche Weise sein täglich Brot zu verschaffen.
Die Folge war ein Ansteigen der Armut und damit der Bettelei. Die veränderte Mentalität tat ein übriges dazu: Die abnehmende Religiosität bewirkte, daß Kaufleute und Handwerker, Adel und Handelsherren mehr an ihr irdisches Wohl denn an ihr Seelenheil und damit an fromme Gaben dachten. Hinzu kam, daß dies auch bei den Bettlern der Fall war. Die Zahl der Betrüger und Gauner unter ihnen nahm zu, als viele junge Leute erst gar nicht und manche Gestrauchelte nicht wieder versuchten, an normale Arbeit heranzukommen. Den Scherbenhaufen hatten dann die städtischen Behörden aufzukehren, die vom 14. Jahrhundert an mit einem zunehmenden Wust von Erlassen dem »Bettlerunwesen«, das mehr und mehr zur »Bettlerplage« wurde, Herr zu werden versuchten.
Als eine der ersten versuchte die Stadt Nürnberg, das Betteln zu reglementieren: Betteln durfte man nur noch mit einem Bettelabzeichen, und dieses erhielt nur, wer mit Hilfe vertrauenswürdiger Zeugen beweisen konnte, »daz im daz almusen noturttig sey.« Allen anderen freilich, »die wol gewandern oder gearbeyten moechten, den sol man niht erlauben, zu petteln, noch kein zeichen geben.« Fremde Bettler durften überhaupt nur noch drei Tage in der Stadt bleiben und sie dann ein Jahr lang nicht mehr betreten - es war der vergebliche Versuch, die haus- oder besser stadtgemachte Armut von der von außen hereingetragenen zu trennen, denn welcher fremde »sterzel oder geyler« konnte schon drei glaubwürdige Zeugen aufbringen? Dabei machten die städtischen Behörden freilich eine Erfahrung, die auch heute noch Fremdenpolizei und Ausländerbehörden machen: Sie trieben die Bettler nur in die Illegalität. In den Nebengassen der Städte gab es genug Einheimische, die gegen überteuertes Geld heimliche Schlafstätten anboten, was wiederum ihre Kunden nötigte, sich eben dieses Geld in ihrer täglichen »Arbeit« zu verdienen, auf immer aggressivere Weise, und die Grenze zur Kriminalität wurde immer fließender.
Natürlich versuchte die städtische »polizey«, die illegalen Bettler aufzugreifen und zu bestrafen. Aber es waren Strafen, die nicht sonderlich schreckten: Man stellte die Ertappten an den Pranger - das war unangenehm, aber auszuhalten -, man verwies sie der Stadt und brachte sie mit Bütteln vor die Tore - aber schon damals gab es genügend »Schlepper«, die alle Schlupflöcher zurück kannten -, und schließlich konnte man Wiederholungstäter bei Wasser und Brot einige Zeit in den Turm stecken - was angesichts der Verhältnisse in den Gefangnissen wohl noch am meisten schreckte, aber immerhin eine Alternative zum Verhungern darstellte. Am Ende dieses vergeblichen Kampfes stand im 17. Jahrhundert der Gedanke des Arbeits- oder Zuchthauses: Arbeiten statt betteln, hieß nun die Devise.
Mit einem Kissen wurde man schwanger, mit einem Seil zum Einbeinigen.
Es war ein Teufelskreis: Waren die Bettler im Hochmittelalter - wenn auch bemitleidet, ja verachtet - noch in die Gesellschaft integriert und von einem, den Zeitläuften entsprechend weitmaschigen, sozialen Netz aufgefangen worden, wurden sie nun nicht nur an den Rand gedrängt, sondern in den sozialen Abgrund gestoßen. Auch deshalb, weil sie sich dagegen mit allen Tricks wehrten: Die Bettelabzeichen wurden ebenso gefalscht wie Beglaubigungsschreiben von Klöstern und Orden, die zum Almosensammeln berechtigten. Hatte man früher auf seine Gebrechen hingewiesen, sie aber sorg- und sittsam verborgen, so schockte man nun die reichen Mitbürger mit offenen, schwärenden Wunden und hoffte, sie würden sich von diesem Anblick und dem meistens damit verbundenen Geruch möglichst schnell loskaufen. In den Vagantenlagern außerhalb der Stadt oder den Treff in alten Katakomben und Gewölben lehrten alte Bettler die jungen nun alle Tricks, mit denen man Mitleid heischen konnte: Die alten Chroniken berichten von der mittels Kissen vorgetäuschten Schwangerschaft, von auf den am Rücken hochgebundenen Beinen bis hin zur Selbstverstümmelung. Aus den früher hoch geachteten Pilgerbettlern wurden Berufsbettler. Und mehr und mehr verlegten sich manche »muessig gengere und maulenstuessere« nicht nur aufs Betteln, sondern ließen auch Geld und Gut mitlaufen,wenn sich eine Gelegenheit ergab. Vor allem bei jugendlichen Bettlern, die sich zu Banden zusammenschlossen, war die Grenze zum Berufsverbrechertum schnell überschritten. Immer näher rückten nicht nur in den Köpfen der Menschen Betteln und Betrug zusammen, Mißtrauen wurde zur Reaktion auf den Ruf »Almosen für die Armen« ...
»Bidler an der Dur«.
Geschichte mit Pfiff.
Äußerer Laufer Platz 22
90327 Nürnberg.
Abgedruckt in:
Bronks. kostenlose Beilage zum Looser.
Erstausgabe November 1996; S. 20 - 21.
Hrsg: Selbsthilfeverein Arbeit und Wohnen e.V.;
Waldstr. 17
64720 Michelstadt
Philippe Ariès
Das Kind und die Straße - von der Stadt zur Anti-Stadt
1. Die Schreie der Straße
2. Der erschreckte Philanthrop
3. Der kleine Verbrecher
4. Ein Traum aus Steinen
5. Der wiederentdeckte Straßenjunge?
Was wir heute Kindheit nennen, hat es nicht immer gegeben. Das wies der französische Historiker Philippe Ariès in einem bereits 1975 veröffentlichten Buch zur "Geschichte der Kindheit" nach: Die Abgrenzung zwischen Kindern und Erwachsenen hat beispielsweise das Mittelalter nicht gekannt: Kinder lebten, sobald sie sich allein fortbewegen und verständlich machen konnten, mit den Erwachsenen, sie waren kleine Erwachsene und wurden auch so behandelt. Je nach dem, wie Kindheit verstanden wird und in welcher Form mit Kindern umgegangen wird, hat dies auch Konsequenzen für die Räume, in denen sich junge Menschen, Kinder vielleicht, bewegen können.
Der 1984 in Paris verstorbene Ariès beschäftigt sich ausführlich in einem erst 1994 im Freibeuter publizierten Aufsatz mit dieser Frage und fordert, daß Kinder wieder integriert werden müssen in die Stadt.
In der Vergangenheit gehörte das Kind ganz selbstverständlich zum städtischen Raum, mit oder ohne seine Eltern. In einer Welt der kleinen Gewerbe und der kleinen Abenteuer war es eine vertraute Gestalt auf der Straße. Keine Straße ohne Kinder jeden Alters und aus allen Verhältnissen. Eine lange Privatisationsbewegung hat es dann nach und nach aus dem städtischen Raum verdrängt, der schon damals aufhörte, ein Raum dichten Lebens ohne Unterscheidung zwischen privat und öffentlich zu sein, um ein von der transparenten Logik des Verkehrs und der Sicherheit bestimmter Durchgangsort zu werden. Natürlich verschwand bei diesem umfassenden Werk des Ordnung-Schaffens, der Bändigung nicht das Kind allein, sondern mit ihm eine ganze buntgemischte Welt von der Straße. Doch seine Verbundenheit mit dieser Welt ist bezeichnend. Wir haben es also mit einem zweifachen Vorgang zu tun: Zum einen wird die Straße vom eigensinnigen Volk gesäubert, das man lange Zeit akzeptiert hatte - mehr oder minder widerwillig, aber ohne den Wunsch, es zu beseitigen -, das später jedoch als verdächtiger Unruheherd denunziert wurde. Gleichzeitig wird das Kind von diesen gefährlichen Erwachsenen getrennt, indem man es von der Straße wegholt. Die Straße ist als Aufenthaltsort unmoralisch. Der Unmoral kann sie nur entgehen, indem sie zum Durchgangsort wird und mit der Stadtplanung der dreißiger bis fünfziger Jahre die verlockenden Eigenschaften des Aufenthaltsortes verliert.
1. Die Schreie der Straße
Es hat sie wirklich gegeben, diese Stadt, in der die Kinder lebten und herumliefen, die einen außerhalb ihrer Familien, die andern ohne sie. Die Organisatoren, die Männer der Ordnung und der Sicherheit blickten lange Zeit mit Besorgnis auf diese Stadt, in der sie eine Quelle der Gefahren, der physischen und moralischen Verunreinigung, der Ansteckung und der Kriminalität erblickten. Heute dagegen entdecken einige sie wieder, mit Rührung und Nostalgie. Diese Stadt ist uns verlorengegangen; wann und weshalb? An ihre Stelle getreten ist nicht eine andere Stadt, sondern die Nicht-Stadt, die Anti-Stadt, die ganz und gar privatisierte Stadt. Sogar die Bezeichnung Stadt hat sie eingebüßt. Im Mai 1977, also beinahe heute, meldete sich bei einer Diskussion über die Ringautobahnen in der Pariser Region ein französischer Präfekt zu Wort. In einem Amtsblatt werden seine Ausführungen so wiedergegeben: "Hinsichtlich der Umgehungsstraßen hat der Präfekt sein stadtplanerisches Konzept dargelegt. Er hält es für angebracht, den Begriff 'Städte' aufzugeben, der an Mauern, an Grenzen denken lasse, und lieber von 'Ballungsräumen' zu sprechen, die durch Schnellstraßen miteinander verbunden sind." Sicher hatte der französische Beamte dabei die amerikanischen Metropolen im Kopf, Objekte seiner Bewunderung und seines Neids.
Was ist bei diesem Übergang von der Stadt zum Ballungsraum aus dem Kind geworden, und aus den Erwachsenen, die ihm ja eng verbunden sind? Von der griechischen Stadt, von Alexandria oder Rom bis zur christlichen oder islamischen Stadt des Mittelalters oder der mediterranen Medina von heute hat sich das Bild des Kindes auf der Straße kaum verändert. Die Straße war für das Kind verlockend, es liebte das Eltern wie Lehrern und Behörden suspekte Schauspiel der Straße. In einem Stück des griechischen Dichters Herondas beschwert sich eine Mutter beim Schullehrer über das liederliche Betragen ihres Sohnes: der Junge schwänzt die Schule, treibt sich auf der Straße herum, wo er Umgang mit Müßiggängern pflegt und mit ihnen spielt: seine "Spielnüsse" (die unseren Murmeln entsprechen) genügen ihm nicht. Er nimmt teil an den unmoralischen Vergnügungen der Erwachsenen, spielt mit Würfeln (vielleicht um Geld). Seine Würfel sind so abgenutzt wie die von alten Spielern, und empört stellt die Mutter fest, daß sie mehr glänzen als der Boden ihrer Kochtöpfe. Die ordentliche Züchtigung, die ihm sein Lehrer erteilt, hält ihn nicht davon ab, mit seinen Würfeln zu den zweifelhaften Zusammenkünften auf der Straße und an den Kreuzungen zurückzukehren. Die Spielfelder für Schach und "Himmel und Hölle", die man auf dem Forum in Rom gefunden hat, sind vielleicht von Kindern aus nahegelegenen Schulen aufgezeichnet worden. Diese Schulen befanden sich unter den Säulengängen, dicht an der Straße. Die Kinder begegneten dort den Lehrjungen, die in Erfüllung ihrer Pflicht oder zu ihrem Vergnügen in der Stadt unterwegs waren. Auch bei den öffentlichen Zeremonien, die im Freien, auf Straßen oder Plätzen stattfanden, hatten die Kinder ihren - in diesem Fall genehmigten - Platz. Sie begleiteten ihre Eltern bei der Almosenverteilung: Skulpturen zeigen sie uns auf den Schultern ihrer Väter thronend.
Noch in der mittelalterlichen italienischen Stadt war das so, und zwar aus dem gleichen Grund: es gab im Haus keinen Platz für die Kinder. Sie dehnten ihren Lebensbereich ganz selbstverständlich auf die Straße, auf den öffentlichen Raum aus. Die Häuser waren zu klein und faßten kaum ihre Bewohner, ob jung oder alt, außer für die kurze Nachtruhe.
In den besseren Klassen waren die Gebäude zwar weiträumiger, um Kunden und Bedienstete aufnehmen und ihnen Schutz bieten zu können, denn draußen wären sie den Gefahren ausgesetzt gewesen, die das tägliche Los der kleinen Leute waren. Doch in diesen Häusern, diesen Palästen war für das Privatleben kein Platz vorgesehen. Die Kinder verstreuten sich dort über einen Raum, der eher offen als privat war, denn er verlängerte und gliederte den der Straße mehr, als daß er davon trennte. In den alten, heute verschwundenen Wohnhäusern des 13. Jahrhunderts befand sich die Loggia im Erdgeschoß und ging direkt auf die Straße. Dank dieser Anordnung konnten die Familie und die mit ihr Verbundenen gleichzeitig draußen und drinnen, auf der Straße und im Haus sein. Und immer und überall Kinder! 1447 verfluchen die Stadtväter des Marktfleckens Rodez die Zugangstreppen zur Stadtmauer, "weil die Kinder jeden Tag hinaufstiegen", vermutlich um den Wehrgang, diesen wunderbaren Ort, zu erobern. Auf Stichen von Gallo sieht man die Geschäftsstraßen einer italienischen Stadt Anfang des 17. Jahrhunderts: kleine Läden, die geöffnet wurden, indem der Fensterladen aufgeklappt und in waagerechter Stellung befestigt wurde. Der Inhaber, der Handwerker, läßt sich hinter dem hinabgelassenen Fensterladen nieder wie hinter einem Tisch, und der Kunde darf nicht ins Ladeninnere vordringen: er bleibt draußen, oft von einem Kind begleitet. Im Laden helfen kleine Lehrlinge ihrem Meister, und überall laufen andere Kinder herum und spielen, ohne darauf zu achten, was um sie herum geschieht.
Doch die Kinder sind nicht nur zufällig da, weil sie nicht woanders sein können oder weil es woanders keinen Platz für sie gibt. Sie haben in der Stadt auch eine rituelle Rolle zu spielen, und die Erwachsenen verlassen sich darin auf sie. Im alten Rom gab es militärische Vereine für Jugendliche aus guten Familien. In den Turnhallen mischten sich pueri, Knaben, unter die Heranwachsenden im waffenfähigen Alter, die jovenes, und dienten ihnen wie später die jungen Knappen. Vestalinnen wurden im Alter von sechs Jahren ausgewählt. Das Kind nahm auch an den Mysterienkulten teil. Im Florenz des 15. Jahrhunderts waren Kinder und Jugendliche in frommen Gemeinschaften organisiert. Diese spielten eine widersprüchliche Rolle. Einerseits integrierten sie die Jugendlichen in die gesellschaftlichen und natürlich in die religiösen Riten. Es war die Aufgabe der Kinder, mit ihren Gebeten den göttlichen Schutz auf die Stadt zu ziehen. Andererseits hatten diese Gemeinschaften auch den Zweck, eine beunruhigend ausgelassene Jugend zu bändigen, ihre Freizeit auszufüllen und sie den Versuchungen und dem Gemenge auf der Straße zu entziehen.
Diese Rolle der Kinder als Mittler zwischen den Erwachsenen und Gott findet man übrigens auch in den Altersklassen der traditionellen ländlichen Gesellschaften. Wahrscheinlich glaubte man, daß sie bis zur Pubertät geschützt waren vor der Beschmutzung durch Blut und Sex, der die Erwachsenen ausgesetzt waren. Deshalb waren ihnen in Florenz bestimmte Funktionen vorbehalten, vor allem bei den in Bürgerkriegszeiten häufigen öffentlichen Hinrichtungen: sie waren für Steinigungen zuständig und auch für die Beseitigung der Leichen. Die Ambiguität der Stellung der Kindheit in den alten Gesellschaften ist hier deutlich erkennbar: Sie wurde zwar als anders anerkannt, zumindest in der Zeitspanne, die sie vom bevorstehenden Übertritt in die Gruppe der Erwachsenen trennte, dieses Anderssein aber grenzte sie nicht aus der Gesamtgesellschaft aus, es gestattete vielmehr, ihr eine besondere Aufgabe in eben dieser Gesellschaft zu übertragen. Insofern das Kind als Kind anerkannt wurde, sonderte man es also nicht ab und sperrte es in eine Art Reservat, sondern betraute es innerhalb einer Gesellschaft, in der jede Gruppe von Bürgern eine besondere Funktion hatte, mit einer Rolle, die kein anderer übernehmen konnte.
Diese Situation war nicht nur charakteristisch für die antiken und mittelalterlichen Gesellschaften im Mittelmeerraum. Wir finden sie auch im Paris des 18. Jahrhunderts. Arlette Farge schildert sie auf der Grundlage von Polizeiberichten in ihrem hervorragenden kleinen Buch: Vivre dans la rue[1] (Auf der Straße leben). Diese Protokolle berichten von kleinen Zwischenfällen des Alltagslebens. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörte die Straße vor allem den Armen; die Reichen, die sie vorher mit ihnen teilten, hatten begonnen, sich von ihr zurückzuziehen: "Ein Raum, wo man sich nur deshalb aufhält, weil man kaum einen anderen zur Verfügung hat, ein Raum zum Leben." Arlette Farge will den Leser nämlich vor der Versuchung des Pittoresken und der Nostalgie bewahren - obwohl sie ihr im Grunde bisweilen selbst erliegt. "Man darf sich von den Bildern der Straße", schreibt sie, "die einen Eindruck von Charme und Vitalität, von intensivem Leben und Betriebsamkeit vermitteln, keine falschen Vorstellungen machen", wie es dem Leser von heute gehen könnte, der auf diesen Bildern erstaunt das wiederfindet, was aus seiner heutigen Welt verschwunden ist.
Auf der Straße leben ist hart, "es bedeutet, keinen Zufluchtsort zu haben (. . .), abhängig zu sein von dem, was draußen geschieht, so wie es kein Bürgerlicher hinnehmen würde". In der Tat ist "Privatsphäre" ein zu neuer Begriff; erst die bürgerlichen Klassen verwenden ihn und kommen in seinen Genuß. Deshalb verlassen sie auch allmählich die Straße und bewegen sich auf ihr nur noch in einem schützenden Kasten, in Kutsche oder Sänfte. Bei den Armen, so schreibt Arlette Farge, "vollzieht sich das Leben hier auf der Straße, mit viel Zärtlichkeit und viel Gewalt. Zum Schutz seiner Geheimnisse gibt es keinen anderen Ort als die öffentlichen Plätze. Die Häuser, unsicher und ungesund, sind selbst zu sehr nach außen offen, sie schützen nur wenig, verbergen kaum, was sich drinnen abspielt (. . .) So erscheinen sie als ein Raum, in dem es keinen wirklichen Bruch zwischen Außen und Innen gibt, ebensowenig wie eine scharfe Trennung zwischen Arbeit und Forschung, Freizeit, Gefühlsleben oder Tändelei." Besser könnte man die Globalität des Gesellschaftslebens gar nicht definieren, die nicht vorhandene Spezialisierung, bevor die Einheit auseinanderbricht und in abgeschottete Bereiche zerfällt: Privatleben, Berufsleben und öffentliches Leben.
Die Kinder wurden in diese Welt der Straße sehr früh einbezogen; sie gingen dort allen möglichen kleinen Berufen nach, vor allem als Schuhputzer, wie es sie in den Städten der Mittelmeerländer heute noch gibt. In Polizeidokumenten stoßen wir auf sie, wenn sie wegen Vagabundismus festgenommen wurden: am 7. September 1770 um elf Uhr morgens Verhaftung des "zwölfjährigen, aus der Normandie stammenden Pierre Picard, Schuhputzer in der Rue de Clichy, der im Hühnerstall des Postvorstehers Baron d'Igny schläft. In seinen Taschen fanden sich zwölf Liards und Brot. Er ist seit sechs Wochen in Paris". Am 11. August 1763 hat die Polizeistreife um neun Uhr morgens "den achtjährigen Jean Mathieu aufgegriffen. Er behauptet, sein Vater, ein Perückenmacher, sei unter die Soldaten gegangen. Er wisse nicht, was aus dem Vater und der Mutter geworden sei. Man habe ihn zu einem gewissen Dagneau, einem Juwelier, in die Lehre gegeben (womit dieser ihm eine Gunst erwies), der bei einem gewissen Lacroix ein möbliertes Zimmer bewohne. Das Kind wurde schlafend auf den Boulevards aufgefunden." Am 8. Oktober 1777 verhaftet man um halb eins in der Nacht "Jean Francois Cassagne, gerade fünfzehn, obdachlos, der seit gestern Nadeln verkauft, da ihn sein Vater vor die Tür gesetzt hat". Wieviele andere, besser wohnende und doch die gleichen Berufe ausübende Kinder, Lehrlinge und Laufjungen kommen wohl zu den kleinen, der Polizei verdächtigen Vagabunden noch hinzu? Hinter diesen Polizeitexten ahnt man die Frauen und Kinder, die auf der Straße, in den Lokalen ihrer Arbeit nachgehen. Erst im 19. Jahrhundert werden sie gemeinsam von der Straße als einem schlimmen, den Männern vorbehaltenen Ort ausgeschlossen. Im 18. Jahrhundert gingen sie noch dorthin, und an Festtagen begaben sie sich in Gruppen oder mit der Familie in die Ausflugslokale der Boulevards außerhalb der Mautschranken, weil der Wein dort billiger und die Luft sauberer war.
Die Straße gehörte ihnen. Hier ein signifikanter kleiner Zwischenfall, wiederum zitiert von Arlette Farge: 10. März 1775 um halb sieben im Amtsgebäude des Kommissars Dorival. "Es sind erschienen Pierre Figallion, Messerputzer, und seine Frau Elisabeth Perrin, wohnhaft in Paris, Rue des Trois-Cannettes (dieser Messerputzer ist ein guter Handwerker, kein Großbürger: er gehört ebenfalls der Welt der Straße an, aber er hält Distanz dazu); haben Klage erhoben gegen Lassagne und dessen Frau, die für ihren zwölfjährigen Sohn haftbar sind. Vor einer Stunde habe ein junger Kerl, der mit dem Sohn von Lassagne spielte, einen Schwall Wasser auf den Lassagne-Sohn geschüttet, das den Anzug des Erschienenen getroffen habe. Der Erschienene habe gesagt: "Was sind das für Bengel, die Wasser auf Passanten schütten?", und besagter Lassagne (der Vater des kleinen "Bengels") habe geantwortet: "Na na! So was Schlimmes hat man dir doch nicht getan!" (Solidarität zwischen Erwachsenem und Kindern - aggressives Duzen); darauf habe die Erschienene gerufen: "Eine Ohrfeige hätten Sie verdient", und Lassagne habe mit einem Stein oder einer Austernschale nach ihr geworfen und ihr damit die Augenbraue aufgeschnitten, weshalb sie stark blutete. " Einige wahrscheinlich ältere Knaben trieben es noch schlimmer. Eines Abends, so Arlette Farge, spürte Demoiselle Fardy, die am Arm ihres Gatten, eines Buchverkäufers, in der Rue de la Harpe spazierenging, wie ihr mit Gewalt der Hals zusammengepreßt wurde, als ob man sie erwürgen wolle. Es handelte sich um eine Schnur, die so straff zugezogen wurde, daß die Frau die Sprache verlor. "Diese Schnur war über die Straße gespannt und von Leuten gezogen, die sich in den Durchgängen oder den Häusern verstecken (also in einem Labyrinth von Höfen, durch die die Straße führte). Zwölf junge Leute seien gekommen und hätten gelacht und Spottgebärden gemacht" (30. März 1785).
2. Der erschreckte Philanthrop
Vom 18. Jahrhundert an wurden Straße und Schenke als gefährliche Orte betrachtet, die saniert werden müssen. Zu diesem Zweck wendet man Gewalt an, setzt die Polizei, aber auch sanftere und zweifellos wirkungsvollere Methoden ein. Unter dem Einfluß von Michel Foucault haben junge französische Forscher, unter ihnen Arlette Farge, zu zeigen versucht, wie die Armen, die eine Art Subkultur bildeten, unter der Einwirkung von Philanthropen, von staatlichen und kirchlichen Moralisten - an deren Stelle dann unsere heutigen Sozialarbeiter und Psychologen traten - zur bürgerlichen Lebensweise bekehrt wurden. Die Geschichte dieser Akkulturation ist in großen Zügen inzwischen wohlbekannt: das Kind wurde von der Straße weggeholt und in einen ent-urbanisierten Raum, das Haus oder die Schule eingesperrt, das eine wie die andere abgeschottet gegen die Geräusche von außen. Welche ungeheure Veränderung für die an die Freiheit bzw. Freizügigkeit der Straße gewohnten Kinder und Jugendlichen, die bei ihrer Arbeit und ihren Spielen fortan von produktiven Tätigkeiten ferngehalten, der eigenen Verantwortung beraubt und der erzieherischen Zucht unterworfen werden! Ein ganzer, junger, aber vordem aktiver Teil der Bevölkerung wurde auf diese Weise von außen nach innen, von einem ganzheitlichen, zugleich privaten, beruflichen und öffentlichen Leben in die abgeschlossene Welt der privacy verpflanzt.
Die Physiognomie der Straße hat durch diese Räumung und durch die Konditionierung des noch Verbliebenen notwendigerweise Schaden genommen. Man könnte meinen, daß damit die globale Soziabilität der Straße verschwunden sei. Aber da irrt man sich um etwa ein Jahrhundert. Es ist höchst bemerkenswert, daß die Privatisierung des Familienlebens, die Industrialisierung und Urbanisierung des l9. Jahrhunderts es nicht geschafft haben, die spontanen Formen städtischer Geselligkeit zu ersticken, auch wenn sie in manchen Fällen andere Ausdrucksformen annahm. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts, also nach der Industrialisierung, kam es zum Zusammenbruch der Straße und gleichzeitig auch der Stadt. "Die Straße", so Arlette Farge, "wird von den kleinen Personen als Wunderwelt wahrgenommen, die intensives Leben birgt, als eine Art Fest." Anatole France schreibt: "Was mir an der schönen Rue du Bac gefiel, waren die Läden, (...) die wundervollen Tage". Und Maurice Genevoix: "Bis zum Haus meiner Großmutter waren es kaum mehr als hundert Schritte, aber es war eine herrlich abenteuerliche Reise, deren Freuden sich auch durch die Gewohnheit nie erschöpften. . . Jeden Donnerstag war es das gleiche, immer neue Feste der emsigen Straße, die nach Vergnügen und nach Wind roch" (Le Jardin dans l'Ile, 1936). Für Leotaud (Le Petit Ami, 1899) "gibt es im ganzen Viertel nicht eine Gasse, die für mich nicht immer noch von so etwas wie Kameradschaft erfüllt ist". Bisweilen jedoch, zum Beispiel bei Pierre Loti, wird die Straße zur Welt des Unbekannten und der Angst. "Wenn die Stadt kein Raum der freien, spielerischen Bewegung ist", bemerkt Marie-Jose Chombart de Lauwe, "wird sie zu einer beunruhigenden Welt[2] ." Tatsächlich findet man beim Kind beide Bilder der Stadt, die der Historiker des 18. Jahrhunderts und des beginnenden 19. Jahrhunderts beobachtet: ein archaisierendes Bild der Festlichkeit und Vertrautheit, und ein modernes der Unsicherheit und Beunruhigung.
Doch noch herrscht Unentschiedenheit, die Gesellschaft ist noch nicht auf die Seite der Angst gekippt, und beim Kind behält die Faszination der Straße die Oberhand. Man hat es gesehen, Zeugnisse dafür gibt es reichlich. Gewiß wird man zu Recht einwenden, daß diese Erinnerung künftiger Schriftsteller eher die Lust an einer Straße ausdrücken, die schon ein wenig von fern betrachtet wird, und weniger das Vergnügen an einem aus vollen Zügen miterlebten Leben. Man erwartet trotzdem nicht, daß die herrschenden Klassen, die alles daran gesetzt haben, das Kind in Haus und Schule zu halten, es noch einmal auf die Straße entwischen lassen! Immerhin gelang es ihnen nicht auf Anhieb, das Draußen vollständig auszuschalten. An die Stelle der volkstümlichen und bedrohlichen Straße setzten sie als Kompromiß andere Räume der Geselligkeit, die ihnen zwar nicht vorbehalten waren, wo sie aber doch das Sagen hatten und ihre Sicherheit gewährleistet sahen. Einige dieser Räume, wie das große Cafe mit der sich auf den baumgesäumten Boulevard oder den weitläufigen Platz vorschiebenden Terrasse waren, ebenso wie die Clubs, eine Domäne der Männer: Frauen und Kinder waren ausgeschlossen. Ein anderer Raum waren die Parks, wie sie in London im 18., in Paris, Wien und New York im 19. Jahrhundert in riesiger Ausdehnung entstanden; die feinen Leute besuchten ihn zu Fuß, zu Pferd, in ihren Kutschen, aber auch Familien, Kinder mit ihren Kindermädchen und manchmal auch Kinder allein, wenn sie für kurze Zeit der Aufsicht der Erwachsenen entrannen, die in einem so gut überwachten Raum über deren Eskapaden im übrigen nicht allzu beunruhigt waren. Richard Sennett hat auf die Bedeutung der Parks und ihrer Geselligkeit im Chicago vor dem Bürgerkrieg hingewiesen. "Deshalb wurde durch den Union Park (das Viertel von Chicago, das er so gründlich und scharfsinnig analysiert hat) die Klaustrophobie des heutigen suburb vermieden. Der Park war der natürliche Ort der Begegnung und der Sozialisation zwischen der Gemeinschaft des Viertels und der Stadtbevölkerung[3]." Ein Memoirenschreiber namens Carter Harrison, den er zitiert, spricht von dem "unhibited wandering and exploring" in seiner Kindheit im Park.
Die oberen Klassen des 19. Jahrhunderts haben sich von der Straße, nicht aber aus der Stadt zurückgezogen. Sie haben sie lediglich nach Kräften umgeformt. Ihrer Kraft waren allerdings, wie wir noch sehen werden, Grenzen gesetzt. Sie gestalteten sich ihre eigene Stadt, in der die Straßen gesäubert, geebnet, von ihren Löchern und Winkeln befreit, die Häuser in Reih und Glied gebracht wurden und das Volk in die abgelegeneren Viertel verdrängt wurde. Doch diese Segregation war selten vollständig: noch die bürgerlichsten Viertel hatten ihre Geschäftsstraßen, in denen kleine Wohnbezirke von Handwerkern und Händlern bestehen blieben, die zu minoritär und zu rechtschaffen waren, um zu beunruhigen: Diese Bezirke entsprachen der Notwendigkeit von Dienstleistungen und zugleich einem noch nicht ganz und gar verdrängten Bedürfnis nach Vielfalt. Trotz dieser kleinen Nuancierungen, durfte das Kind zwar noch in den Parks der bürgerlichen Viertel spazierengehen, sein Platz aber war in der Schule und im Haus. Ganz bestimmt nicht auf der Straße. In den volkstümlichen Vierteln war das in derselben Epoche ganz anders. Die Geschichtswissenschaftler des l9. Jahrhunderts und unsere heutigen Soziologen haben festgestellt, daß die traditionelle Gesellschaft der von Arlette Farge beschriebenen Straße, auf der die Frauen und Kinder rund um die Uhr sind, in den volkstümlichen Vierteln noch lange überlebt hat. Ihre Ansicht wird durch das bestätigt, was berühmte Typen aus Literatur oder Karikatur suggerieren, wie in Frankreich Victor Hugos "Gavroche" oder in jüngerer Zeit, in den Jahren 1910 - 1920, die Jungen von Montmartre in ihren schäbigen, zu großen Kleidern aus zweiter Hand und mit Männermützen auf dem Kopf, die nach dem Künstler, der sie zeichnete, bald die "kleinen Poulbots" genannt wurden.
Noch Anfang des 20. Jahrhunderts übten Kinder die gewohnten kleinen Berufe aus: Sie machten Botengänge, lieferten Waren aus, halfen im Lager. Sie brachten den Arbeitern in der Werkstatt, in der Fabrik oder im Bergwerk Wasser und Essen - und hüten auf dem Land das Vieh, halfen bei der Ernte und beim Dreschen. All das geschah auch noch nach den Gesetzen, die die Kinderarbeit regelten und auf lange Sicht davon abschreckten, sie zu beschäftigen. Die Kinder scheinen sich kaum beklagt zu haben, vielleicht legten sie, anders als man lange Zeit glaubte, selbst Wert darauf zu arbeiten, und weder ihre Eltern noch die Arbeiter in der Werkstatt hatten ein schlechtes Gewissen. Letztere ließen sich an ihrer Arbeitsstätte gern mit den Kindern fotografieren, die ihnen ab und zu halfen und kaum zwischen Orten des Spiels und Orten der Arbeit unterschieden. Tatsächlich gibt es zwei unterschiedliche Interpretationen der Kinderarbeit in der Industrie, die die Teilnahme des Kindes am Leben der Erwachsenen und an der Gemeinschaft hinterfragen. Die erste Einstellung, die der katholischen Philanthropen und der marxistischen Historiker, verurteilte Kinderarbeit radikal: Die Kinder werden als Opfer der kapitalistischen Ausbeutung gesehen. Die zweite Einstellung, die einer neuen Generation von Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftlern, hat an der Einbeziehung der Kinder in die Erwachsenenarbeit und der dadurch in der Praxis begünstigten Vermischung der Altersgruppen einen anderen, positiven Effekt entdeckt, ohne allerdings der ersten Ansicht zu widersprechen. In einer von Jean und Claire Delmas organisierten Ausstellung über die Kinder von Rouergue - Jean Delmas ist Leiter der Departements-Archive von Aveyron - ist ein Brief aus dem Jahre 1901 zu sehen, in dem ein Akrobat den Präfekten von Aveyron bittet, seinen achtjährigen Sohn als Artist arbeiten zu lassen. Der Kleine läuft auf den Händen, und sein Vater betont, daß die Arbeit völlig ungefährlich sei. Der Präfekt indes vermerkt am Rand des Schreibens: Genehmigung verweigert. Francois Barre, ein Architekt und Designer von heute, der sich Gedanken um den derzeitigen Platz des Kindes in der Stadt macht, drückt sich so aus: "Gewiß haben unsere Gesellschaften das Kind der Produktion untergeordnet und es auf diese Weise schamlos ausgebeutet. Marx konnte schreiben: ,Als das Kapital die Maschine eroberte, schrie es nach Frauenarbeit, nach Kinderarbeit'. Anscheinend bewirkte diese frühe Schandtat einen fortwährenden Verdacht bei jedem Versuch, das Kind an der produktiven Arbeit teilhaben zu lassen. "[4]
3. Der kleine Verbrecher
Die Grundschule wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich von den meisten Kindern besucht. Das soziale Leben der Kinder aus dem Volk organisierte sich zu der Zeit also um die Schule und um das Viertel herum; jedes Viertel hatte seine Schule. Die Schule macht den Unterschied zu dem von Arlette Farge geschilderten vorgehenden Zeitraum vom 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts aus. Das Kind ist jetzt Schüler, identifizierbar an dem schwarzen Kittel, den es kaum je ablegt und der es wie eine Uniform kennzeichnet. Doch die Schule hielt das Kind nur für einen Teil des Tages und der Woche von der Straße fern. Weder Eltern noch Kindermädchen holten es von der Schule ab oder brachten es nach Hause; es verfügte frei über seine Zeit, und die verbrachte es draußen, in der Gruppe, mit den Kameraden. Sogar das Bürgerkind träumte davon, seinen Schutzengeln zu entwischen und sich unter die Buben aus der Gemeindeschule (der Armenschule) zu mischen und auf der Straße die gleichen Abenteuer zu erleben. Das erzählt Jean Cocteau 1929 über die Kinder der Rue d'Amsterdam. Diese Straße ist ihr "Place de Greve, eine Art mittelalterlicher Platz, Minne- und Wunderhof, Börse, wo Briefmarken, aber auch Murmeln getauscht werden (ersteres ein eher bürgerliches, letzteres ein universelles Vergnügen), Räuberhöhle, in der das Gericht die Schuldigen verurteilt und hinrichtet, wo von langer Hand jene Streiche ausgeheckt werden, die man dann in der Klasse ausführt, und über deren Vorbereitungen sich die Lehrer wundern". 1912, ungefähr zur selben Zeit, die von Cocteau heraufbeschworen wird, erzählte Pergaud, mit welcher Art von Konflikten und Streichen sich die Kinderbanden nach der Schule beschäftigten. In seinem Buch Krieg der Knöpfe wie in Cocteaus Les Enfants terribles, auf dem Land wie in der Stadt, erscheinen die Einfälle dieser kleinen Banden als "Zeichen für die Vitalität der Kinder" (Marie-Jose Chombart de Lauwe). Die Streiche werden nicht mehr der Polizei gemeldet: vielleicht, weil sie seltener werden und man sich fragt, ob sie nicht einer Vergangenheit angehören, die entschwindet und nostalgisch wird.
Derartige Nachsicht war allerdings eher die Ausnahme. Insgesamt stand die Gesellschaft der Freiheit der Kinder auf der Straße nach wie vor ablehnend gegenüber, denn sie sah darin nur physische Unsicherheit, moralische Zuchtlosigkeit und letzten Endes Anleitung zur Kriminalität. Aus dem kleinen Herumtreiber, wie man sagte, dem man die Ohren langzog oder ein paar Ohrfeigen gab, wurde nach und nach der jugendliche Kriminelle, den der Geschäftsführer des Einkaufszentrums heute der Polizei, dem Sozialarbeiter, dem Jugendrichter, der Besserungsanstalt etc. ausliefert - und den schon der königliche Richter des Ancien Regime hart bestrafte, wenn das Delikt auf einem öffentlichen Markt begangen wurde. Die Historikerin Michele Perrot, die sich mit dieser volkstümlichen Gesellschaft befaßt, schrieb mir in einem Brief: "Die täglichen Berichte der Polizeikommissariate für die Zeit von 1880-1914, die zumindest teilweise erhalten sind, zeigen, daß die Polizei Anfang des 20. Jahrhunderts viel Zeit damit verbrachte, Jagd auf ,Tagediebe' zu machen. Mit der Schaffung eines Kindergesetzes Anfang des 20. Jahrhunderts und der Gründung von Kindergerichten (1912), wird die Jagd auf das vagabundierende Kind natürlich verschärft", eine Jagd, die bereits Ende des 18. Jahrhunderts in Paris begann. In der kleinen Fabrikstadt Saint-Affrique in Südfrankreich verfolgte die Polizei Mitte des 19. Jahrhunderts Kinder, die sich auf der Straße herumtrieben. In ihrer bemerkenswerten Ausstellung über die Kinder von Rouergue zeigten Jean und Claire Delmas 1979 auch eine Sammlung von Strafbefehlen, 1865 ausgestellt in Saint-Affrique gegen etwa zwölfjährige Kinder, denen zur Last gelegt wurde, daß sie sich auf der Straße die Zeit mit Karten und Glücksspielen vertrieben hatten, um Geld - es geht wohl nur um sehr kleine Beträge, aber eben auch ums Prinzip! Zwei Zwölfjährige wurden "beim Münzenwerfen ertappt. Als wir uns näherten, ergriffen sie die Flucht. " Doch der Polizist kannte sie gut und wußte ihre Namen. Ein andermal erkannte der Beamte nur zwei der Flüchtigen: der Rest des "Trupps" entkam ihm. Andere wiederum wurden dabei überrascht, wie sie um Geld Karten spielten. Tatort: vor dem Haus des Richters, möglicherweise ein erschwerender Umstand.
Der Druck der Behörden und bald auch der Familien, denen in immer stärkerem Maß Schuldgefühle eingeimpft wurden, verbannte die Kinder von der Straße. Doch sie widersetzten sich, nützten ihre Freiheit zwischen Schule und Haus aus, organisierten sich in Banden. Michele Perrot glaubt, daß der Erste Weltkrieg eine Verschärfung dieser Phänomene bewirkt hat, und daß die Rückkehr zur gewohnten Ordnung sie nicht ganz hat verschwinden lassen: Der junge Soziologe Philippe Meyer findet sie heute in den nördlichen Randbezirken von Paris wieder, an der Stadtgrenze und in den Vororten, und hat ihnen ein Buch gewidmet (1979)[5]. In einem Artikel in der Zeitschrift Daedalus (1977)[6] habe ich auch selbst schon erwähnt, wie sehr es dem Staat zuwider ist, wenn sich Lebensbereiche seiner Kontrolle und seinem Einfluß entziehen. Philippe Meyer stellt fest, daß solche Lebensbereiche nicht völlig verschwunden sind. "Obwohl sie größtenteils eliminiert wurden, gibt es davon in manchen Vierteln und manchen Städten noch Ansätze, wenn die staatlichen Kolonisierungs- und Ausbaumaßnahmen über die ursprünglichen Formen der Soziabilität noch nicht völlig die Oberhand gewonnen haben." Die Viertel im Norden von Paris, die sich in die Nähe der alten aufgegebenen Befestigungsanlagen vorgeschoben hatten und lange Zeit Niemandsland waren, waren lange schlecht ausgestattet gewesen mit Schulen, gesellschaftlichen Einrichtungen und Fortbildungsanstalten; die Administration in Paris hatte diese Viertel vergessen und sich nicht um ihre "Entwicklung" gekümmert.
"Dieses von Carco geschilderte und von Bruant besungene Viertel", schreibt Meyer, "ist sich selbst treu geblieben, volkstümlich, dichtbevölkert, lebendig. Es ist besonders für seine traditionell zahlreichen und starken Jugendbanden bekannt." Diese Jugendlichen, die größtenteils außerhalb der offiziellen und normalen Mobilisierungs- und Soziabilisierungskreisläufe standen, sind im wesentlichen und oft auf erstaunliche Weise immer noch "Einwohner", die an einem Ort und in einem Milieu verwurzelt sind und sich hauptsächlich durch die Bindung an ihr Territorium charakterisieren lassen. Diese Jugendlichen stammen im allgemeinen aus Familien, die als anomal gelten, entziehen sich früh dem Schulsystem oder werden von ihm ausgestoßen, sind wegen ihrer Wildheit unerwünscht in Vereinen, Clubs, Jugendgruppen oder Jugendhäusern, werden dann von den Musterungsausschüssen meistens für nicht wehrtauglich befunden und sind trotzdem eng solidarisch mit einer gesellschaftlichen Realität, einem Lebenskreis, ihrem Viertel, ihrer "Straße". Die Banden waren allesamt geo-sozial determiniert, hatten alle eine bestimmte Herkunft, und dieser Herkunftsort war auch immer ein Lebensmilieu, das die Bande so stark formte, bestimmte und prägte, daß man mit ein wenig Erfahrung allein durch Beobachtung der Verhaltensweisen und Gewohnheiten hätte sagen können, woher dieser oder jener Jugendliche kam. "Wahrscheinlich ist es diese ganz spezielle, ursprüngliche Form der Sozialisierung durch die Straße und das Milieu, das den Banden dieses Potential an sozialer Phantasie gibt, die Fähigkeit zur Folklore, zum Mythos, zum Abenteuer. Dieser Reichtum an sozialen Instinkten webt über ihre krankhafte Langeweile und über die tägliche Banalität ihres individuellen Lebens eine Geschichte von einer außerordentlichen sozialen Intensität - ein regelrechtes Ferment für die Bande, ihre Solidarität und Vitalität. Dort, wo viele, und oft zu Recht, nur Gesetzlosigkeit, Zusammenrottung, Unordnung, Lärm und Randale sehen, muß man bei genauerem Hinsehen sehr wohl auch Reichtum, Intensität, Akkumulation, Freiheit und die Entfaltung eines gesellschaftlichen Lebens erkennen, das sich nicht unterdrücken läßt und bisher - aber wie lange noch? - dem Zugriff der Sozialarbeiter, den Zwängen der Stadtplanung, den Mauern der Asyle und Gefängnisse entgangen ist."
4. Ein Traum aus Steinen
Seltsamerweise findet man im heutigen Paris, so wie Philippe Meyer es beschreibt, viele Merkmale des von Arlette Farge geschilderten Paris des 18. Jahrhunderts wieder, vor allem die Bewässerung der Häuser von der Straße aus. Es gibt Räume, die zugleich Straße und Haus sind, ein Labyrinth von Sackgassen, Durchgängen, Wohnblöcken, engen Sträßchen. Meyer erwähnt besonders die halb privaten, halb öffentlichen "Plätze". Sie bilden "eine Art Dorf (mit seinen Geschäftsleuten) und haben mehr mit dem couree des 19. Jahrhunderts und den quarres des 18. Jahrhunderts gemein, als mit der sie umgebenden Stadt. Das Leben im Netzwerk von Mikro-Räumen blieb erhalten, weil das Automobil, abgesehen von dem der Bewohner, dort nur langsam vordrang: "Dank des geringen Verkehrs können die Kinder auf der Straße Ball spielen, sich versammeln und frei herumtollen im Blickfeld der Mütter, die sie vom Küchenfenster aus rufen können." Doch der "Platz" ist kein nur den Kinder vorbehaltener Raum. Man findet dort die Vermischung der Altersgruppen wieder, wie sie für die alte Stadt typisch war. "Der zentrale Platz ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs, ein Zentrum, wo alle möglichen Informationen kursieren, ein Beobachtungsposten, von dem aus man jede Einzelheit des Lebens im Block verfolgen kann." Daraus ergibt sich eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Altersgruppen "unter Wahrung der gebührenden Distanz". So gibt es Beziehungen zwischen den Kinder- und den Jugendbanden. Die Jugendlichen weihen die Kinder ein, organisieren ihre Spiele und ihre Ausflüge, halten sie aber von ihren eigenen gefährlichen und verdächtigen Unternehmungen, von ihren Expeditionen fern. Ähnliche Unterschiede würde man in den volkstümlichen Vierteln der italienischen Städte finden.
Die ausgeprägte Soziabilität der Kinder in der Stadt, die Aufteilung des städtischen Raums zwischen Kindern und Erwachsenen dauerte also das ganze 19. Jahrhundert hindurch fort, dann setzte sich die Verdrängung der Kinder an den Rand der Stadt gegen alle Widerstände durch, und gleichzeitig verwandelte sich der städtische Raum, er zerfiel; aus der Stadt wurde, um es mit den Worten des oben zitierten Pariser Präfekten zu sagen, der Ballungsraum.
Interessant ist es, die frühen Ursprünge dieser Entwicklung im Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu betrachten. Richard Sennett hat ihre Anfänge in Chicago sehr gründlich untersucht und sich besonders mit dem Wandel der Familie der damaligen Zeit befaßt. Ich möchte festhalten, was er über die Stellung des Kindes sagt. Wir haben bereits gesagt, daß sich in dem von ihm untersuchten Viertel von Chicago, dem Union Park vor 1870 - der Zeit der Geselligkeit in den Parks - die Familie durchaus zu ihrer Umwelt hin öffnete, so daß das Kind sich an geduldete Spaziergänge und Erkundungsausflüge wagte. Ein paar Jahre später - dies ist das Thema seines Buchs - hat sich die Zusammensetzung und die Struktur der Familie verändert. Die sogenannte Kernfamilie ist an die Stelle der Großfamilie getreten, die mindestens noch ein Seiten-Mitglied (collatoral kin) oder größere Altersvielfalt umfaßt: Onkel oder Tante, großer Bruder oder große Schwester, die mit im Haushalt leben, meist unverheiratet und berufstätig. In diesen neuen, auf Eltern und Kinder beschränkten middleclass-"Kernfamilien", in denen das Mutter-Kind-Paar die Gefühlsbeziehungen beherrscht, hat sich das Leben des Kindes gewandelt. Es hat seine relative Freiheit verloren, die es in den "Großfamilien" besaß. Nun war es aus mit den Abenteuern im Park! "Die Eltern", schreibt Sennett, "brachten es in die Schule und holten es wieder ab, um es nach Hause zu bringen. In den Park zu gehen, war ihm verboten, und es mußte dicht beim Haus spielen, wo seine Mutter es ständig im Auge hatte." Die erste Etappe also war um 1890 in Chicago das Einschließen des Kindes ins Haus und in die Schule. Die zweite Etappe war die Abwanderung aus der traditionellen Stadt, die von Straßen durchzogen war, in denen es Leben und Geselligkeit gab. Die Stadt, wie wir sie von der Vergangenheit ererbt haben, ist zum Schreckgespenst geworden. Zum Arbeiten kann man noch dorthin gehen, leben läßt es sich dort nicht mehr. Wenn irgend möglich, lebt man auf dem Land, in der Natur. Ein Raum wird geschaffen, der vorgibt, keine Stadt zu sein, der suburb, und der wohlhabendste war der am wenigsten stadtähnliche. In Amerika geschah die Auflösung der Stadt am frühesten und am gründlichsten.
Auch wenn die Entwicklung in Frankreich anders verlief und später eintrat, der Niedergang des städtischen Raums war der gleiche. Dank eines Dokuments aus jüngster Zeit lassen sich die Veränderungen des urbanen Raums in den später im Zuge des großen Zustroms in die Städte zum kompakten Gefüge der Pariser Banlieue zusammengewachsenen kleinen Ortschaften sozusagen an Ort und Stelle nachweisen. Madame Roxane Dubuisson besaß eine Sammlung von Postkarten aus der Zeit um 1900, auf denen Ansichten dieser Vororte mit der Kunst und Präzision der Fotografen jener Zeit abgebildet sind. 1970 kamen zwei junge Männer, Alain Blondel und Laurent Sully-Jaulnes auf die Idee, einige dieser Ansichtskarten auszuwählen, sich anhand der Motive auf die Suche nach diesen Orten zu machen, sie in ihrem neuen Zustand zu fotografieren und schließlich die beiden Serien, die von 1900 und die von 1970, miteinander zu vergleichen. Die Dokumente waren 1972-1973 im Pariser Musee des Arts decoratif ausgestellt. Unter dem Titel: L'Image du temps dans le paysage urbain (Das Bild der Zeit in der städtischen Landschaft) erschien auch ein Album mit Reproduktionen. Darin sehen wir nun jede aufgenommene Ansicht links in ihrem Zustand von 1900, rechts in dem von 1970. Der Vergleich ist niederschmetternd. In der Zeit, die dazwischen liegt, ist alles Leben verschwunden. Es hat sich zwar nicht alles verändert, außer in einigen wenigen Fällen; die Häuser, ihre Ausrichtung, die Gesamtkonstellation, das Kataster sind gleich geblieben. Und doch kommt man in eine ganz andere Welt. Links um 1900, eine lebendige, rechts, um 1970, eine erstarrte, versteinerte Welt.
Sieht man sich die Sache näher an, dann merkt man, daß der Unterschied an folgenden Faktoren liegt: 1. Die Trottoirs, freie, von Bäumen und Menschen besetzte Räume, sind viel schmäler geworden. Sie funktionierten als Verbindung zwischen dem Straßenbett in der Mitte und den steinernen Blöcken der Häuser. Man hat sie derart reduziert, daß sie keine Funktion mehr haben: sie sind leer und nutzlos. 2. Die Bäume sind verschwunden. Die Städte des 19. Jahrhunderts waren im Gegensatz zu denen des Mittelalters und der Renaissance mit Bäumen bepflanzt. Diese sind zwischen 1900 und 1970 verschwunden. 3. Verschwunden sind auch die Bistro-Terrassen. Das Cafe, das Bistro spielten für die Soziabilität dieser Kleinstädte des 19. Jahrhunderts eine wesentliche Rolle. Mit ihren meist beschatteten Terrassen dehnten sie ihr Reich bis auf die Straße aus. Cafe-Terrassen und Bäume bildeten den üblichen Rahmen für die Straße. Die einen wie die anderen sind verschwunden, selbst wenn das Cafe geblieben ist, so ist doch seine Terrasse "privatisiert", vom Haus geschluckt, durch verglaste Wände von der Straße abgetrennt worden. 4. Verschwunden sind der Spaziergänger und die Kinder. Um 1900 wimmelt es auf der Straße von Menschen, die Cafe-Terrassen sind überfüllt. Die Straße gleicht einer mit Bäumen bepflanzten, von Bistros gesäumten, mit Tischen und Stühlen der Cafe-Terrassen vollgestellten Promenade. Unter den Flaneuren viele Kinder jeden Alters, die kleinsten mit ihren Müttern, die größeren allein oder in kleineren Gruppen. Ganz offensichtlich ist jedermann draußen. 1970 hat sich die Straße geleert: so wenig Männer, Frauen und Kinder wie Bäume. 5. Diese Leere ist mit Autos gefüllt worden. Sind sie daran schuld, daß die Stadt zur Wüste wurde? Sicher, es liegt am Auto, wenn die Familien des einfachen Volks ihre Kinder daran hindern, auf der Straße zu spielen, wie die es allen Polizeiverboten zum Trotz stets gewohnt waren. Die Angst vor einem Unfall hat mehr bewirkt als eine Polizei, mit der man sich zu arrangieren wußte. Die Kinder selbst hatten keine Angst; sie wußten sich anzupassen, stiegen hinten auf die Autos auf, so wie sich in den vierziger Jahren ganze Trauben von Kindern an die römischen Straßenbahnen anhängten. Diesmal jedoch machten sich die Eltern Sorgen, und es gelang ihnen, die Kinder zurückzuhalten. Wahrscheinlich hatten auch die Kinder selbst die Lust verloren, auf der Straße herumzurennen.
Das Automobil ist aber nicht die einzige Erklärung. Italienische Städte wie Rom (nicht Neapel) wurden auch von Autos überflutet, aber dort haben diese nicht das Monopol errungen, sie mußten sich die Straße mit einer verwurzelten Menschenmenge teilen. Anderswo, vor allem in Frankreich, haben sie Leere geschaffen, und um noch etwas von der Straße zu retten, waren die Stadtverwaltungen gezwungen, künstliche Räume zu schaffen, die manchmal lebendigen, oft aber toten Fußgängerzonen. Halten wir uns an das Protokoll unserer beiden jungen Pariser Fotografen von 1970: "Vorher. Nachher. Das Auto? Ganz bestimmt. . . Die Landflucht? Sicher auch. Und dann natürlich die Bauunternehmer, die Kriegerdenkmäler, die öffentliche und obligate Beleuchtung, das Netz von Stromdrähten und Masten, die Werbung, das Fernsehen, das die ehemaligen Spaziergänger im Haus hält . . . Die Verantwortlichkeiten sind wie nicht anders zu erwarten verteilt, vernetzt. Das ist klar. Vorher war ein angenehmes Leben zumindest möglich. Danach wurde es häßlich, trübselig, eigentlich unmöglich." Auf der einen Seite eine Stadt mit Menschen, auf der anderen Seite eine Stadt ohne Menschen, wüst, steinern. Bei der Betrachtung dieser Dokumente wird einem klar, daß das, was das Leben einer Stadt ausmacht, die Bewegung, der Austausch, die Begegnung, die Belebtheit der Straße ist.
In Wirklichkeit war dieser Tod der Straße gewollt. Die barg in sich alle Gefahren, die Unmoral, das Ungesunde der Stadt. Man mußte sie zuerst verlassen oder sie auf eine so spezielle Funktion reduzieren, daß man notfalls nicht mehr hinzugehen brauchte, wenn man das Glück hatte, nicht mehr dort zu arbeiten. Das Leben, das sich von der Straße zurückgezogen hatte, breitete sich ringsherum in einem aufgelockerteren Wohngebiet aus, in Häusern und Gärten, in denen man sich so wohlfühlte, daß man keinen Grund mehr hatte, sie zu verlassen. An die Stelle der Straße trat die Fahrbahn, Ort für den Autoverkehr, nicht mehr für die Promenaden von Menschen und Kindern. Dann gingen die Stadtplaner daran, die alten, abends nach Büroschluß verlassenen Innenstädte neu zu gestalten. Man wollte sie gar wiederbeleben, indem man sie den Wohnstädten anglich. Man brauchte nur die Straße zu beseitigen, Quelle der Luftverschmutzung und der Gefahren, Hindernis für die globale Privatisierung des Raums. Le Corbusier und die zerstörerischen Stadtplaner seiner Generation waren keine Barbaren: sie begriffen die Schönheit von Kirchen, Palästen, großartigen Bauwerken. Dagegen stritten sie dem Gewirr von Gassen und Plätzen, den ungesunden und verderblichen Häuserblocks jeden künstlerischen Wert ab: Ihr ehrwürdiges Alter gewährte ihnen kein Privileg mehr. Die Urbanisten wollten sie zerstören und am Boden durch Grünflächen, hoch oben durch luftige, besonnte Türme ersetzen, in denen glückliche Familien wohnten. Die Geschäftsfunktionen sollten an geheiligte, aber außerhalb der Stadt in einer Hinter-Stadt liegende Orte verbannt werden, wohin man sich begibt, um seine Einkäufe zu verrichten, so wie man auf die Toilette geht, um seine Notdurft zu verrichten. Die ideale Stadt wäre dann nur noch ein riesiger Park, mit verstreut darin liegenden, durch Autobahnen miteinander verbundenen modernen Wohntürmen und antiken Monumenten. Die Leute würden daheim bleiben, in ihren Häusern oder Gärten, Kinder würden in eigens für sie konzipierten Bereichen geparkt: Draußen ist niemand mehr, außer ein paar von den Sehenswürdigkeiten angelockte Touristen.
5. Der wiederentdeckte Straßenjunge?
Diese utopische Stadt ist nicht verwirklicht worden (außer in Los Angeles), und die heutigen Ballungszentren sind als Kompromiß zwischen den Zukunftsträumen und den Zwängen der Vergangenheit konzipiert worden. Für die Kinder glaubte man zunächst genug getan zu haben, indem man dem Familienkreis die Bedingungen seines Funktionierens und seiner Sicherheit gewährt hat. Die Privatsphäre der Familie zählte mehr als die ihrer einzelnen Mitglieder. Keine abgelegenen kleinen Schlupfwinkel mehr für die Kinder, in diesem funktionellen Universum, in dem alles vorgesehen war, wo jeder Platz seine Bestimmung hatte. Immerhin hatte man außerhalb des Hauses nicht ohne Widerstreben einige für die Spiele, die Freizeitbeschäftigungen der Kinder vorbehaltenen Plätze zugelassen, für den Fall, daß das Zuhause und die Schule mit ihren vielfältigen Aktivitäten wirklich nicht ausreichen sollten. Moralisten entrüsteten sich, daß diese Plätze entweder ungenutzt blieben oder verwüstet wurden. Außerhalb des Hauses und der aufgezwungenen Spielplätze gab es keine Straßen für die Kinder mehr. So mußten sie sich in dieser allzu quadratischen Welt Lücken suchen, in denen sie sich einrichten konnten wie einstmals auf der Straße: Tiefgaragen, Treppenhäuser, die wenigen vergessenen oder verlassenen Ecken, ja, auch die Keller, deren Türen sie aufbrachen.
Die Kunsthistoriker waren, wie mir scheint, die ersten, die noch vor den von den Wundern der Moderne geblendeten Ärzten, Soziologen, Psychologen und Priestern über diese Abwertung der Straße beunruhigt waren, gegen ihre Zerstörung protestierten, ihre Funktionen, zuvorderst natürlich ihre ästhetischen Funktionen, verteidigten. Die Schönheit einer Stadt beruht in der Tat nicht nur auf ihren Bauwerken, sondern auf ihrem Gefüge von Häuserzeilen und Blocks (insulae), ihrem Straßennetz, das schon allein für sich ein absolut unersetzliches und höchst fragiles Kunstwerk darstellt. Ein schadhaftes Gebäude kann restauriert oder sogar neu aufgebaut werden. Das Netzwerk der Straßen und Häuserzeilen, das in seiner Unregelmäßigkeit nicht kopierbar ist, läßt sich niemals wiederherstellen. Sein pittoresker Charakter beruht auf einer Summe von Kleinigkeiten, die sich nicht vorher festlegen lassen. Die Straße wurde also zunächst aus ästhetischen Gründen rehabilitiert. Humanwissenschaftler wenden heute von den Kunsthistorikern übernommene Argumente und Fragestellungen auf den sozialen Bereich an. Inzwischen ist man sich allgemein einig, daß es besser ist, eine Straße für den Autoverkehr zu sperren, damit Kinder dort frei spielen können, als eine Straße oder einen Hof zu zerstören, um dort einen für sie reservierten Raum einzurichten, den sie - wie man weiß - nicht annehmen werden. Setzt sich womöglich der Gedanke durch, daß man das Kind wieder in die Stadt integrieren muß, anstatt die Stadt zu zerstören, unter dem Vorwand, Familie und Kind zu schützen?
[1] Arlette Farge, Vivre dans la rue à Paris au XVIlle siècle, Paris, Gallimard-Julliard, 1979, Neuaufl.
[2] Marie-José Chombart de Lauwe, "Un intérêt ambigu, des discours piégés" in Dans la ville, des enfants, Autrement Nr. 10, September 1977, S. 6-13.
[3] Richard Sennett, Families Against the City: Middle Class Homes of Industrial Chicago, 1872-1890, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970.
[4] François Barré, "L'Espace d'un moment ou l'enfant inusité", in Traverses, 4, Mai 1976, S.41-47 (Zitat S. 45).
[5] Philippe Meyer, L'Enfant et la raison d'Etat, Paris, Ed. du Seuil, 1977.
[6] Philippe Ariès, "The family and the city", in Daedalus, Bd. 106, Nr. 2, Frühjahr 1977, S. 227-237.
Aus dem Französischen von Renate Heimbucher
Philippe Ariès: Das Kind und die Straße - von der Stadt zur Anti-Stadt. Aus dem Französischen von Renate Heimbucher. In: Freibeuter. Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik. Ausgabe #60 vom Juni 1994. Berlin 1994, S. 75 - 94.
Anemon 3 SMD ist Transportmittel und Wohnung in einem und besteht aus einer klauenförmigen Metallkapsel auf drei Rädern. Mit Computerausrüstung und mobilem Telefon hält sich der Stadtnomade mit der Umwelt in Verbindung während den Reisen von Stadt zu Stadt. Anemon ist sein einziger Wohnplatz und der elektronische Briefkasten seine einzige Anschrift. Der Stadtnomade ist mobil im wahrsten Sinne des Wortes.
Anemon repräsentiert einen alternativen Lebensstil, ein Leben wie das der Nomaden, doch für den modernen Menschen unserer Zeit angepaßt. Die Stadtnomaden leben außerhalb der gesellschaftlichen Kontrolle. Im toleranten Chaos der Stadt finden sie die Freiheit in verlassenen Gebäuden und auf ehemaligen Industriegeländen - Treffpunkte mit vielen Möglichkeiten. Hier kann sich Anemon richtig entfalten. Das schützende Zelt ist zum schlafen und arbeiten und unter einem transparenten Baldachin hat der Stadtnomade ein Wohnzimmer, seine private Zone, wo immer er auch lebt.
Die beiden Architekturstudenten, Jens Langert und Pia Cally Ahlgren haben das Design für Anemon während ihrem Austauschjahr an der HDK in Göteborg entwickelt - von Idee bis zum fertigen Prototyp in voller Größe. Ich besuchte sie in ihrem Anemon.
Wie sind sie auf die Idee gekommen und was wollen sie mit Anemon erreichen?
Anemon als Idee, ist ein Produkt der Großstadtgesellschaft und der Lebensbedingungen unter denen wir Westeuropäer leben. In unserer Gesellschaft finden wir eine zunehmende Konzentration der Innenstadt, große Wohnsiedlungen und verlassene Industriegeländer. Mit dieser Problematik hat sich das Vardeprojekt ausseinandergesetzt. Uns Innenarchitekten wurde die Aufgabe gegeben, für diese Plätze Alternativen zu finden.
Wir waren von diesen abenteuerlichen Geländen fasziniert und die Lebensanschauung der Nomaden hat uns auch inspiriert. Wir wollten den Stadteinwohnern zeigen, daß man auch anders leben und denken kann. Wir wollen, daß die Menschen mal richtig über ihr Leben heute nachdenken. In unserer Gesellschaft ist der materielle Konsum ein Maßstab für Geborgenheit und Status. Die Nomaden dagegen suchen die Geborgenheit in ihrem Inneren. Die moderne Kommunikationstechnologie und die mobilen Computer ermöglichen ein Leben mit großer persönlicher Freiheit und Beweglichkeit, ohne daß der Kontakt zur Umwelt verloren geht.
Wer will so leben wie ein Stadtnomade?
Menschen, die sich vom materiellen Konsum befreien wollen. Menschen, die für ihren Lebensunterhalt weniger ausgeben möchten und in ihrem Leben Beweglichkeit wünschen. Es könnte jedermann sein. Die Menschen entwickeln ein zunehmendes globales Bewustsein. Wir (die Menschen im westlichen Teil von Europa) lesen dieselben Zeitungen, sehen die ähnlichen Fernsehprogramme, wir reisen rund um die Erde und können uns auch mit weit entfernten Zielen einfach in Verbindung setzen. Die Frage der Nationalitat verliert mehr und mehr an Bedeutung. Viel wichtiger ist heute die Zugehörigkeit einer Gruppe. Der gemeinsame Lebensstil verbindet die verschiedenen Gruppen von Stadtnomaden.
Wie sieht der Alltag der Stadtnomaden aus und wovon leben sie?
Vielleicht ernähren sie sich durch Saisonsarbeit und wollen die Freiheit haben, mitten im Monat aufbrechen zu können oder sie haben eine ganz normale Arbeit wie jeder, der beruflich auf seinem Computer Informationen empfangen und schicken kann. Sie können auch geographisch unabhängig sein. Vielleicht arbeiten sie im Bereich der modernen Technologie mit Mobiltelefon und Computer. Sie können auch durch ihren Databasis Arbeit finden und Informationen über Plätze mit guten Lebensbedingungen. Sie können Berichte und Erfahrungen von ehemaligen Bewohnern bekommen.
Zum Beispiel: Schöner Platz, zentral gelegen, etwas kühl und zugig, relativ sicher, selten frei.
Der Standard zwischen den verschiedenen Plätzen ist sehr unterschiedlich und u.a. davon abhängig, ob sanitäre Anlagen vorhanden sind. Wenn nicht, benutzt man die Waschsalons und Schwimmbader für die Wäsche und die persönliche Hygiene. Das Wasser für den Haushaltsbedarf wird in einem Wasserkanister aufbewahrt. Das Essen wird auf einem Spirituskocher zubereitet. Die durch Sonnenzellenpaneele wiederaufladbare Anemonbatterie sorgt für den Kühlschrank. Schlafen tut der Stadtnomade auf einer Luftmatratze oder in einem Liegestuhl in dem Zelt, das durch die eigene Körperwärme warmgehalten wird. Ein Wohnzimmer und einen Garten hat der Stadtnomade unter einem Baldachin aus transparentem Material. Die provisorische Einrichtung ist aus dem, was in der Umgebung zu finden ist, zusammengebaut. In einer Kapsel aus Metall sind Wertsachen sowie der moderne Computer und die kommunikationstechnische Ausrüstung sicher aufbewahrt. Die Baldachine von Anamon können miteinander verbunden werden und das wettergeschützte Zelt kann für viele Zwecke verwendet werden. Familienleben oder Wohngemeinschaft - die Stadtnomaden haben viele Möglichkeiten, wie sie ihr Leben gestalten wollen.
Wird die Gesellschaft den Stadtnomaden akzeptieren?
Als erstes wollen wir feststellen, daß die Stadtnomaden keineswegs auf Kosten von Anderen leben. Sie ernähren sich von ihrer Arbeit und sie bezahlen ihre Versicherungen und Steuern. Die Stadtnomaden sind natürlich von der Gesellschaft abhängig, aber die Gesellschaft braucht auch bewegliche Menschen mit extremer Flexibilität. Historisch gesehen ist es öfters zum Streit zwischen den Nomaden und der seßhaften Bevölkerung gekommen und die letztere ist tatsächlich bedroht. Die meisten Gesellschaften sind der Ansicht, daß jeder von uns ein Teil des Systems ist. Zugespitzt kann man sagen, daß es Menschen gibt, die das morden mit dem Argument rechtfertigen, sie hätten nur einen Befehl ausgeführt. Wenn es soweit gekommen ist, hat der Mensch seine persöhnliche Verantwortung verloren. Menschen, die sich weigern, Befehle auszuführen, können von der Gesellschaft als drohend empfunden werden. Warum wurden ausgerechnet die Juden und Zigeuner, zwei Völker ohne eigentliche Heimat, von den Nazis so verfolgt? Ein Nomade hört auf seine innere Stimme. Ein Leben voller Schlendrian ist ihm fremd. Der Nomade macht seine eigenen Beobachtungen und verläßt sich auf seinen Instinkt.
Ist der Lebensstil der Stadtnomaden nur für gesunde, starke und mutige Menschen geeignet?
Heutzutage gibt es viele kräftige und gesunde Menschen, die ihr Leben wie im Schlaf leben. Die Menschen spielen die Rolle, die ihnen von der Gesellschaft vorgeschrieben wird. Wenn du dich für den Lebensstil der Stadtnomaden entscheidest, wird dein Mut und Selbstbewustsein größer sein als vorher. Die Nomaden haben keine Wahl, sie müssen ihren Herzen vertrauen. Da finden sie die Kraft für ein Leben in Freiheit
lnterview: Anna Jaktén
VARDENEWS NR 4; Seite 11
Guten Tag!
Nachstehende Texte zum Thema Wohnungslosigkeit & Armut fand ich im Verlauf meiner Arbeit. Weil sie in der einen oder anderen Hinsicht bedeutsam sind, dokumentiere ich sie hier.
-
AberHallo: Haste nicht ein paar rostige Groschen für mich? Berber erzählen. Nordenham 2007
-
Anemon 3 SMD - die Wohnung der Stadtnomaden
-
Ariès, Philippe: Das Kind und die Straße - von der Stadt zur Anti-Stadt. Berlin 1994
-
Batarilo, Dunja: Die Arche darf nicht mehr Landowsky heißen. taz 04.03.2008
-
Baumann, Winfried: Instant Housing für Obdachlose und urbane Nomaden. Berlin 2007
-
»Bidler an der Dur« Armut in der Geschichte - Bettler an der Tür. Michelstadt 1996
-
Broder, Henryk M.: Hilfe von Obdachlosen. Große Spendenaktion im Süden der Republik. Berlin 1996
-
Brus, Roland: Projektbeschreibung: Über das Arbeiten mit "Ratten". Berlin 1995
-
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.:
 Merkblatt zu den rechtlichen Anspruchsgrundlagen nach den §§ 67ff. SGB XII bei nichtdeutschen Personen. Bielefeld Mai 2008 (pdf)
Merkblatt zu den rechtlichen Anspruchsgrundlagen nach den §§ 67ff. SGB XII bei nichtdeutschen Personen. Bielefeld Mai 2008 (pdf) -
Bunz, Mercedes: Urbane Penner (Meine Armut kotzt mich an). Berlin 2007
-
Czaplewski, Heinz: Soziale Erlebnisse eines Obdachlosen. Rede zur Kundgebung "Die Würde des Menschen ist angetastet"! Berlin 1998
-
Der selbstkritische Psychotest! Sind Sie sozial veranlagt?. Solingen 1996
-
Eck, Georg: Großstadtvagabondage. Berlin 1925
-
Engels, Friedrich: Zur Wohnungsfrage. Leipzig 1872/1873
-
Fassbinder, Rainer-Werner: Gab es Zeiten. Gedicht.
-
Flusser, Villém: Wohnung beziehen in der Heimatlosigkeit (Heimat und Geheimnis - Wohnung und Gewohnheit). Düsseldorf, Bensheim 1992
-
Franck, Michel: Schön ist es auch anderswo. Über Vagabunden und sonstige Touristen. Paris 2000
-
Geißler, Cora: Wie ich lernte, ein Ufo zu lieben. Hamburg: einestages 2008
-
Gillich, Stefan Zur Selbsthilfe Wohnungsloser - Zwischen Ignoranz und Verkennung. Bonn 2002
-
Grulich, Paul: Dämon Berlin. Berlin 1907
-
Haarmann, Anke: Public Blue: eine Besetzung des öffentlichen Raums. Wohnungslose in Japan. Hamburg 2003
-
Hannes: Platte Mainz / Bingen o.J.
-
Helwerth, Ulrike: Vagabundin des Denkens (Hannah Arendt). Berlin 1995
-
Holm, Andrej: Hartz IV und die Konturen einer neoliberalen Wohnungspolitik. Berlin 2005
-
Holzach, Michael: "Betteln ist schwerer als arbeiten". Hamburg 1975
-
ISIS Berlin e.V./ Klik e.V.: Junge Menschen auf der Straße in den Berliner Innenstadtbezirken. Zusammenfassung einer Studie. Berlin 2007
-
Jordan, Erwin: Thesen zur aktuellen Diskussion um "Straßenkinder" in der Bundesrepublik. Bielefeld 1995
-
Karr, H.P. & Wehner, Walter: Berbersommer. Essen 1992
-
Kiebel, Hannes: "Na, du alter Berber". Beschreibung der Spurensuche zum Begriff "Berber". Berlin 1995
-
Kiebel, Hannes: Obdachlose in den 20er Jahren in Berlin. Berlin/ Hannover 1995
-
Kiebel, Hannes: Obdachlose Menschen in Deutschland. Berlin 1994
-
Kiebel, Hannes: Untergang. Berliner Obdachlosen GmbH. Anregungen zu einem Film für die Gemeindearbeit. d+d 1994
-
Kracauer, Siegfried: Städtische Wärmehalle. Frankfurt 1931
-
Krauskopf, Simone: Ohne Wohnung - ohne Recht? Freiburg 1994
-
Lenuweit, Klaus: Schon als Kind obdachlos. Ein Portrait. ohne Ort um 1997
- Löwer, Dirk: Dipl. Bettel. Berlin 1999
-
Mayer, Margit/ Veith, Dominik/ Sambale, Jens: Das neue Gesicht metropolitaner Obdachlosigkeit. Stadtentwicklung und Obdachlosigkeit in Berlin zwischen globalen Zwängen und lokalen Handlungsoptionen. Berlin 1995
-
Mitarbeiterteam der Ambulanten Hilfe e.V.: High-tech braucht High-soz! (Wohnungslosenhilfe) 25 Jahre Ambulante Hilfe e.V. im Rückblick 1978-2003. Stuttgart 1988 sowie in: Gefährdetenhilfe 1/89, Bielefeld 1989, S. 39 - 40.
-
Negt, Oskar: Die Krise der Arbeitsgesellschaft. Bonn 1995
-
Neubart, Justus: Struktur der Hilfen für wohnungslose Menschen in Berlin. Gegebenheiten & Visionen. Diplomarbeit am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Berlin. Berlin 1997
-
Oberhuber, Florian: Vagabundische Mobilität. Wien 2004
-
OfW e.V. (OfW = Ohne festen Wohnsitz ): Wohnungslosenselbsthilfe. Konzeption des OfW e.V. Köln um 2001
-
Peris, Dieter: Die Killler-Dogge auf dem Schwarzwaldhof und andere Geschichten. Bochum 1994
-
Preisendörfer, Bruno: Leute, auf die es nicht ankommt. Berlin 2007 (Le Monde Diplomatique)
-
Pro 95: Ein Theaterprojekt (mit Wohnungslosen) . Wien 1995/96
-
Rakowitz, Michael: ParaSite. Unterschlupfsystem für Obdachlose. Brooklyn 2005
-
Reding, Josef: Herr Brockstiepel und die Penner. Freiburg 1982
-
Riedel, Jürgen: Penner (Gedicht). Frankfurt 1996
-
Riege, Marlo: Entzieht die Wohnungsnot der sozialen Arbeit die Basis? Nicht nur in der Obdachlosenhilfe. Mönchengladbach 1994
-
S.H.: "N' Morgen im A - Bereich". Offenburg 1996
-
Schilf, Sabine/ Schneider, Stefan/ Zglinicki, Claudia von: Obdachlose Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg. Eine Untersuchung der Problematik und konzeptionelle Überlegungen. Vorgelegt durch die S.T.E.R.N. Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH - Treuhänderischer Sanierungsträger -. Berlin 1996
-
Schlör, Joachim: Obdachlosigkeit. München 1994
-
Schweizer, Sabine: Theater - der Weg zum Empowerment. Die unkonventionelle Methode zur Arbeit mit KlientInnen von sozialtherapeutischen Einrichtungen im Bereich der Obdachlosigkeit. Diplomarbeit an der Bundesakademie für Sozialarbeit; Wien 1997
-
Seidel, Markus Heinrich: "Aber mich fragt ja doch keiner, Alter...". Straßenkinder in Deutschland: Die professionelle Jugendhilfe hat kläglich versagt und muß jetzt ihre selbsternannte Kompetenz in Frage stellen.
-
Stamm, Volker: Die rationale Anordnung der Menschen. (Randgruppen in der traditionellen Gesellschaft/ Der Höhepunkt der Internierungspolitik/ Der Übergang zur liberatlistischen Armenpolitik). Frankfurt am Main 1982
-
Thormann, Henry: Ein Jahr geht zu Ende. Heidelberg 1999
-
Tietze, Barbara: Industriekultur am Wendepunkt. Lebensformen und Nomadismus. Eine kulturtheoretische Bemerkung, die auch eine arbeitswissenschaftliche Relevanz hat. Berlin 1995
-
Tietze, Barbara: Neue Nomaden - nomadische Arbeitskulturen? Zukunftsprognosen für die kulturelle Entwicklung der Industrie, der Arbeit und des Design. Berlin 1991
-
Toth, Jennifer: Der Untergrund in Geschichte, Literatur und Kultur. Berlin 1994
-
Trappmann, Klaus: Vom Preis der Freiheit. In: Städtische Kunsthalle Recklinghausen (Hrsg.): Fahrendes Volk. Spielleute, Schausteller, Artisten. Katalog zur Ausstellung. Recklinghausen 1981, ohne Seitenangabe.