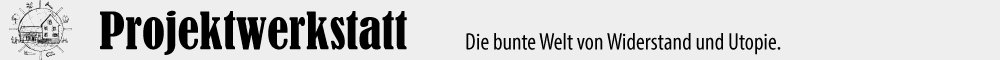Freie Universität Berlin
John F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien und Otto Suhr-Institut für Politische Wissenschaft
SoSe 1996
HS 32511 Obdachlosigkeit in Nordamerika und Deutschland
Dozenten: Prof. Dr. Margit Mayer und Stefan Schneider
Markus Eberhardt und Oliver Sudmann
Die Rolle des Internet als Präsentationsforum für Obdachlosenzeitungen und als Kommunikationsmittel für Obdachlose
Praktischer Beitrag zum Seminarthema
Zum Thema 'Obdachlosigkeit und Internet'
Fazit
Anhang:
Fragebogen zur Internetnutzung durch Obdach- bzw. Wohnungslose
Fragebogen an die Redaktion der Obdachlosenzeitung motz &Co
Praktischer Beitrag zum Seminarthema
1. Zum Thema 'Obdachlosigkeit und Internet'
Basierend auf unserem Referat über die Rolle des Internet als Präsentationsforum für Obdachlosenzeitungen und als Kommunikationsmittel für Obdachlose, haben wir den Versuch gemacht, der Frage der Notwendigkeit der Internetnutzung für Obdachlose nachzugehen. Ausgangspunkt für die Arbeit waren für uns Denkansätze und Argumente, die in den folgenden drei Texten zum Ausdruck kamen:
- James L. Eng. Im Internet fühlen sich Seattles 'Homeless People' nicht diskriminiert. In: (http://userpage.fu-berlin.de/-zosch).
- Stefan Schneider. motz & Co - Jetzt weltweit im Internet. (http://userpage.fu-berlin.de/-zosch). Auch in: wohnungslos. Aktuelles aus Theorie und Praxis zur Armut und Wohungslosigkeit. 37. Jahrgang, 3/95, Bielefeld 1995.
- Jan Teszcla. Internet für Obdachlose. In: (http://userpage.fu-berlin.de/-zosch).
Die Kernaussagen der drei Texte sollen in diesem Zusammenhang nochmal kurz dargestellt werden. Sowohl Stefan Schneider, als auch Jan Teszcla legen in ihren Aufsätzen zugrunde, daß das Internet in unserer Gesellschaft eine zunehmende Bedeutung erfährt:
"(...), kaum ein Bereich des öffentlichen und privaten Lebens ist davon nicht betroffen."[1]
Gerade deshalb, so die Argumentation, ist es besonders für Randgruppen wichtig, mit den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten. Eine Verschärfung der ohnehin schon bestehenden sozialen Gegensätze soll durch die Präsenz von Obdachlosenzeitungen im Internet aufgefangen werden, indem die neue Technologie nicht nur privilegierten Gruppen vorbehalten bleibt, sondern eben auch Obdachlosen ein Zugang zum Netz ermöglicht werden soll. Das Internet als Diskussions- und Präsentationsforum, so beide Autoren weiter, könnte Obdachlosen die Möglichkeit bieten, auf sich und ihre Probleme aufmerksam zu machen. Stefan Schneider, ehemals Redaktionsmitglied der Obdachlosenzeitung motz & Co, schildert die redaktionelle Sichtweise:
"In unserem redaktionellen Selbstverständnis wollen wir die Sicht derer von unten, der Ausgegrenzten, drucken und manchen Ängstlichen helfen, seine Stimme zu erheben. Insbesondere Obdachlose sind unsere wichtigsten Korrespondenten, aber auch jene, die sich in der gefahrenvollen Welt der Armen und Heimatlosen bewegen. Wir sind ein Armenjournal, reich an Ideen für einen lebendigen, anspruchsvollen und kritischen Journalismus sowie hintergründige Informationen. Wir wollen etwas bewegen und werden auch Bewegung einfordern - nicht nur bei den Politikern. Wir schauen aus der Szene heraus nach draußen, nicht von draußen auf die Szene drauf."[2]
Ferner hebt der Autor den redaktionellen Anspruch der motz & Co hervor, auch den obdachlosen Redakteuren durch die Internetnutzung innovative journalistische Arbeit zu ermöglichen. Als mittelfristige Zielsetzung beschreibt Stefan Schneider die positiven Auswirkungen einer nationalen und sogar internationalen Vernetzung, mit der Absicht, einen schnelleren Informationsaustausch nutzen zu können, um das Anliegen von Obdachlosenzeitungen (in seinem Aufsatz bezieht Stefan Schneider dies speziell auf die Obdachlosenzeitung motz & Co) auch international besser vermitteln zu können. Der Kooperation mit anderen Armen- und Wohnungslosenzeitungen gilt sein besonderes Interesse.
Jan Teszcla, der sich selbst als Obdachloser bezeichnet, stellt im wesentlichen die Vorzüge dar, die Obdachlosen durch einen Internetzugang zugute kämen. Der Autor argumentiert, daß ein menschenwürdiges Dasein auch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben einschließt und eben nicht nur Nahrungsaufnahme und Hygiene bedeutet. Das Internet sieht Jan Teszcla als unabdingbar an, um das Informationsbedürfnis der Obdachlosen zu befriedigen.
James L. Eng hingegen beschreibt in seinem Aufsatz ganz persönliche Erfahrungen, die Obdachlose in Seattle, W.A., in den Vereinigten Staaten von Amerika, mit den Möglichkeiten, die das Internet bietet, gemacht haben. Anhand von Einzelfallbeschreibungen stellt Eng das Internet als soziales Netz dar. Den Obdachlosen bietet sich nicht nur die Möglichkeit der Kommunikation über größere Entfernungen (z.B. einen Erfahrungsaustausch mit Personen in anderen Städten), sondern diese Kommunikation kann, so der Autor, vor allem vorurteilsfrei ablaufen, da man den Kommunikationspartner nicht sieht und somit nicht Gefahr läuft, jemanden nur aufgrund seiner äußeren Erscheinung zu beurteilen.
"Wer einmal per E-mail kommuniziert hat oder im Internet war, der weiß, daß er dort mehr Freunde treffen kann, als er es sich jemals hätte träumen lassen. Dazu kommt, daß der Gesprächspartner nicht sehen kann, wie man angezogen ist oder wo man lebt. Das Internet kennt keine Klassen, Rassen, keine Geschlechter."[3]
Das Internet könnte so für Obdachlose ein Gefühl der Sicherheit und der Anonymität vermitteln. Sehr positiv wird auch die Möglichkeit des Zugriffs auf eine Vielzahl von Informationen gesehen. Ebenso bietet das Internet die Möglichkeit, sich autodidaktisch zu schulen und sich auf diesem Weg eventuell sogar Qualifikationen für einen Wiedereinstieg in das Berufsleben zu erwerben. Das Internet als produktive Rückzugsmöglichkeit wird von (einem Betroffenen wie folgt beschrieben:
"Ich weiß nicht, was die anderen im Internet suchen, aber ich brauche einfach eine Rückzugsmöglichkeit, einen Ort, wo ich mich wohlfühlen und lernen kann. Sonst würde ich wahrscheinlich noch verrückt werden."[4]
2. Zum praktischen Vorgehen
Wie eingangs erwähnt, waren die Argumente in den Texten Ausgangspunkt unseres praktischen Beitrags. Unser Ziel war es, anhand von Fragebögen und Gesprächen mit Obdachlosen, Verkäufern von Obdachlosenzeitungen und Redaktionsmitgliedern der Zeitungen zu erfahren, wie die Notwendigkeit eines Internetzugangs eingeschätzt wird. Hierzu haben wir zwei Fragebögen erstellt: Einen Fragebogen, der sich an die Verkäufer von Obdachlosenzeitungen richtet und einen, den wir an die Redaktion der motz & Co geschickt haben. Jeweils ein Exemplar beider Fragebögen liegt der Arbeit bei.
Daß wir den Redaktionsfragebogen nur an die Obdachlosenzeitung motz & Co geschickt haben, liegt an der Tatsache, daß sie die einzige Obdachlosenzeitung in Berlin ist, die Erfahrung mit dem Internet gemacht hat. Wie die momentane Internetnutzung aussieht, konnten wir nicht endgültig klären. Mit Hilfe des Fragebogens wollten wir Erkenntnisse einziehen, die die motz & Co im Zusammenhang mit ihrer Präsenz im Internet gemacht hat. So hat uns beispielsweise interessiert, ob es Leserbriefe und Kommentare allgemeiner Art hinsichtlich der Arbeit motz & Co gegeben hat, die auf die Präsenz der Obdachlosenzeitung im Internet zurückzuführen sind. Ferner hat uns auch interessiert, inwieweit das Anliegen von Stefan Schneider, obdachlose Redakteure und Zeitungsverkäufern mit dem neuen Medium und seinen Möglichkeiten vertraut zu machen, umgesetzt worden ist. Unter Berücksichtigung des Textes von James L. Eng, war es uns sehr wichtig, Einschätzungen seitens der Redaktion der motz & Co zu bekommen, die das Nutzungsverhalten von Obdachlosen im Umgang mit dem Internet beschreiben. Ein Interview mit Redaktionsmitgliedern der motz & Co ist uns leider nicht ermöglicht worden. Statt dessen bat man uns, unsere Fragen schriftlich einzureichen. Beim Schreiben der Arbeit lagen uns noch keine Antworten auf unsere Fragen seitens der Redaktion vor! Jedoch war es uns möglich, ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden des motz e.V. , Herrn Otto Schickling, zu führen. Dieses Gespräch fand in der Notunterkunft des Vereins in der Kleinen Hamburger Str. 2 in Berlin-Mitte statt. An diesem Gespräch nahmen auch Verkäufer der Obdachlosenzeitung motz & Co teil, die zur Zeit in der Notunterkunft wohnen. Ein weiteres Interview konnten wir mit zwei Redakteuren des Strassenfeger, der jüngsten Berliner Obdachlosenzeitung, führen. In diesem Gespräch haben wir - mit Blick auf unsere Fragestellung - versucht, eine Stellungnahme zu den Argumenten der von uns verwendeten Basistexte zu bekommen. Ein ebensolches Gespräch bei der Redaktion der Obdachlosenzeitung Platte kam nicht zustande, da über mehrere Tage dort niemand zu erreichen war. Ferner haben wir auch Jan Teszcla angeschrieben, um mit ihm über seine Interneterfahrung zu sprechen. Leider haben wir auch hier keine Antwort erhalten. Die geführten Interviews wurden von uns mitgeschnitten und liegen ebenfalls der Arbeit bei.
Die von uns befragten Obdachlosen waren allesamt auch Verkäufer der Obdachlosenzeitung motz & Co. Mit Verkäufern anderer Obdachlosenzeitungen zu sprechen, ist uns im Rahmen der Zeit, die uns für dieses Projekt zur Verfügung stand, nicht möglich gewesen. Zudem stellte sich als Problem heraus, daß von den befragten Personen weniger als wir erhofft hatten, bereit waren, den Fragebogen auszufüllen. Als Gründe wurden zumeist Desinteresse aber auch völliges Unverständnis hinsichtlich der Frage nach dem Internet genannt. Einige Personen gaben auch an, aufgrund ihrer körperlichen Verfassung (z.B. Müdigkeit) nicht in der Lage zu sein, den Fragebogen auszufüllen. Insgesamt standen uns neun Fragebögen zur Auswertung zur Verfügung. Bei unseren Befragungen der Obdachlosen war lediglich eine Frau zugegen; die Fragebögen wurden allesamt von Männern ausgefüllt.
Schließlich waren wir bei unseren beiden Interviews mit der Situation konfrontiert, daß die befragten Personen wesentlich mehr zur allgemeinen Problematik der Obdachlosigkeit zu `sagen hatten , als zu der Frage der Internetnutzung.
3. Zur Auswertung der Fragebögen
Der Fragebogen, der sich an die Verkäufer von Obdachlosenzeitungen richtet, ist so aufgebaut, daß zunächst nach persönlichen Angaben gefragt wird, wie beispielsweise nach der Wohnsituation, der Ausbildung und den Einkommensquellen. Im weiteren haben wir dann probiert, festzustellen, ob ein Informationsmangel besteht - und daran geknüpft auch ein Mangel an Sozialisation - und wie sich informiert wird, wobei in dieser Frage (Frage 7) zum ersten Mal auch das Internet angesprochen wird. Ab Frage 9 wird dann konkret auf das Internet eingegangen. Bei einer negativen Beantwortung der Frage 9 ("Wissen Sie was das Internet ist?") können die darauffolgenden Fragen nicht mehr beantwortet werden. Die Fragen 14 bis 18 sind hypothetische Fragen, da wir versuchen wollten, zumindest eine Einschätzung der Möglichkeiten, die das Internet bieten kann, zu bekommen. Den Angaben zu diesen Fragen sind dementsprechende Erklärungen von unserer Seite vorausgegangen. Die jeweiligen Zusatzfragen zu den Fragen 14 und 16 (die Fragen 15 und 17) wurden in der Regel nicht beantwortet. Die Frage 16 mag vielleicht auch etwas unglücklich gestellt sein, zumindest wurde sie von knapp der Hälfte der Befragten nicht ausgefüllt. In diesem Zusammenhang ist wohl auch zu bedenken, ob der hypothetische Charakter bei den Fragen 14 und 16 angemessen ist, wenn die befragten Personen keinerlei Erfahrung mit dem Internet haben.
Bei den Personen, die die Fragebögen auszufüllten, war durchweg ein großes Engagement zu beobachten, was dadurch zum Ausdruck kam, daß sich mit dem Ausfüllen der Bögen auch ein Gespräch hinsichtlich der gestellten Fragen entwickelte. Auch wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich nicht nur auf die von uns vorgegebenen Antworten zu beschränken, sondern auch eigene Ergänzungen anzugeben. Dies geschah vorzugsweise mündlich und kaum schriftlich. Allerdings mußten wir auch immer wieder deutlich machen, daß wir um ehrliche Antworten bemüht waren, daß es beispielsweise keine Schande ist, nicht zu wissen, was das Internet ist. Auf Nachfragen stellte sich dann manchmal heraus, daß Personen, die vorgaben, das Internet zu kennen, im Grunde doch nicht wußten, was das Internet ist. Bei einem Fragebogen kam es zu unlogischen Aussagen. So wurde angegeben, "zum Teil" zu wissen, was das Internet ist. In einer der darauffolgenden Fragen wurde dann jedoch angegeben, daß man im Internet herumstöbert und es durchschnittlich einmal die Woche fünf bis zehn Minuten benutzt.
Sieben der Befragten gaben an, obdachlos zu sein; einer war seinen Angaben zufolge nicht obdachlos, und einer gab an, durch den Verkauf der motz & Co eine Wohnung gefunden zu haben. Im Schnitt waren diejenigen, die angaben obdachlos zu sein, bereits zwischen drei und fünf Jahren obdachlos; jeder der Obdachlosen war mindestens bereits seit einem Jahr obdachlos und einer bereits seit 13 Jahren. Die meisten Befragten gaben an, einen Hauptschulabschluß und eine abgeschlossene Berufsausbildung zu haben. Lediglich einer hatte seinen Angaben zufolge nur einen Hauptschulabschluß und keine zusätzliche Berufsausbildung; einer gab an, keine Qualifikationen zu haben. Mit der Frage zu der Art der Einkommensquellen, wollten wir versuchen den Stellenwert herauszufinden, den der Verkauf von Obdachlosenzeitungen bei den Befragten hat. Sechs der Befragten gaben an, sich vorwiegend durch den Verkauf von Obdachlosenzeitungen zu finanzieren. Zwei Personen gaben an, vorwiegend staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, und einer der Befragten gab an, daß bei ihm die staatliche Unterstützung und der Verkauf von Obdachlosenzeitungen gleiche Anteile hätten. Ein Großteil der Befragten schätzt daher den Verkauf von Obdachlosenzeitungen als wichtige Tätigkeit zur Finanzierung ihres Lebens ein. Keiner der Befragten zeigte sich mit der staatlichen Unterstützung zufrieden. (Einer gab an, daß er zwar zufrieden sei mit der staatlichen Unterstützung, beklagte aber, daß er nicht "rankomme". Diese Aussage hinterließ bei uns offene Fragen.)
Fünf der neun Befragten beklagten einen Informationsmangel und brachten dies in direkten Zusammenhang mit ihrer Wohnungslosigkeit. Drei der Befragten sahen für sich keinen Mangel an Information, und einer ließ die Frage unbeantwortet. Aus den mündlichen Anmerkungen der Befragten ergab sich für uns der Eindruck, daß mit Informationsmangel weitgehend eine generell empfundene Benachteiligung gemeint war. Bei der Frage nämlich, woher man seine Information bezieht, brachten alle Befragten im Gespräch zum Ausdruck, daß sie mit ihren Informationsquellen zufrieden waren. Ein einheitliches Bild ergab sich insofern , als daß keiner der Befragten das Internet als Informationsquelle benutzt; Radio, Fernsehen und Zeitung als klassische Informationsquellen wurden durchgängig angekreuzt. Als elementar wichtig zeigte sich die mündliche Kommunikation unter den Obdachlosen, sozusagen die Mund-zu-Mund-Propaganda.
Bei der Frage nach einem Mangel an Sozialisation - bedingt durch die Wohnungslosigkeit, aber eventuell auch bedingt durch ein Gefühl, ungenügend informiert zu sein - ergab sich ein ausgewogenes Verhältnis der Antworten: Vier der Befragten antworteten mit ja und vier mit nein; einer ließ die Frage unbeantwortet. Diese Frage war uns besonders wichtig hinsichtlich des eingangs erläuterten Arguments, daß das Internet auch als eine Art sozialen Netzes fungieren kann. Diejenigen, die einen Mangel an Sozialisation beklagten, führten dies aber auf ihre Lebensumstände und die Reaktion der Gesellschaft auf dieselben zurück. Keiner der Befragten war der Ansicht, daß die Möglichkeiten, die ein Internet bietet, diesbezüglich Abhilfe schaffen könnte.
Die konkrete Frage nach dem Internet (Frage 9) wurde von der Hälfte der Befragten positiv beantwortet; die andere Hälfte wußte nicht, was das Internet ist. Einer der Befragten antwortete, daß er "zum Teil" wisse, was das Internet sei. Da er sich in der Folge allerdings widersprach, ist eventuell davon auszugehen, daß er nicht weiß, was das Internet ist. Keiner der Befragten gab an, einen Zugang zum Internet zu haben; einer ließ diese Frage unbeantwortet. Bis auf einen Fragebogen, der hier nicht ganz schlüssig war, blieben dementsprechend die Fragen 11, 12 und 13 unbeantwortet.
Auf die Problematik bei der Beantwortung der Fragen 14 bis 18 ist bereits eingegangen worden. Beim Erklären einiger Vorzüge, die das Internet bieten kann, haben wir uns wesentlich auf die Argumente gestützt, die in dem Text von James L. Eng genannt wurden ('Internet als soziales Netz'), haben aber auch die Forderungen und Ansichten von Stefan Schneider ('Computerkenntnisse als Schlüsselqualifikation muß auch Obdachlosen zugute kommen') und Jan Teszcla ('Internet als Voraussetzung zur Befriedigung des Informationsbedürfnisses') vorgestellt. Zudem haben wir auch die Möglichkeit einer Vernetzung von Obdachlosenzeitungen angesprochen, einem Bereich der, durch den Umgang der Befragten mit Obdachlosenzeitungen, ihrem Erfahrungsschatz vielleicht am nächsten kommt. Vier der Befragten waren der Ansicht, daß ein Internetzugang keine positiven Auswirkungen auf ihr Leben haben würde; einer war sich diesbezüglich nicht ganz sicher (er antwortete mit "jein"), und einer war der Meinung, daß ein Internetzugang sich schon positiv auf sein Leben auswirken könnte. Drei der Befragten ließen diese Frage unbeantwortet. Die Beantwortung dieser Frage macht deutlich, daß die Obdachlosen, mit denen wir sprachen, bei der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zunächst nicht an einen Internetzugang denken. Abgesehen von der Frage, ob ein solcher Zugang ihre Lebenssituation verbessern könnte, äußerte auch keiner der Befragten den Wunsch, sich mit dem Internet vertraut machen zu wollen. Die Frage 15 wurde gemäß dem Ergebnis der Beantwortung der Frage 14 nicht ausgefüllt. Auch nicht von dem Befragten, der der Meinung war, ein Internetzugang könnte sich positiv auf sein Leben auswirken. Derjenige, der sich nicht sicher war, ließ die Frage ebenfalls unbeantwortet. Dies könnte vielleicht auch ein Indiz dafür sein, daß man sich doch nicht so richtig vorstellen kann, inwiefern sich das Internet auf die eigene Lebenssituation positiv auswirken könnte.
Die Frage 16 wurde von drei Befragten positiv beantwortet; zwei Personen waren sich auch hier nicht sicher (eine Antwort war "jein" und eine war "vielleicht"), und vier der Befragten beantworteten die Frage nicht. Das Ergebnis könnte dahingehend interpretiert werden, daß man sich schon positive Aspekte vorstellen kann, sich aber, gemessen an der eigenen Lebenssituation, keine Vorteile von einem Internetzugang verspricht. Die Frage 17 blieb auch hier im wesentlichen unbeantwortet. Einer der Befragten, der sich bei den vorangegangenen Fragen nicht sicher war, forderte, daß der Senat in Berlin, bzw. die Bezirksämter der Stadt, mehr für die Obdachlosen tun müßten. Ein anderer, der die Frage 16 positiv beantwortet hatte, konnte sich vorstellen, daß die Informationslage allgemein besser sein würde, und auch ein "indirekter Sprachaustausch" von Vorteil wäre. Er nahm damit Bezug Rauf das Argument der vorurteilsfreien Kommunikation, das im Text von James L. Eng angeführt wird.
Die Beantwortung der Fragen 14 und 16 machen im Prinzip deutlich, daß sich die von uns befragten Personen nicht vorstellen können, daß die Möglichkeit einer Internetnutzung für ihre Lebenssituation hilfreich sein könnte. Trotzdem sprachen sich die meisten der Befragten bei der Frage 18 für möglichst viele Internetanschlüsse aus. Zwei der Befragten sprachen sich für Internetanschlüsse in öffentlichen Bibliotheken aus und einer für die Möglichkeit, daß in Redaktionen von Obdachlosenzeitungen solche Anschlüsse bereitgestellt werden sollten. Vier der Befragten kreuzten alle vorgegebenen Möglichkeiten an. Lediglich zwei Personen ließen die Frage 18 unbeantwortet. Aus der Beantwortung der Frage 18 läßt sich erkennen, daß die Möglichkeiten, die das Internet bietet durchaus positiv gesehen werden, gemessen an der eigenen Lebenssituation spielt das Internet für die Befragten jedoch keine Rolle. Dies wurde vor allem in den Gesprächen sehr deutlich. Öffentliche Internetanschlüsse wurden durchweg als hilfreich für die Allgemeinheit gesehen. Nach der Einschätzung der Befragten, seien solche Anschlüsse nicht mal mittelfristig realisierbar. Auch wurde deutlich, daß die Befragten beim Internet zunächst nicht an die eigene Informationsbeschaffung dachten, sondern hauptsächlich an eine Vernetzung von Obdachlosenzeitungen. Dies liegt vor allem daran, daß die von den Befragten benutzten Informationsquellen als völlig ausreichend angesehen werden. Daß das Internet, nach der Meinung der Befragten, in erster Linie den Obdachlosenzeitungen hilfreich sein könnte, liegt wahrscheinlich daran, daß die Befragten der Auffassung sind, daß die Obdachlosenzeitungen ihnen noch am ehesten in ihrer Lebenssituation helfen können.
Wie bereits angedeutet, war das Gespräch, das sich im Zusammenhang mit dem Ausfüllen der Fragebögen entwickelte sehr aufschlußreich für die Auswertung derselben. Diese mündlichen Ergänzungen haben wir aus technischen Gründen nicht mitschneiden können. Es wurde aufgrund der Spontanität viel durcheinander geredet, und das Mikrofon, das uns zur Verfügung stand, konnte nicht den ganzen Raum erfassen.
4. Zur Auswertung der Interviews
Beide Interviews fanden in einer sehr lockeren Gesprächsatmosphäre statt. Dies gilt besonders für das Interview mit den beiden Redakteuren der Obdachlosenzeitung Strassenfeger, Ariane Sandmann[5] und Karsten Krampitz. Sehr positiv war auch der Umstand, daß bei unserem Interview mit Herrn Otto Schickling in der Notunterkunft des motz e.V. mehrere obdachlose Verkäufer der motz & Co anwesend waren, die sich alle auch an dem Gespräch beteiligten. In Otto Schickling hatten wir, hinsichtlich der allgemeinen Problematik der Obdachlosigkeit, einen sehr kompetenten Gesprächspartner. Wie bereits erwähnt, ergab es sich, daß in beiden Gesprächen mehr über die Arbeit bzw. die Zielsetzung der jeweiligen Obdachlosenzeitung sowie laufender und geplanter Projekte gesprochen wurde, als über die Frage der Internetnutzung. Dies hing ganz offensichtlich mit der persönlichen Erfahrung unserer Gesprächspartner hinsichtlich der Internetthematik zusammen. In ihrem sozialen Engagement einerseits (gemeint sind hier vor allem die beiden Redakteure des Strassenfeger ) und der persönlichen Betroffenheit mit der Obdachlosigkeit andererseits (gemeint ist hier vor allem Otto Schickling und die ebenfalls am Gespräch beteiligten Obdachlosen), war die Frage nach der Internetnutzung kein zwingendes Thema. Dies machten die Gespräche deutlich. Im folgenden werden die Interviews hinsichtlich der Frage der Internetnutzung ausgewertet. Auch hier muß erwähnt werden, daß wir probiert haben, positive Aspekte des Internets bzw. Möglichkeiten, die das Internet bietet, aufzuzeigen und diese im Rahmen der Frage nach ihrer Bedeutung für Obdachlose, zu diskutieren.
Im Interview mit Otto Schickling haben wir uns über die Frage der möglichen Zusammenarbeit der motz & Co mit anderen Obdachlosenzeitungen, der eigentlichen Frage nach dem Internet und seiner Bedeutung für Obdachlose, angenähert. Als wir das erste Mal konkret auf das Internet zu sprechen kamen, fiel die Antwort von Herrn Schickling sehr deutlich aus:
"Ich gebe da eine Antwort, und das muß genügen: Ein Obdachloser hat andere Sorgen als Internet."[6]
Diese klare Antwort bestätigte unseren Eindruck, den wir bereits in einem Vorgespräch (am 16. Juli) zu dem eigentlichen Interview bekommen hatten. Aus seinen Äußerungen wurde eine Abneigung gegen bzw. auch ein gewisser Ärger über die Fragestellung deutlich. Mit unserer Fragestellung stießen wir auf breites Unverständnis. Indem wir im folgenden Erklärungen zum Internet gegeben haben und auch versucht haben, diesbezüglich positive Aspekte für die Thematik der Obdachlosigkeit aufzuzeigen, gab uns Herr Schickling jedoch noch ein paar Einschätzungen. Dies stellte sich teilweise als etwas mühsam heraus, da Herrn Schickling jede Erfahrung im Umgang mit dem Internet fehlte. Dies zeigt auch, das er, in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender, in der Zeit, als die motz & Co sich im Internet präsentierte, dies nicht genutzt hat, um sich mit der neuen Kommunikations- Präsentationsmöglichkeit vertraut zu machen. Es ist wohl davon auszugehen, daß die Arbeit des Vorstandsvorsitzenden dies auch gar nicht zuließ bzw. das Internet hier als wenig hilfreich angesehen wird. Vielleicht war aber auch die Möglichkeit für ihn gar nicht gegeben.
Für uns entstand der Eindruck, das die Internetnutzung der motz & Co als ein Versuch, sich neu und anders zu präsentieren, zu sehen ist. Momentan, so Herr Schickling, ist die motz & Co nicht mehr im Internet präsent. Dies hängt damit zusammen, daß Stefan Schneider, ein ehemaliger Mitarbeiter und vor allem Mitbegründer der motz & Co, nicht mehr bei der Obdachlosenzeitung arbeitet. Er hatte, so unsere Information, während seiner Arbeit bei motz & Co entsprechende Kontakte aufgebaut, um die technischen Voraussetzungen für einen Internetzugang zu schaffen.[7] Über das Internet-Projekt wurde, nach Aussage von Otto Schickling, auch im Vorstand gesprochen. Hierüber wollte sich Otto Schickling, mit Rücksicht auf die Tatsache, daß Stefan Schneider nicht mehr für die motz & Co arbeitet, jedoch nicht weiter äußern. Mit Hilfe des Fragebogens, den wir an die Redaktion der motz & Co geschickt haben, hatten wir uns erhofft, hierzu mehr zu erfahren. Leider hat sich die Redaktion diesbezüglich wenig kooperativ gezeigt.
Im Bereich einer Zusammenarbeit oder lediglich des Informationsaustausches mit anderen Obdachlosenzeitungen konnte sich Herr Schickling einen positiven Einfluß des Internet vorstellen. Es wurde jedoch deutlich, daß er die Vorteile bzw. die Nutzungsmöglichkeiten mehr auf der redaktionellen Seite, als auf der Seite der Obdachlosen sah, somit ein Nutzen für die Obdachlosen höchstens indirekt, also durch die Arbeit der Zeitung, entstehen könnte. Angesprochen auf die Möglichkeit, daß sich Obdachlose zum Beispiel mit einem Internetanschluß in öffentlichen Einrichtungen, Wärmestuben oder Notunterkünften schneller Informationen beschaffen könnten, machte Herr Schickling deutlich, daß sich die Kommunikation der Obdachlosen untereinander als die wichtigste und effektivste Informationsquelle darstellt. Dies hat sich auch bei der Auswertung der Fragebögen gezeigt. Herr Schickling bekräftigte dies mit der Aussage:
"Der größte Teil (der Obdachlosen d.A.) weiß gar nicht, was Internet ist!"[8]
In der rückschauenden Beurteilung der motz & Co -Präsenz im Internet, zeigte sich Herr Schickling zwar etwas verhalten, ließ jedoch erkennen, daß seiner Meinung nach dies den Obdachlosen wenig gebracht habe, und auch der Bekanntheitsgrad der motz & Co dadurch nicht gestiegen sei. Er war im Gegenteil eher der Ansicht, daß die motz & Co nur durch den Straßenverkauf ihre Auflage steigern kann und sich auch ausschließlich darauf konzentrieren sollte. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch die Idee, mit Hilfe von Informationsständen das Anliegen der motz & Co und des motz e.V. mehr Leuten nahezubringen. Ein weiterer Punkt, der zur Sprache kam, war, daß die Obdachlosen mit denen wir gesprochen haben, der Ansicht waren, daß das Internet, und die Möglichkeiten, die es bietet, im Grunde nicht die Randgruppen der Gesellschaft anspricht, sondern eher diejenigen, die einem geregelten Berufsleben nachgehen, eventuell sogar durch ihren Beruf mit dem Internet zu tun haben. Die Obdachlosen, mit denen wir gesprochen haben, fühlten sich allesamt nicht vom Internet angesprochen und konnten sich auch nicht vorstellen, daß ein Internetzugang für sie hilfreich wäre. Diesbezüglich bestätigte das Gespräch nochmal die Ergebnisse des Fragebogens. Ein Gesprächsteilnehmer machte dies nochmal ganz deutlich:
"Ich sehe da keinen Sinn drin. Ich habe andere Probleme vor Augen, als mich ausgerechnet im Internet zu informieren. (...) Die Problematik des einzelnen ist viel zu groß, um sich damit direkt zu beschäftigen."[9]
Einen Bedarf oder ein Interesse am Internet, so unsere Gesprächspartner, könnten sie sich frühestens dann vorstellen, wenn die allgemeine Problematik der Obdachlosigkeit gelöst oder annähernd gelöst sei.
Im Interview mit den beiden Redakteuren des Strassenfeger waren wir, ebenso wie im Interview mit Herrn Otto Schickling, mit der Situation konfrontiert, daß eine persönliche Erfahrung im Umgang mit dem Internet nicht vorhanden war. Hinzu kommt die Tatsache, daß der Strassenfeger nicht im Internet vertreten ist und dies, nach Meinung der beiden Redakteure, Ariane Sandmann und Karsten Krampitz, auch nicht geplant ist. Sozusagen als Aufhänger für unsere Frage nach der Internetnutzung für Obdachlose - bzw. die Bedeutung des Internet für die Problematik der Obdachlosigkeit - haben wir die Präsenz der motz & Co im Internet angeführt und gefragt, wie sie ein solches Projekt einschätzen würden. Auch hier erhielten wir eine sehr resolute Antwort:
"Quatsch! (...) Das ist einfach Müll! Das ist totaler Quatsch!"[10]
Das Internet wurde speziell von Ariane Sandmann als überregionales bzw. weltweit nutzbares Kommunikationsmittel gesehen, was in dieser Eigenschaft dem lokalen Charakter der Obdachlosenzeitungen nicht dienlich sein kann. Die Obdachlosenzeitungen, so ihre Argumentation, berichtet ausschließlich lokal, um so die Betroffenheit der Leser anzusprechen. Diese Informationen, und eventuell auch ihre Brisanz, würden in der großen Welt des Internet keinen Adressaten finden. Dabei blieb die regionale Nutzungsmöglichkeit vorerst unbeachtet, auf die wir im Verlaufe des Gesprächs dann allerdings noch eingegangen sind.
Wir haben zunächst das Argument von Stefan Schneider angeführt, daß die zunehmende Computerisierung der Gesellschaft nicht an den ohnehin schon benachteiligten Randgruppen der Gesellschaft vorbeigehen darf; daß diese Randgruppen sozusagen neue Kommunikationschancen nicht nutzen können, und auf diese Weise ein Computeranalphabetismus entstehen, und sich bereits existierende soziale Gegensätze noch weiter verschärfen könnten. Ariane Sandmann mochte diesem Argument nicht zustimmen, sie sah vor allen nicht die so beschriebene Bedeutung des Internet. Vielmehr stellte sie den zwischenmenschlichen Kontakt, besonders im sozialen Bereich, in den Vordergrund. Diese Sichtweise entspricht auch den Aussagen der Obdachlosen, mit denen wir sprachen - und im übrigen auch der Sichtweise von Otto Schickling -, die ihren Kontakten untereinander eine große Bedeutung zumaßen; und dies nicht nur im Sinne von Informationsbeschaffung.
"Und ich glaube auch, daß das eigentlich Wichtige, nämlich der Kontakt zwischen den Menschen, damit (mit dem Internet d.A.) noch viel weiter unterbunden wird. Ich will mich nicht mit einer Maschine unterhalten müssen! Ich will rausgehen können und von einem Menschen eine Zeitung kaufen, die von Menschen gemacht ist. Und wenn ich den wiedertreffe, dann kann ich dem Menschen sagen, daß habe ich gut gefunden oder nicht. Und dieser Mensch wird es weitertragen an die anderen Menschen im Vertrieb. Wenn ich Qdas über das Internet mache, dann habe ich weder Kontakt zu demjenigen, der es geschrieben hat, noch zu demjenigen, der es verkauft hat. Es gibt überhaupt keine Kommunikation zwischen zwei Menschen mehr, es gibt nur noch Kommunikation zwischen zwei PCs!"[11]
Diese Aussage ist nur insoweit zu korrigieren, als daß ein PC lediglich als Kommunikationsmittel für Menschen fungiert. Der Mensch bleibt weiterhin in der Lage, seine ZKommunikation zu steuern, allerdings fällt der direkte Kontakt zum Kommunikationspartner, gerade in sozialer Hinsicht ein außerordentlich wichtiger Aspekt, weg. Genau dies ist es, was Ariane Sandmann kritisiert:
"(Eine Zeitung über das Internet zu verbreiten), und gerade eine Obdachlosenzeitung, (sollte man nicht anstreben), weil die Berührung zwischen solchen Randgruppen, wie den Obdachlosen, und der etablierten Gesellschaft, die die Zeitung ja (...) nun kauft, (dann nicht mehr da ist). Das heißt, es ist viel leichter, immer noch solche Probleme zu vergessen; ich kann sie einfach verdrängen, sie werden sterilisiert! (...) Wenn ich in das Internet gehe, dann kann ich auch ganz leicht vergessen, was Obdachlosigkeit eigentlich ist; dann kann ich mir so diesen romantischen Traum träumen, der überhaupt nicht da ist."[12]
Ein weiteres Argument der beiden Redakteure des Strassenfeger war, daß die Präsenz Zeiner Obdachlosenzeitung im Internet eigentlich geschäftsschädigende Auswirkungen hat, da dann der Straßenverkauf der Zeitung nicht mehr die einzige Vertriebsmöglichkeit ist. Durch die Möglichkeit, die Ausgaben einer Obdachlosenzeitung im Internet lesen zu können, gehen der Obdachlosenzeitung die Einnahmen aus dem Straßenverkauf verloren. Angesprochen auf den Vergleich mit den U.S.A. war Ariane Sandmann der Ansicht, daß man die Situation in den Vereinigten Staaten nicht mit der Situation in der Bundesrepublik vergleichen kann. Das Internet, so die Argumentation, habe in den U.S.A. einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Diese andere Dimension des Internet in den Vereingten Staaten, so hatten wir den Eindruck, sah sie ebenfalls kritisch. Ariane Sandmann sprach von einer kontaktarmen Welt, in der das Internet diese Tendenz nur noch fördern würde. Dieses Argument, ist vor dem Hintergrund des sozialen Umgangs mit gesellschaftlichen Randgruppen zu sehen. In einem größeren Diskussionsrahmen über die Nutzungsmöglichkeiten des Internet wären an dieser Stelle sicherlich einige Gegenargument anzuführen.
Dem Internet zur schnelleren Informationsbeschaffung, zum Beispiel in Wärmestuben und Notunterkünften, wurde von beiden Redakteuren keine Bedeutung beigemessen:
"Der Obdachlose muß diese Information (freie Notunterkunftsplätze, Essensausgaben, Umedizinische Versorgung, etc. d.A.) nur haben, wenn er sie braucht, in diesem einen Moment. Und er braucht die (Informationen) nur für das Gebiet, in dem er sich auch aufhält. Und das kann ich sehr wohl viel leichter über einen Zettel mitteilen, als über so Seinen PC, weil in dem Moment, wo ich aus der Wärmestube rausgehe, habe ich den PC schon nicht mehr; meinen Zettel, wo die (Informationen) aber alle draufstehen, den habe ich immer noch."[13]
Eine Bettenbörse, so Karsten Krampitz, läßt sich immer noch am besten nach dem herkömmlichen Schema betreiben. Dem Argument, daß das Internet eventuell mehr Interesse an der Problematik der Obdachlosigkeit wecken könnte, weil es mehr Leute anspricht, wurde widersprochen. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Internetbenutzer aufgrund der Tatsache, daß er eine Obdachlosenzeitung durch das Internet kennengelernt hat, diese beim nächsten Mal dann auch kauft, schätzten beide Redakteure als äußerst gering ein. Das eigene Erleben der Problematik, indem man beispielsweise eine Obdachlosenzeitung kauft und eventuell mit dem Verkäufer ins Gespräch kommt, kann durch das Internet nicht ersetzt werden. Vor allem ist diese Art von Kontakt für die Betroffenen sehr wichtig. Den einzigen Nutzen des Internet sahen die beiden Redakteure des Strassenfeger in der Möglichkeit, über das Internet für ihre Sache zu werben, nicht aber konkrete Inhalte der Obdachlosenzeitung in das Internet einzuspeisen. In diesem Zusammenhang konnten sie auch einer Vernetzung mit anderen Obdachlosenzeitungen einen positiven Aspekt abgewinnen, um beispielsweise ein gemeinsames Anliegen einer breiten Masse vorzustellen (z.B. Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung).
"(Wenn es auf Bundesebene Einschnitte geben wird), (...) dann kann so eine Vernetzung sehr positiv sein, um auch mal nach Bonn zu gehen (...). Das ist der einzige Grund, warum ich sage, eine Vernetzung kann positiv sein; aber nur auf der Ebene und nur (bezogen) auf sehr globale Themen. Für das einzelne Projekt (gemeint ist hier auch die einzelne Obdachlosenzeitung d.A.) wird es nicht viel ändern."[14]
Für die redaktionelle Zusammenarbeit sahen beide Redakteure des Strassenfeger keine Notwendigkeit einer Internetnutzung. Hier wurde aber auch deutlich, daß die redaktionelle Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Obdachlosenzeitungen nicht das Interesse der Redaktion des Strassenfeger hat - ein Eindruck, der uns auch im Interview mit Herrn Schickling vermittelt wurde. Hinsichtlich eines Erfahrungsaustauschs mit anderen Obdachlosenzeitungen (als Beispiel wurde Trott-War/Prisant aus Stuttgart genannt) bestehen bereits Kontakte in der Form, daß Redakteure bzw. Mitarbeiter der jeweiligen Zeitungen aeinander besuchen. Dieser Erfahrungsaustausch läuft nach Meinung der beiden Redakteure des Strassenfeger gut; durch das Internet würden sie sich in dieser Beziehung keine Verbesserungen erhoffen. Das Argument der vorurteilsfreien Kommunikation ('Internet als soziales Netz'), das in dem Text von James L. Eng thematisiert wurde bewertete Ariane Sandmann als interessanten persönlichen Aspekt für denjenigen, der das Internet nutzt.
5. Fazit
In den geführten Interviews und durch die Auswertung der Fragebögen wurde deutlich, daß das Internet zwar ein Begriff ist, seine Nutzungsmöglichkeiten für die redaktionelle Arbeit bei den Obdachlosenzeitungen einerseits, und für die Obdachlosen andererseits, keine Rolle spielt. Was aus dem Gespräch, das wir in der Notunterkunft mit Herrn Schickling und anderen Obdachlosen geführt haben, nicht hervorgeht, ist der Umstand, daß uns in unserem Vorgespräch zu diesem Interview hinsichtlich unserer Frage nach dem Internet und seiner Bedeutung für die Problematik der Obdachlosigkeit, zunächst viel Unverständnis und teilweise sogar Antipathie entgegenschlug. Diese Tatsache sagt schon einiges darüber aus, wie die Betroffenen über den Nutzen eines Internetzugangs für ihre Lebenssituation denken. Diese starke Ablehnung kann auch mit dem Ausscheiden des ehemaligen Mitarbeiters der motz & Co, Stefan Schneider, zusammenhängen. Bemerkungen, die im Verlaufe des Vorgesprächs aber auch im Interview selbst geäußert wurden, legen diesen Verdacht nahe. Allerdings konnten und wollten wir zu diesem Punkt nicht weiter nachfragen. Die Einschätzung der Bedeutung eines Internetzugangs für Obdachlose faßte Karsten Krampitz, Redakteur beim Strassenfeger , mit folgenden Worten zusammen:
"Auf einer Datenbank kann man nicht pennen!"[15]
Diese Aussage trifft genau den Kern der Frage nach der Bedeutung der Internetnutzung für Obdachlose, und gibt sehr treffend die Stimmung wieder, die diesbezüglich auch in den geführten Gesprächen zu spüren war.
Das Anliegen von Stefan Schneider, den Obdachlosen durch die Obdachlosenzeitung motz & Co einen Internetzugang zu ermöglichen, scheint nicht umgesetzt worden zu sein. Wir drücken uns hier bewußt vorsichtig aus, da uns diesbezüglich keine Stellungnahmen seitens der Redaktion der motz & Co vorliegen. Stefan Schneider schreibt in seinem Artikel[16], daß die "Zielsetzung der internationalen Computervernetzung von motz & Co einigermaßen klar"[17] sei. Diesen Eindruck bekamen wir nicht vermittelt. Beispielsweise sind gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen mit anderen Obdachlosenzeitungen weder für den Vorstandsvorsitzenden des motz e.V., noch für die beiden Redakteure des Strassenfeger ein Thema - von einer internationalen Zusammenarbeit ganz zu schweigen. Für uns ergab sich vielmehr der Eindruck, daß hier Perspektiven entworfen wurden, die mit der täglichen Arbeit der Obdachlosenzeitungen, aber auch deren Zielsetzung (wie dies beim Strassenfeger , aber auch im Gespräch mit Herrn Schickling, deutlich wurde), wenig zu tun haben. Als Ergebnis unseres Fragebogens bleibt jedoch festzuhalten, daß die befragten Obdachlosen allesamt angaben, keinen Internetzugang zu haben. Ebenso deutlich wurde, daß sie sich von einem solchen Internetzugang auch nichts versprechen.
Eine vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel beim Emnid-Institut in Auftrag gegebene Studie[18] kommt zu dem Ergebnis, daß knapp über die Hälfte (54%) der Befragten[19] nicht weiß, was das Internet eigentlich ist. Die Studie kommt ferner zu dem Ergebnis, daß 92% der Befragten das Internet nicht nutzt. Es ist anzunehmen, daß diese Studie versucht hat, einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft zu erfassen (sowohl bezogen auf das Alter, als auch auf den Beruf), und daher wahrscheinlich Randgruppen der Gesellschaft, wie beispielsweise Obdachlose, nicht befragt wurden. Daher ist davon auszugehen, daß bestimmte Kernfragen der Studie ("Wissen Sie, was das Internet ist?" oder "Nutzen Sie das Internet?") gerade von Obdachlosen noch extremer negativ beantwortet worden wären. Ein weiteres Ergebnis der Studie war, daß mit Abstand die meisten Internetzugänge an Universitäten vorhanden sind (59%), gefolgt von Arbeitgebern, die diese direkt anbieten (23%). Zudem sagt die Studie aus, daß hauptsächlich Studenten (48,2%) und Angestellte (32,6%) das Internet benutzen; die Kategorie "Sonstige", unter der man eventuell die Obdachlosen sehen könnte, Zwaren mit 1% angegeben. Am meisten genutzt wird das Internet von Personen mit Abitur bzw. einer akademischen Ausbildung (16%); Personen mit einem Hauptschulabschluß, die das Internet benutzen werden mit 4% angegeben. [20]
Die Auswertung unserer Fragebögen und die Gesprächseindrücke bestätigen die Ergebnisse der Emnid-Umfrage. Dies soll nicht heißen, daß es uns darum ging, die Ergebnisse der Studie anhand einer Gruppe von Obdachlosen zu überprüfen - dafür war allein schon die Gruppe der Befragten, die uns zur Verfügung stand, viel zu klein - , die Ergebnisse der Studie hatten wir jedoch sozusagen als Hintergrundwissen mitgebracht, bevor wir anfingen unserer Fragestellung nachzugehen. Diese Fakten besagen nun nicht, daß man in Form eines Projekts Obdachosen einen Internetzugang nicht ermöglichen sollte, um zu sehen, ob diese neue Kommunikations- und Informationstechnik nicht einen positiven Einfluß auf die Lebenssituation der Obdachlosen haben kann. In diesem Zusammenhang scheinen andere Projekte jedoch dringlicher zu sein, wie uns sowohl von obdachlosen Verkäufern der motz & Co, als auch vom Vorstandsvorsitzenden des motz e.V. bestätigt wurde. Dem schloß sich auch die redaktionelle Seite des Strassenfeger an. Ungeklärt blieb auch der Punkt der Finanzierung eines Internetzugangs durch die motz & Co und daran geknüpft die Frage, ob die anfallenden Gelder für ein solches Projekt nicht sinnvoller ausgegeben werden sollten. In diesem Zusammenhang wäre ein Gespräch mit der Redaktion der motz & Co, zumindest aber die Beantwortung unseres Fragebogens, interessant gewesen.
Es stellte sich heraus, daß der Umgang mit dem Computer als "Schlüsselqualifikation der heutigen Zeit"[21] - so beschrieben von Stefan Schneider - für die von uns befragten Obdachlosen kein Thema ist. Das Internet zur schnelleren Informationsbeschaffung, vielleicht sogar zur Wohnungsvermittlung oder für Stellenanzeigen, wurde ebenfalls als nicht notwendig bzw. als nicht praktikabel angesehen. Hier zeigte sich ganz deutlich, daß die Kommunikation und vor allem die Informationsbeschaffung bei Obdachlosen anders abläuft. Es bleibt also die Frage, was ein Internetanschluß den Obdachlosen bringen könnte. Für uns stellte sich heraus, daß die von uns Befragten die Möglichkeiten und Vorzüge des Internet gar nicht nutzen wollen, weil ihr Alltag von anderen Sorgen und Problemen bestimmt ist. Den im Text von James L. Eng beschriebenen positiven Aspekten konnten die Befragten zwar schon zustimmen, sie konnten dies aber auf ihre eigene Situation (dies gilt für die Obdachlosen) bzw. die Situation in Deutschland oder speziell in Berlin (dies gilt für die beiden Redakteure des Strassenfeger) nicht übertragen. Vielleicht sind diesbezüglich die Vereinigten Staaten den Entwicklungen in Deutschland wieder einmal ein Stück voraus; vielleicht waren die angeführten Beispiele in dem Text von James L. Eng aber auch seltene Ausnahmeerscheinungen. Hier wäre es bestimmt interessant, unserer Fragestellung mit Blick auf die U.S.-amerikanische Perspektive noch intensiver nachzugehen. Gerade der soziale Aspekt von zwischenmenschlichen Kontakten stellte sich für die von uns Befragten als sehr wichtig heraus. Ob diese Kontakte über das Internet zu bekommen sind, ist doch eher fraglich. In diesem Zusammenhang äußerte sich Neil Postman, Kulturkritiker und Professor für Medienökologie an der New York University (und Amerikaner!):
"Ich glaube (...) nicht, daß verschlüsselte Unterhaltungen, wie zum Beispiel im Internet, ein Ersatz für echte, uncodierte Gespräche sind. Ich glaube nicht, daß im Internet ein 'Gemeinschaftsleben' möglich ist."[22]
Gerade die soziale Einbindung der Obdachlosen in die Gesellschaft, ihnen ein 'Gemeinschaftsleben' zu ermöglichen, ist besonders wichtig. Dies mit Hilfe des Internet erreichen zu können, scheint jedoch eher fraglich zu sein. Eine Vernetzung verschiedener Obdachlosenzeitungen (lokal, national oder sogar international) nach der Idee des PrenzlNet[23] in Berlin scheint, so hatten wir den Eindruck, von den Betroffenen (den Obdachlosen) einerseits, und den Akteuren (die befragten Redakteure des Strassenfeger) andererseits, als nicht für besonders notwendig - hinsichtlich ihres Anliegens, nämlich den Obdachlosen zu helfen und für sie ein Sprachrohr zu sein - empfunden zu werden.
Anhang:
Fragebogen zur Internetnutzung durch Obdach- bzw. Wohnungslose
1.) Sind Sie obdachlos, bzw. wohnungslos
(Ja
(Nein
2.) Wie lange sind Sie bereits obdach-, bzw. wohnungslos?
Antwort:_____________
3.) Welche schulischen, bzw. beruflichen Qualifikation haben Sie erworben?
(Hauptschulabschluß
(Mittlere Reife
(Abitur
(Abgeschlossene Berufsausbildung
(Abgeschlossenes Hochschulstudium
(Andere Qualifikationen: _________________
(Keine Qualifikationen
4.) Wie würden Sie die Zusammensetzung Ihrer Einkommensquellen beschreiben?
(Vorwiegend staatliche Unterstützung
(Vorwiegend durch Betteln
(Vorwiegend durch den Verkauf von Obdachlosenzeitungen
(Keines der obengenannten
5.) Sind Sie mit der staatlichen Unterstützung, bzw. mit den staatlichen Hilfseinrichtungen zufrieden?
(Ja
(Nein
6.) Besteht ein Informationsmangel, der durch Ihre Obdachlosigkeit bedingt ist?
(Ja
(Nein
7.) Wie beziehen Sie Ihre Informationen?
(Zeitung/Zeitschriften
(Radio/Fernsehen
(Internet
(Kommunikation (Gespräche mit Freunden und Bekannten)
8.) Besteht Ihrer Meinung nach ein Mangel an Sozialisation, der sich durch Ihre Obdachlosigkeit ergeben hat?
(Ja
(Nein
9.) Wissen Sie was das Internet ist?
(Ja
(Nein
10.) Haben Sie Zugang zum Internet?
(Ja
(Nein
11.) Wenn ja: Wie nutzen Sie das Internet in erster Linie?
(Online-Chats
(Informationsbezug
(Spiele
(Versenden von E-mails
(Surfen im Internet, dem Lustprinzip folgend
12.) Wie oft nutzen Sie das Internet durchschnittlich?
(Täglich
(Einmal pro Woche
(Einmal im Monat
(Unregelmäßig
13.) Wie lange dauert Ihre durchschnittliche Internetsitzung
Antwort: _________
14.) Denken Sie, daß sich Ihre Lebensbedingungen durch einen Zugang zum Internet entscheidend zum Positiven verändert haben?
(Ja
(Nein
15.) Wenn ja, warum?
Antwort: ____________________________________________________________
16.) Denken Sie, daß ein Internetanschluß zwar hilfreich wäre, sich aber Ihre Lebenssituation dadurch nicht entscheidend verändern würde?
(Ja
(Nein
17.) Wenn ja, warum?
Antwort: ________________________________________________________________
18.) Wo würden Sie Sich überall Internetzugänge wünschen?
(In allen Notunterkünften
(In allen Wärmestuben
(In den Redaktionen der verschiedenen Obdachlosenzeitungen
(In öffentlichen Bibliotheken (z.B. Stadtteilbibliotheken, etc.)
Anhang:
Fragebogen an die Redaktion der Obdachlosenzeitung motz &Co
1.) Gibt es die motz & Co noch im Internet?
Ja
Nein
2.) Wenn ja, seit wann gibt es die motz & Co im Internet?
____________________
3.) Welche Überlegungen haben dazu geführt, die Obdachlosenzeitung auch elektronisch verfügbar zu machen?
__________________________________________________
__________________________________________________
4.) Was wird von der Redaktion im Internet angeboten?
Alle Ausgaben der motz & Co
Auszüge aller Ausgaben der motz & Co
Die jeweils komplette aktuelle Ausgabe
Auszüge der aktuellen Ausgabe
Ein Diskussionsforum, das Raum für Kritik und Vorschläge bietet (Homepage)
Eine Art Informationskalender, der gleich einem "Schwarzen Brett" Tips und Ratschläge (Öffnungszeiten von Wärmestuben, verfügbare Übernachtungsmöglichkeiten, etc.) bietet
Sonstiges:
__________________________________________________
5.) Kommunizieren Sie per Cyberspace (Internet, Online-Chats, e-mail, etc.) mit anderen (Obdachlosenzeitungen im In- und Ausland?
Ja
Nein
6.) Sind eventuell überregionale oder sogar internationale Vernetzungen geplant?
Ja
Nein
7.) Welche technischen Mittel (Hardware, Software, etc.) stehen Ihnen in der Redaktion zur Nutzung des Internet zur Verfügung?
__________________________________________________
8.) Wer trägt die Gebühren und die laufenden Kosten für die Internetnutzung?
__________________________________________________
9.) Wie wurde die Anschaffung der Hardware finanziert?
__________________________________________________
10.) Sind Sie der Meinung, daß das Internet zum redaktionellen Arbeiten gehört?
Ja
Nein
11.) Wenn ja, warum?
__________________________________________________
12.) Denken Sie, daß durch die Präsenz der motz & Co im Internet die Öffentlichkeitswirksamkeit Ihrer Zeitung gestiegen ist?
Ja
Nein
13.) Wenn ja, warum?
__________________________________________________
14.) Wie schätzen Sie die Auswirkungen ein, die die Möglichkeit einer Internetnutzung durch Obdachlose mit sich bringt?
_________________________________________________
15.) Welche Verbesserungen könnte die Internetnutzung durch Obdachlose für deren Lebenssituation mit sich bringen?
__________________________________________________ __________________________________________________
16.) Beschreiben Sie die Internetnutzung in Ihrer Redaktion?
__________________________________________________
17.) Besteht auch für die Verkäufer der motz & Co die Möglichkeit, das Internet in Ihren Redaktionsräumen zu nutzen?
Ja
Nein
18.) Wenn ja, beschreiben Sie kurz das Nutzungsverhalten?
__________________________________________________
__________________________________________________
19.) In welchem Umfang sollten Ihrer Meinung nach Internetzugänge für Obdachlose geschaffen werden?
__________________________________________________
_________________________________________________
20.) Wie stellen Sie sich die Finanzierung eines solchen Projekts vor?
__________________________________________________
21.) Gibt es eine Resonanz auf Ihre Aktivitäten im Internet (e-mail-Zuschriften,etc.)?
Ja
Nein
22.) Wenn ja, in welchem Umfang und in welcher Form?
___________________________________________________
Anmerkungen
[1] Stefan Schneider, motz & Co - Jetzt weltweit im Internet. (http://userpage.fu-berlin.de/-zosch). Auch in: wohnungslos. Aktuelles aus Theorie und Praxis zur Armut und Wohnungslosigkeit. 37. Jahrgang, 3/95, Bielefeld 1995.
[3] zitiert nach: James L. Eng, Im Internet fühlen sich Seattles 'Homeless People' nicht diskriminiert. In: (http://userpage.fu-berlin.de/-zosch).
[5] Ariane Sandmann ist ein von der Redakteurin selbst gewähltes Pseudonym.
[6] O-Ton von Otto Schickling, Vorstandsvorsitzender des motz e.V., im Interview am 20.07.1996.
[7] vgl. hierzu: Stefan Schneider, motz & Co - Jetzt weltweit im Internet. (http://userpage.fu-berlin.de/-zosch). Auch in: wohnungslos. Aktuelles aus Theorie und Praxis zur Armut und Wohnungslosigkeit. 37. Jahrgang, 3/95, Bielefeld 1995.
[8] O-Ton von Otto Schickling, Vorstandsvorsitzender des motz e.V., im Interview am 20.07.1996.
[9] O-Ton eines am Gespräch beteiligten Obdachlosen.
[10] O-Ton von Karsten Krampitz und Ariane Sandmann, Redakteure des Strassenfeger, im Interview am (22.07.1996.
[11] O-Ton von Ariane Sandmann, Redakteurin des Strassenfeger, im Interview am 22.07.1996.
[15] O-Ton von Karsten Krampitz, Redakteur des Strassenfeger, im Interview am 22.07.1996.
[16] Stefan Schneider, motz & Co - Jetzt weltweit im Internet. (http://userpage.fu-berlin.de/-zosch). Auch in: wohnungslos. Aktuelles aus Theorie und Praxis zur Armut und Wohnungslosigkeit. 37. Jahrgang, 3/95, Bielefeld 1995.
[17] zitiert in: Ebd.
[18] vgl. hierzu: Klick in die Zukunft. In: Der Spiegel, Nr. 11/96, S.66-99.
[19] Im Rahmen der Emnid-Umfrage wurden 1.524 Personen befragt.
[20] vgl. hierzu: Klick in die Zukunft. In: Der Spiegel, Nr. 11/96, S.66-99.
[21] zitiert in: Stefan Schneider, motz & Co - Jetzt weltweit im Internet. (http://userpage.fu-berlin.de/-zosch). Auch in: wohnungslos. Aktuelles aus Theorie und Praxis zur Armut und Wohnungslosigkeit. 37. Jahrgang, 3/95, Bielefeld 1995.
[22] zitiert in: Joachim Huber (im Interview mit Neil Postman), Herr Postman, wann werden Sie U.S.-Erziehungsminister? In: Tagesspiegel vom 4. Juli 1996 (52. Jahrgang, Nr. 15673), S.26.
[23] vgl. hierzu: Hilmar Schmundt, Der Kiez als Netzgemeinschaft. In: Tagesspiegel vom 11. Juli 1996 (52. ( Jahrgang, Nr. 15680).