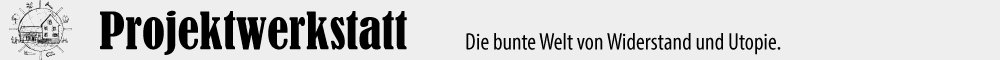FU Berlin Kennedy- Institut für Nordamerikastudien 9.7.96
SS 1996
Hauptseminar 32511: Obdachlosigkeit in Nordamerika und Deutschland
DozentIn: Margit Mayer/Stefan Schneider
Referent: Hendrik Bechmann
Beschreibung einer in Berlin aktiven Organisation im Bereich Obdachlosigkeit am Beispiel der DRK- Notübernachtung.
Im Rahmen der vom Berliner Bezirksamt Reinickendorf finanzierten Kältehilfe 1995/96 wurde in der Karl- Bonhöffer- Nervenklinik unter der Schirmherrschaft des DRK eine Notübernachtung für wohnungslose Männer eingerichtet.
Das DRK- Reinickendorf mietete für den Zeitraum von Oktober 1995 bis April 1996 eine leerstehende Station innerhalb des Geländes der KBoN an.
Beschreibung der Örtlichkeit:
Die Station bestand aus drei Schlafräumen mit jeweils fünf Betten und abschließbaren Schränken, einem großen Gemeinschaftsraum, einer Küche, Toiletten und Waschräumen (Dusche und Badewanne), sowie einem Büro der Betreuer. In dem Gemeinschaftsraum wurde gemeinsam gegessen, ferngesehen, gespielt und sich unterhalten.
Aufnahmevoraussetzung:
Die Einrichtung der Notübernachtung wurde als ein niederschwelliges Angebot für wohnungslose Männer konzipiert. Bedingungen für die Aufnahme waren eine relative Nüchternheit, das Verbot des Alkohol- und Drogenkonsums auf dem Gelände der KBoN, Grundsätzlicher Verzicht auf Gewalt, auch verbal und die Beteiligung an alle anfallende Arbeiten.
Angebote und Ziele:
Die Hauptaufgabe der Einrichtung bestand vor allem darin, wohnungslosen Männern nach Möglichkeit einen Schlafplatz, entsprechend den zur Verfügung stehenden Kapazitäten, - fünfzehn feste Betten und zwei Notmatratzen - bereitzustellen. Darüber hinaus wurde den Bewohnern eine Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln, die Nutzung sanitärer Einrichtungen und eine regelmäßige ärztliche Betreuung angeboten.
Die Notübernachtung öffnete täglich um 18 Uhr und wurde am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder geschlossen. Eine Reservierung des Bettplatzes für die nächste Nacht war möglich. Durch diese Möglichkeit entwickelte sich ein fester Bewohnerstamm. Die kontinuierliche Übernachtung an einem festen und sicherem Ort, sollte zu einer Stabilisierung, der sonst unsicheren Lebenslage der Wohnungslosen beitragen, und damit die Motivation stärken, ihre eigene Lebenssituation positiv zu verändern. Dazu gab es auf seiten der Betreuer Angebote nach alternativen Wohnmöglichkeiten gemeinsam zu suchen.
Organisation und Ablauf:
Die Notübernachtung wurde nächtlich von zwei StudentInnen betreut. Zumeist kamen die StudentInnen aus sozialpädagogischer und psychologischer Fachrichtung. Daß ich aus rein geisteswissenschaftlicher Fachrichtung kommend zur Mitarbeit angesprochen wurde, hing vor allem damit zusammen, daß ich bereits durch die Betreuung des Nachtcafés der Gemeinde "Zum Guten Hirten" im Vorjahr über Erfahrungen in der Arbeit mit Wohnungslosen verfügte.
Das Betreuerteam bestand aus acht StudentInnen, die in Eigenverantwortung mit den Bewohnern den Ablauf und das Zusammenleben organisierten. In gemeinsamen Absprachen wurden Speisepläne und Einkaufslisten, sowie Reinigungspläne erstellt. Die Bewohner Übernahmen im Wechsel den Einkauf und die Zubereitung der Mahlzeiten. Überwiegend gab es warmes Abendessen. Die Bewohner achteten selbständig auf die Rationierungen und die Einhaltung des zur Verfügung stehenden Kontingents. Die Betreuer verwalteten die dafür notwendigen Geldmittel. Zur Organisation des allgemeinen Ablaufes wurden wöchentliche Bewohnerversammlungen durchgeführt, bei denen anfallende Probleme und entstandene Konflikte gemeinsam besprochen wurden.
Aufgrund der Räumlichkeiten konnten die Bewohner unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse befriedigen. Für die einen war es wichtig, sich in ein Zimmer zurückziehen zu können und auszuruhen, andere dagegen konnten im Gemeinschaftsraum Geselligkeit beim Fernsehen, Spiel oder bei Gesprächen untereinander finden. Viele nutzten dabei die Gelegenheit, ihre Probleme und Sorgen mit den Betreuern zu besprechen oder auch bei ihnen Rat zu suchen.
Bewertung:
Aufgrund der Gesamtstruktur der Notübernachtung bildete sich nach kurzer Zeit ein fester Bewohnerstamm heraus. Durch die Übernahme von Verantwortungen und Engagement bezüglich der Lösung und der Organisation allgemeiner und einfacher Probleme des Gruppenlebens in der Notübernachtung, wurden sozialverantwortliche Ressourcen mobilisiert, die dem einzelnen neues Selbstvertrauen zu den eigenen Möglichkeiten gab.
Konzipiert war das Projekt ursprünglich, Grundbedürfnisse Wohnungsloser im primitiven Maßstab zu realisieren wie: Schlafen, Essen, Waschen. Durch daß Entstehen einer zeitweiligen Dauerbewohnung für viele, sahen sich die Betreuer mit der Befriedigung von Bedürfnissen der Bewohner konfrontiert, die in der ursprünglichen Planung nicht mitberücksichtigt waren. Die Betreuer wurden in zunehmendem Maße mit den persönlichen Sorgen und Nöten verschiedener Bewohner involviert. Hinzu kam, daß mit der durch die Unterkunft gewonnene Sicherheit, eine wirkliche Freizeit für die Bewohner zur Verfügung stand, die es sinnvoll auszufüllen galt. In die Zeit der Unterbringung vielen z.B. die Feiertage Weihnachten, Jahreswechsel und Ostern. Daß es dabei zu Problemen des gemeinsamen Lebens, zumal über einen relativ langen Zeitraum mit sich konstituierenden festen Gruppen, kam, ist nur allzu natürlich. Die besonders dabei entstehende Gruppendynamik erforderte von den Betreuern pädagogische Kompetenzen, die auch erst im Laufe der Entwicklung angeeignet werden mußten. Die Regelung des Zusammenlebens erforderte Maßregeln und Ordnungsvorschriften, die dann wieder selbst zur Quelle von Regelverstößen wurde. Die Aussprache eines Hausverbotes bei groben Verstoß gegen die "Hausordnung" z.B. erhob den aussprechenden Betreuer zu einer Moralinstanz, die ihn in seiner Kompetenz gegenüber seiner Selbstempfindung übersteigerte. Bei aller Solidarisierung mit den Bewohnern wurde im Ernstfall deutlich, daß die Betreuer das Hausrecht mit aller Konsequenz zu vertreten haben.
Bei allen zu verzeichnenden Einzelerfolgen wie z.B. die Wiederbeschaffung von Ausweispapieren, Vorbereitung für den Krankenhausaufenthalt einer notwendigen Operation, die Vermittlung eines Platzes in einem Wohnheim mußten die meisten dennoch nach der Schließung am 1. Mai wieder zurück in eine ungewisse Zukunft auf die Straße. Die Gesellschaft hatte bis zum nächsten Winter ihrem moralischen Pflichtgefühl Genüge getan.