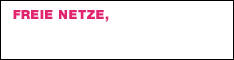FU Berlin
SoSe 96
FB Pol. Wiss. (Otto-Suhr-Institut)
FB Nordamerikastudien (J. F. Kennedy-Institut)
HS32 511 Obdachlosigkeit in Nordamerika und Deutschland
Doz.: Prof. Dr. Margit Mayer / Stefan Schneider
Joachim Baars
Im Bauch des Wals
(Jona, eine Kinder- und Jugendschutzwohnung des Evangelischen Johannesstifts in Berlin-Spandau)
Eine Villa in der Schönhauser Allee im Berliner Stadtteil Spandau ist seit Dezember 1995 Sitz der Kinder- und Jugendschutzwohnung Jona. Hier erhalten Kinder und Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren Unterkunft und Hilfe, wenn die Situation in ihrem Elternhaus oder ihrer bisherigen Unterbringung dies erforderlich macht. Wie der Name der Wohnung bereits vermuten läßt, nimmt das Projekt Jona, wie andere Projekte mit Namen wie Levi oder Amos ebenfalls direkten Bezug auf das Buch der Bücher, was angesichts des Arbeitgebers der dort Beschäftigten nicht weiter verwundern sollte. Finanziert wird die Schutzwohnung vom Evangelischen Johannesstift, damit über das Diakonische Werk und somit der Evangelischen Kirche. Das Stift stellt im Bezirk Spandau den größten Arbeitgeber dar und vermittelt gleichzeitig ein breit gefächertes Angebot im sozialen Bereich. Auf dem eigenen Gelände finden sich neben einer Kirche, einem Krankenhaus, einem Supermarkt, eigener Wäscherei und Großküche auch zahlreiche Wohngruppen für Menschen jeden Alters und jeder Behinderung, betreute Wohnungen und Pflegestationen. Kurz: das Angebot reicht von Pflege bis Rehabilitation. Was in der Konzeption bei der Gründung der Schutzwohnung Jona zugrunde lag, war weitgefasst auch der Gedanke der Prävention.
Wenngleich die von Jona betreuten Jugendlichen auch mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben und sich die Vorgeschichten zu diesen Problemen auch voneinander unterscheiden, ist klar, daß hier meist in sehr jungen Jahren die Weichen gestellt werden für eine Entwicklung, an deren Ende all die Ergebnisse stehen, die dann meist nur noch in Statistiken auftauchen: Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Die Flucht vor der Realität in Selbsttäuschung, Alkohol und anderen Drogen setzt schon im Alter dieser Kinder und Jugendlichen ein.
Die Mitarbeiter der Wohnung Jona fungieren in erster Linie als Bezugspersonen und Ansprechpartner für die Jugendlichen. Angesichts der Entwicklungsunterschiede zwischen zwölf- und achtzehnjährigen Jugendlichen fällt das nicht immer leicht. So ist auch vor dem Hintergrund des bisher Erlebten nicht jeder Jugendliche bereit, sich zu öffnen und die angebotene Hilfe zu akzeptieren. Andererseits spielt in diesem Bezugssystem auch die zeitliche Dimension eine entscheidende Rolle. Die Verweildauer in der Schutzwohnung Jona kann nur einen Tag betragen oder sich auch über einen Zeitraum von drei Monaten erstrecken. Sie ist in jedem Fall zeitlich begrenzt. Die pädagogische Arbeit, die in diesem Zeitraum stattfindet, gründet also auf der Vorbedingung, daß der jeweilige Teenager sich öffnet und deutlich macht, daß er oder sie Hilfe beim Bewältigen von Problemen braucht und diese dann auch annimmt. Druckmittel von seiten der Betreuer, wie sie in Heimen denkbar sind, die in ihrer Unterbringung von einer längeren Frist ausgehen können, somit nicht diesen "Durchgangscharakter" haben, existieren in diesem Maße bei Jona nicht. Hier wird vielmehr auf die Einstellungen und Bedürfnisse der Jugendlichen geachtet, was wiederum nicht heißt, daß es keine Regeln zum Zusammenleben in der Wohnung gibt. Alkohol sowie andere Drogen oder Gewalt gegen andere werden bei Jona nicht geduldet und können zum Ausschluß aus der Wohnung führen. Dies war jedoch bisher nur in einem Fall nötig, im allgemeinen bereitet die Einhaltung der Regeln den Kids keine Probleme. Nicht zuletzt durch diese Regeln herrscht in der Wohnung eine Atmosphäre, die niemand missen möchte, da sie ein Ausruhen und die Abkehr vom Alltag ermöglicht. Und gerade Ruhe, ebenso wie Anerkennung, ist für die meisten hier enorm wichtig, wichtiger für alle ist jedoch der Umstand, daß ihnen hier jemand zuhört und ihre Probleme auch ernst nimmt. Dies war für sie in der Vergangenheit nicht der Fall.
Wenn auch körperliche Mißhandlungen bei den von Jona betreuten Jugendlich relativ selten festzustellen sind, so offenbaren sich seelische und psychologische Schäden in um so größerem Ausmaß. Gerade in diesem Bereich werden von den MitarbeiterInnen- unter ihnen neben ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen auch eine Psychologin -immer häufiger diesbezügliche Beobachtungen gemacht. Eine Tatsache, die man in der im Haus integrierten Tagesgruppe für verhaltensauffällige Kinder wohl nur bestätigen kann. Schon bei Zehnjährigen nimmt die Einschätzung von Gewalt und ihr Sozialverhalten im allgemeinen Formen an, die keinesfalls dem in ihrem Alter üblicherweise Erlernten entsprechen. So auch in der Schutzwohnung Jona.
Betrifft die häufigste Ursache für einsetzende Probleme, nämlich die Scheidung der Eltern, noch sowohl Jungen als auch Mädchen schwer in ihrer Entwicklung, so werden im Folgeverhalten klare Unterschiede deutlich. Während Jungen eher ein gewalttätiges Verhalten gegenüber anderen an den Tag legen, treten bei Mädchen eher Autoaggressionen auf: Schuldgefühle oder das typische Nägelkauen etwa.
Was bei der Betrachtung des Alltags der Jugendlichen auffällt, ist das Fehlen jeglicher Hobbys oder auch Freundschaften. Somit fällt eine Strukturierung des Tagesablaufes für diejenigen, die nicht mehr zur Schule gehen oder gerade Ferien haben, schwer. Das bereitgestellte Taschengeld geht meist für Zigaretten drauf, und zu anderen Aktivitäten fehlt oft der eigene Antrieb. Sicher auch als Ausdruck eines gestörten Umgangs mit jeglicher Art von Kommunikation stellt Fernsehen oder Kino, also der bloße Konsum, den Favoriten in der Freizeit dar. Der Umstand, daß der Ausländeranteil per Aussehen in der Gruppe bei ca. 40% liegt, spielt dabei keine Rolle. Im Gegenteil, das Gefühl ja quasi im selben Boot zu sitzen läßt es zu, das man sich auch untereinander zuhört und die Probleme der anderen akzeptiert, etwas, das vorher im Elternhaus selten selbst erlebt wurde. Von dieser Seite herrscht teilweise noch die Einstellung vor, mit dem Kind stimme halt einfach etwas nicht. Ohne über die Ursachen nachzudenken oder diese gar bei sich selbst zu suchen, läßt man das Kind halt von Fachleuten "Reparieren", ähnlich dem eigenen Auto. So wird auch nicht selten die Frage gestellt, wann man denn das Kind wieder abholen könne. So gehört auch der Umgang mit den Eltern zur Arbeit der Betreuer in der Kinder- und Jugendschutzwohnung Jona. Einige sind dabei durchaus aufgeschlossen und zur Mitarbeit bereit, andere hingegen üben auf die Kinder auch dann noch direkten Druck aus und wollen sie zur Heimkehr zwingen. Die Tatsache, daß das eigene Kind in einer Schutzwohnung lebt, wirkt für diese Eltern fast wie das Eingeständnis, daß eben in der Erziehung etwas schiefgelaufen ist und die Schuldzuweisung an die Kinder doch zu eindimensional ist. "Der ist halt einfach blöd" oder "die wird immer klauen, das ist halt so" reichen als Erklärungen nicht auf Dauer aus.
Bei ihrer Arbeit wirken die Jona-Leute direkt mit dem Kostenträger der Wohnung, dem Jugendamt, zusammen. Über das Jugendamt bekommen sie die Jugendlichen, meist im Anschluß an einen Heimaufenthalt, zugewiesen. Andere wieder finden ihren Weg durchs Hörensagen direkt zur Schutzwohnung Jona. Nach der hier verbrachten Zeit kehren die jugendlichen entweder in ihre vorherige Umgebung, ihr Elternhaus zurück oder werden nachfolgend betreut. Hier wird aufgrund der Kostensituation eine Veränderung deutlich. Die Zuständigkeit verlagert sich vom Jugendamt immer mehr zum Sozialamt. Bei beiden Behörden muß immer mehr darauf geachtet werden, was am billigsten ist, und immer weniger darauf, was für die Betroffenen am besten wäre. So kommt es durchaus vor, daß eine Vierzehnjährige in eine stundenweise betreute WG einzieht, wo die Kosten für pädagogisches Fachpersonal entfallen. Die Berliner Heimlandschaft verändert sich insgesamt und orientiert sich immer mehr an einer Grundpflege und der Versorgung mit dem wichtigsten. Doch was ist das?
Schon heute sind Erfolge ihrer Arbeit für die in der Schutzwohnung Jona engagierten Männer und Frauen kaum direkt sichtbar. Langzeitstudien der von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen gibt es nicht, allenfalls die spätere Rücksprache mit den Betroffenen, die die Gewißheit dafür liefert, daß die Arbeit von Jona in gewisser Weise einen Wendepunkt einleiten konnte. Aber oft geschieht auch das nicht. Dennoch lassen es die Betreuer nicht an Optimismus fehlen. Denn zwei Dinge gehören nicht zu dieser Arbeit: Mitleid mit den Betroffenen und der Anspruch, jahrelang Versäumtes und Falschgemachtes in einigen Wochen zu korrigieren. Unter diesen Bedingungen füllt die Kinder- und Jugendschutzwohnung Jona einen wichtigen Platz aus und kann ihrer Funktion als zeitweilige Anlaufstelle, wo eine soziale Abwärtsentwicklung junger Menschen noch einmal gestoppt werden kann, gerecht werden.
Joachim Baars
- Der Schreiber ist selbst Mitarbeiter im Ev. Johannesstift und führte Interviews mit den Mitarbeitern der Gruppe Jona durch --