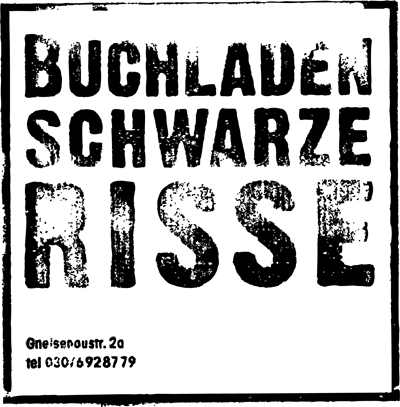Freie Universität Berlin
Fachbereich Politische Wissenschaft (Otto-Suhr-lnstitut)
Zentralinstitut John-F.-Kennedy-lnstitut für Nordamerikastudien
HS Obdachlosigkeit in Nordamerika und Deutschland, SoSe 1996
Margit Mayer/Stefan Schneider
Peter Gebauer
Protokoll vom 18.06.1996
Rückblick auf die letzte Sitzung
Am Anfang der Sitzung referierte Jo Baars kurz die letzte Sitzung vom 11.06.1996. Thema der letzten Sitzung "Stadtentwicklung und Obdachlosigkeit", Vorstellung eines Forschungsprojekt von Jens Sambale und Dominik Veith. Als wichtige Kernaussage des vorgestellten Forschungsprojekt stellte Jo Baars die Regulierung des Wohnungsmarkt heraus, die (Rückzug des Staates aus dem sozialen Wohnungsbau) nicht erst mit der "Wende", sondern bereits 1987 statt fand
Anmerkungen zum Verfassen eines Protokolls
Ein Probleme für den Protokollanten der letzten Sitzung war das vorgetragene Forschungsprojekt niederzuschreiben, da es sehr schnell vorgetragene wurd, was auch von anderen Teilnehmer und der Dozentin Margit Mayer nachvollzogen werden konnte. Die Dozentin Margit Mayer gab dann auch Empfehlungen, wie man Protokolle verfaßt und vorträgt. Protokolle sollen eine Überblick nur das wesentliche einer Seminarsitzung wiedergeben - daher sollen keine Nebensächlichkeiten mitgeschrieben werden. Wichtige Punkte, die beim Protokollieren berücksichtigt werden sollten:
- nur das Wichtige hervorheben, keine Nebensächlichkeiten protokollieren
- Fragen mitschreiben
- Was kam als Ergebnis heraus (auch offene, ungeklärte Fragen erwähnen)?
3. Sektor-Organisationen in den USA (1.2.3 Sektor)
In der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten wie z.B. den USA werden Wirschaftssubjekte in drei große Bereiche unterteilt:
- Markt bzw. Unternehmenssektor: (profitorientiert, selbstständig handelnde Unternehmen.
- Staat: (vom Staat getragene Einrichtungen, bspw. Kindertagesstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen etc.).
- privater Sektor: freie Träger, nicht direkt vom Staat getragen: große Wohlfahrsverbände, bspw. Caritas, kleine stadtteilorientierte Verbände, Kirchen (können sich die Arbeitnehmer aussuchen, bspw. nur Katholiken etc.).
Die Anfänge der Wohlfahrtsorganisationen in den USA
In den USA gibt es heute kaum noch staatliche soziale Einrichtungen für hilfsbedürftige Menschen, dieser Bereich wird heute zum größten Teil im sogenannten 3. Sektor von Nonprofit-Organisationen übernommen. Staatliche als auch private Wohlfahrt hat in den USA keine so lange Tradition wie in Deutschland. In Deutschland forderten im vorigen Jahrhundert vom Bürger getragene Selbsthilfegruppen Anspruch auf Staatshilfe. Aufgrund des politischen Drucks => Bismarcks
Sozialgesetzgebung. In den USA gab (und gibt) es keinen (so weitreichenden) universellen Anspruch auf soziale Staatshilfe. Statt dessen liegt die soziale Verantwortung in den USA im privaten Sektor. Die Verlagerung vom 2. Sektor in den 3. Sektor ist eine Rückbesinnung auf die Anfänge sozialer Hilfsorganisationen in den USA. Damals gründeten oder unterstützten vorwiegen reiche Bürger Hilfsorganisationen für sozialbedürftige Bürger oder unterstützten diese mit Spenden. Der Staat war im (diesen) sozialen Bereich so gut wie nicht aktiv, die Bürger sollten selbst die Verantwortung übernehmen und entscheiden, wem sie helfen wollen => zivilstaatliches Prinzip (Bürgergesellschaft). Die ersten Selbsthilfeorganisationen waren, da sie keine finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten haben, in ihrem Handeln unabhängig. Insbesondere Frauen haben sich in Hilfsorganisationen betätigt, da ihnen der Zugang zur männerdominierten Politik und den Wissenschaften erschwert wurde.
Die Dezentralisierung von sozialen Einrichtungen (für Obdachlose) nach dem "New Deal"
Die Regierung unter Ronald Reagan hat sich gegen ein staatliche Lösung des Obdachlosenproblems gewandt. Nur noch für die Grundversorgung soll der Staat zuständig sein. Stattdessen sollen die Bundesstaaten und insb. im privaten Sektor Nonprofit-Organisationen mehr Verantwortung im sozialen Bereich übernehmen. Nonprofits sind zu vergleichen mit den Freien Trägern in der Bundesrepublik Deutschland. Nonprofit-Organisationen können von sich aus alleine nicht bestehen, denn zum einen sind die Einnahmen, die sie selbst erwirtschaften, viel zu gering, zum anderen reichen auch die Spenden vorwiegend reicher Bürger nicht aus. Um ihre Arbeit verrichten zu können, sind Nonprofits auf staatliche Zuschüsse angewiesen. Nonprofits erhalten etwa 50% Zuschüsse vom Staat. Da der Staat zum einen Verträge mit dem Nonprofit-Organisationen abschließt, zum anderen die Anzahl der Nonprofits gestiegen sind, hat der Staat erheblichen Einfluß auf die freien Träger, er kann frei auswählen, welche Hilfsorganisationen unterstützen möchte und welche nicht. Die Unabhängigkeit der freien Träger ist damit nicht mehr gewährleistet. Da Nonprofits zum einen unbürokratischer als der Staat arbeiten, zum anderen wegen des größeren Engagements, ist eine individuellere Betreuung möglich. Aufgrund staatlicher Unterstützung sind viele Hilfsorganisationen in den Staaten gegründet worden. Ein Teil der Hilfsorganisationen ist profitorientiert, ein anderer Teil nicht. Staatliche Hilfe und ein zunehmendes profitorientiertes Handeln hat zur Folge, daß das Konkurrenzdenken zunimmt. Zunehmend werden auch Selbsthilfeorganisationen (Volunteers) von Betroffen aus Eigeninteresse, aber auch aus der Vision heraus, uneigennützig zu helfen, getragen. Die von den Betroffenen getragenen Hilfsorganisation handeln sehr unbürokratisch, haben aber auch eine geringe finanzielle Basis, was sie aber andererseits von staatlicher Bevormundung unabhängig macht.