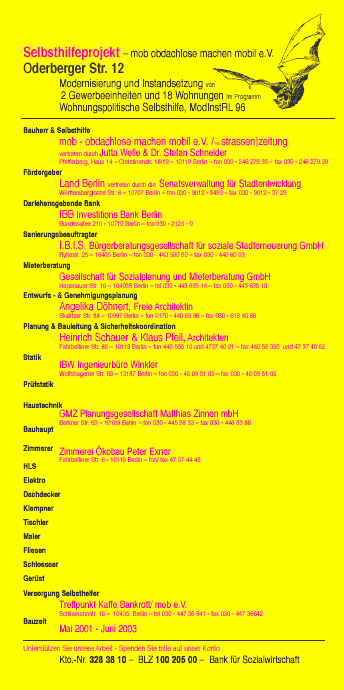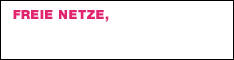Ich war also neulich wieder auf der Baustelle. Inzwischen kennt man da den Weg, wenn man einmal oder zweimal dagewesen ist. Mal vorbeigehen und mal gucken, wie es da so aussieht. Die ganzen Berichte in der Zeitung habe ich sowieso nicht so ernst genommen: Die können ja viel schreiben, wenn der Tag lang ist. Also groß was verändert wird sich da nicht haben, habe ich mir so gedacht. Wie gesagt, gedacht. Als ich da also so hinlatsche, so in den Hinterhof, kommt mir erstmal ein Hund entgegen. Typisch, habe ich mir so gedacht, die Obdachlosen und ihre Hunde. Ist ja fast wie bei den Punks. Nur die Hunde bei denen sind ja meistens lieb, keine Kampfhunde oder so, sondern eher treuherzige Strassenköter. Und so war es dann auch. Den Wuffi hätte ich fast mitgenommen, so treuherzig hat der geguckt. Aber ich schweife ab. Ich also rein in den Hinterhof, sehe den Hund, und danach: Nichts. Wirklich! Einfach nichts! Haben die einfach so den Schuppen da abgerissen. Spurlos verschwunden. Weg damit. Ordnungsmaßnahmen, erklärte mir so ein junger Typ mit Zopf, der da den Polier macht. Und dann erzählte er mir, dass er Selbsthelfer ist und in zwei Jahren da einziehen will. Und weil ein großer Teil davon in Selbsthilfe läuft, hat er einfach schon mal losgelegt und die anderen auch.
Ja, einer - das war mir zuerst nicht aufgefallen - stand vorne an der Straße am Container und hat den Bauschutt im Container ordnungsgemäß verteilt. Und zwei andere sind mit Schubkarren immer hin und hergefahren, um den vollzumachen. Das war also der Schuppen. Total baufällig, nicht mehr zu erhalten. Eigentlich hätte ich das eher so erwartet, wie ich mir das so auf Baustellen immer vorstelle: 8 Mann locker irgendwo auf Schaufel und Spaten gestützt, und dann eine rauchen und erstmal über die Arbeit nachdenken. Und auf jeden Fall ne Pulle Bier in der Hand. Nix da, erklärte mir T., das ist hier ne alkoholfreie Baustelle. Also, Baubeginn ist erstmal noch nicht, sondern erstmal nur Abriss und Räumen und vom Schutt, der so um Haus rumliegt. Ich gehe also ins Haus rein, und auch da Leute am Arbeiten. Ich dacht, ich werde nicht mehr. War ja fast alles weg. Und auf einmal hatte ich so eine Ahnung, daß da in dem Haus wirklich freundliche Wohnungen fertig werden könnten. Das wird aber noch zwei Jahre dauern, sagte mir T. - so ist dass nun mal auf dem Bau.
Jedenfalls - Bier gabs ja keins - bin ich dann erstmal weitergestiefelt - bei den Nachbars fragen. Ja, sagt die eine Nachbarin, davon hat sie schon gehört, ein Obdachlosenheim soll da entstehen. Soviel hatte ich wohl schon verstanden - alles andere ja, aber ein Heim machen die garantiert nicht. Was die immer glauben - einmal gelogen, immer gelogen. Wenn also jemand obdachlos ist, dann bleibst du obdachlos - Du wirst einfach in ein Heim gesteckt, und dann bist du dauerobdachlos. Wunderschön, klasse. So machen wir das. Langsam bekam ich schlechte Laune. Erst kein Bier auf der Baustelle, dann so eine Heimgeschichte. Ich also rüber in das Vereinsbüro. Jetzt ist der Weg frei für eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt. Damit kann ein Erbbaurechtsgrundbuch für die Oderberger Str. 12 angelegt werden. Dies ist notwendig, damit die kreditgebende Bank an rangbereitester Stelle eingetragen werden kann, schließlich will die Bank ja eine Sicherheit für die Finanzierung haben. Das erklärte mir die Geschäftsführerin. Ich verstand nur Bahnhof, habe mir ein Blatt Papier geben lassen und aufgeschrieben: Unbedenklichkeitsbescheinigung - Erbbaurechtsgrundbuch - rangbereitester Stelle - Bürgschaft. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben: Grunderwerbssteuer. Wenn ein Obdachlosenverein also es irgendwie schafft, ein Haus zu pachten, um darin Wohnungen zu schaffen für obdachlose, ausgegrenzte Menschen, muß, damit das irgendwie funktionieren kann, Grunderwerbssteuer gezahlt werden. Das ist ungefähr so, wie Kaution hinterlegen, wenn man eine Wohnung mietet. Das habe ich wohl verstanden. Für einen Obdachlosen ist das eine irrsinnige Hürde, wenn man nicht irgendwie gute Freunde hat oder eine Behörde, die das übernehmen tut. Ich weiß gar nicht, ob der Vergleich stimmt. Egal. Kann ja nochmal nachfragen.
Jedenfalls beim Schreiben ist mir klargeworden, daß das mit dem Heim ja Quatsch ist. Also wenn Obdachlose anfangen, ein Haus instandzusetzen und dann ist das fertig und dann ziehen sie ein und bezahlen Miete, sind sie eigentlich Mieter und keine Obdachlose mehr. Das wäre dann ein echter Vorteil und viel besser, als Dauerobdachlos in einem Dauerobdachlosenheim zu sein. Dann bin ich am nächsten Tag wieder auf die Baustelle gegangen und habe die Leute, die da arbeiten, genau das gefragt. Und die haben mir geantwortet: Genau so ist das, deswegen machen wir das ja. Wer wieder in einer eigenen Wohnung wohnt, ist nicht mehr obdachlos. Ich habe dann noch gefragt: Und wie kann ich Euch unterstützen? Na, ganz einfach, war die Antwort: Hier, faß an, der Container muß vollwerden. Wir haben hier noch zwei Jahre Arbeit, können jede Unterstützung brauchen. Vor lauter Schreck wollte ich erstmal fünf Mark für die Kaffekasse spenden und zusehen, daß ich schnell wegkomme. Weil, das war mir dann doch etwas unheimlich. Aber dann habe ich mich doch hingesetzt und mir alles genau erklären lassen. Und im Moment bin ich am Überlegen, ob ich nicht doch mit anfassen sollte, so regelmäßig einmal die Woche. Einfach, um die Leute zu unterstützen. Aber, darüber muß ich erst noch eine Nacht schlafen.
Oderberger Str. 12 - Wir bauen auf Sie!
An dieser Stelle erfahren unsere Leserinnnen und Leser gewöhnlich Neues vom Baufortschritt in unserem Haus Oderberger Straße 12 und werden gebeten, unser Bauvorhaben zu unterstützen.
"Wir haben den Auftrag für die Fenster erteilt", sagten vor nicht allzu langer Zeit die Architekten, "und wir müssen der Firma jetzt bald bescheidsagen, welche Farben wir haben wollen!" Nun hängt die Farbe der Fenster davon ab, welche Farbe die Fassade haben soll. Also wurde zu einer Baustellenversammlung eingeladen, im Arbeitsraum wurden Fassadenpläne aufgehangen, und es galt nun, eine Entscheidung zu treffen. Nur das war leichter gesagt, als getan. Es gab ein paar Entwürfe mit Bleistift, und wir versuchten zunächst, uns dem Thema anzunähern. Gerade die Fassade zur Straßenseite ist ja wie die Visitenkarte eines Hauses. In der Diskussion wurde schnell klar, daß es nicht poppig sein sollte, bonbonfarben oder so. Auf der anderen Seite wollten wir auch keine graue Maus haben, langweilig, eintönig wirkend. Das Haus selber hat zur Zeit einen erdfarbenen Gelbton - so würde ich das mal beschreiben - und wir haben uns dann dafür entschieden, uns an dieser Farbe zu orientieren. Wobei uns dann sehr schnell klar wurde, daß zum Hof hin und im Quergebäude aus dieser Farbfamilie deutlich hellere Töne gewählt werden müssen, da hier die Lichtverhältnisse schlechter sind. Und das Haus soll ja auch nicht erdrückend wirken. Auch soll der Sockel des Hauses farblich etwas abgehoben werden. Und jetzt dazu die passende Fensterfarbe. Am überzeugendsten war für mich ein Entwurf, der für jede vertikale Fensterreihe eine andere Farbe vorsah: ganz dezent in der Palette zwischen gelb über grün zu blau bis hin zu einem freundlichen rot. Das wird aber extra kosten - darauf wiesen die Architekten gleich hin. Besser wäre es, wenn wir uns auf eine einheitliche Farbe einigen könnten. Sie brachten verschiedene Farbfächer mit. Er war schlichtweg unglaublich, wieviel verschiedene Farben es eigentlich gibt. Also breiteten wir den Farbfächer mit der ausgewählten Farbfamilie für die Fassade aus und hielten Farbkärtchen für mögliche Fensterfarben dagegen. "Das beißt sich!" "Das sieht ganz gut aus!" - "Probieren wir mal diese Farbe!" Am Ende standen zwei Ideen: Einmal ein orangebraun, welches sich gut von den Fassadenfarben abheben könnte, der andere Vorschlag war ein lieblicher Grünton, der einen ganz freundlichen Kontrast abgeben würde. Ganz umsichtig sagten die Architekten dann: "Laßt uns das nicht überstürzen jetzt, wir lassen uns von der Firma zwei Muster machen, und dann gucken wir uns die noch mal in Ruhe an! Soviel Zeit haben wir noch!" Und so war es denn auch. Gestern kamen die beiden Muster an, und morgen werden wir abschließend darüber entscheiden.
Mit Fertigstellung des Häuser im Jahr 2003 sollen in der Oderberger Str. 18 Wohneinheiten entstehen, die überwiegend armen und ausgegrenzten, obdachlosen oder ehemals obdachlosen Menschen zur Verfügung stehen. Dazu muß der Verein mob e.V. einen Anteil von 15% der Bauarbeiten in Eigenleistung erbringen. Arme und ausgegrenzte Menschen erhalten so eine Chance, sich über die Mitarbeit auf der Baustelle einen eigenen Wohnraum zu verschaffen und sich in den Arbeitsalltag wieder zu integrieren. Zu diesem Prozeß gehören auch Entscheidungen über die zukünftige Gestaltung des Hauses. Wie immer bei Selbsthilfeprojekten kann das nur funktionieren durch Unterstützung von außen. Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, uns helfen wollen, beachten Sie bitte die nebenstehende Information zu unserem Bauvorhaben. Die Abbildung zeigt den gegenwärtigen Zustand der Fassade, insbesondere der vorhandene Stuck soll erhalten und wieder instandgesetzt werden, was sehr aufwendig und kostenintensiv ist. Mit Ihrer Hilfe werden wir es schaffen. Vielen Dank.
Stefan Schneider
Die Obdachlosen aus der Oderberger 12
Das baufällige Wohnhaus in Prenzlauer Berg ist fest in der Hand von Trebern: Der Verein "Obdachlose machen mobil" hat es gepachtet. Weil der aber kein Geld hat, helfen nun Menschen beim Sanieren aus, die sich einst selbst nicht mehr zu helfen wussten
Ralf Schönball
Grau ist dieser Tag, und der Regen nieselt herab auf die Passanten. Sie gehen eilig ihrer Wege, die Köpfe zwischen den Schultern eingezogen. Heute hat die Oderberger Straße im Prenzelberg nichts vom diskreten Charme des Bohème-Kiezes. Der herrscht vor allem nachts und spült die Alternativ-Reise-Touristen ins "Entweder-Oder". Oder in den Griechen nebenan. An diesem Vormittag aber ist der Kiez wie die Fassade von Hausnummer 12: nicht mit anzusehen. Doch es wird wieder. Ganz sicher. Das Wetter. Und dieses Haus. Denn hier kümmert sich wer. Wer? Ein Haufen Penner - sagen solche, die sich an die Fassade halten und gerne "dem ersten Eindruck" glauben schenken. Wie leicht ist es, sich selbst zu betrügen. Egal wo man steht. Auch hier, in der Oderberger Straße, wo Menschen eine Chance bekommen sollen, die sonst wohl nirgendwo eine kriegen. Obdachlose, Knastbrüder, Sozialhilfe-Empfänger.
Stefan Schneider ist ein schmaler Mann Ende Dreißig. Er hat eine Brille mit großem milchweißem Gestell und ein Vertrauen schaffendes, offenes Gesicht. "Wir haben ein Erbbaurecht auf das Gebäude", sagt er. Dann macht er eine Pause. Man hört ihn denken. Endlich lächelt er, bevor er wieder zum sprechen ansetzt: "36 000 Mark Pacht im Jahr verlangt die Eigentümerin." Ein Spottpreis für diese Lage im Szene-Kiez. Alle wollen nach Prenzelberg. Wie zu Mauerzeit in West-Berlin alle nach Kreuzberg zogen. Da die Nachfrage groß ist, steigen die Preise. "Nebenan", sagt Schneider "haben sie das Haus in Eigentumswohnungen aufgeteilt." Alle verkauft. Die Fassade ist frisch getüncht. Die Tür zum Szene-Laden im Tiefparterre steht offen. Das Nachbarhaus könnte auch in Hamburg stehen. Die Oderberger 12 nicht.
Über Hamburg kam auch die Idee für die "straz" nach Berlin. Die "Straßenzeitung" ist eine Berliner Obdachlosen-Zeitung, wie sie Treber in U-Bahnen und Kneipen verkaufen. Schneider ist der Herausgeber des Blattes. Und die Redaktionsanschrift ist natürlich: Oderberger Straße 12. Zwei Baustellen in einer - könnte man meinen. In Wirklichkeit aber geht es nur um das eine: Menschen, die irgendwann abgerutscht sind, auf die Beine zu helfen. Das hat etwas mit Erziehung zu tun. Und Erfahrung. Schneider, studierter Pädagoge, hatte Mitte der neunziger Jahre eine Stelle an der Hochschule der Künste. Danach war er zwei Jahre arbeitslos.
Ausgemustert und abgestempelt
Das sagt er, irgendwann, ganz beiläufig. Erwerbslos gewesen zu sein - wer möchte sich schon dieser Erfahrung rühmen? Stigmatisierung droht. Dabei sind bald wieder vier Millionen Menschen arbeitslos. Sozialhilfe-Empfänger ausgenommen. In Arbeitsprogrammen Geparkte nicht mitgezählt. Gar nicht zu reden von jenen, denen es gegen die Ehre geht, stempeln zu gehen - oder als "Sozialfall" abgestempelt zu werden.
"Haben Sie mal Zeit für ein paar Fragen?" - "Nach 16.30 Uhr", antwortet der schlanke Mann im feuerwehrroten Overall. "Da bin ich schon weg", drängle ich. "Na schön, in der Mittagspause", erwidert er und lotst eine Schubkarre vom Hof zum Mischcontainer vor dem Haus. Peter Exner ist der Bauleiter. Genau genommen hat er zwei Jobs. Er ist außerdem Zimmermann. Gegen Mittag kommt er dann ins Zimmer von Schneider. Das ist im Vorderhaus und Sitz von Redaktion, Verein sowie Bauleitung.
Selbstbewusst schaut Exner drein, setzt die Kaputze ab und beginnt programmatisch: "Dies ist ein Aufruf, wir brauchen Leute", und er schaut herausfordernd wie einst vielleicht Genossen, wenn sie zum Kampf für die Rechte der Arbeiter aufriefen: "Das ist die Chance, am eigenen Wohnen mitzuarbeiten." - Wo in der Welt gebe es sonst derartige "gestalterische Freiräume", wo einem doch längst alles "in Durchschnitts-Norm vorgesetzt wird" - "Das alles kann man hier durchbrechen." Dann teilt Exner noch mit, dass die Qualität meines Artikels daran zu messen sein werde, wie viele Menschen seinem Aufruf Folge leisten werden. Dann ist er fertig und könnte eigentlich wieder gehen. Doch er bleibt. Und schweigt. Während ich notiere. Und schweige. Pädagoge Schneider grient. Architekt Heinrich Schauer sitzt regungslos da, wie in Meditation versunken. Er kennt seinen Bauleiter.
Und der Bauleiter kennt seine Leute. "Manche kommen an", sagt Exner, "und erzählen, was sie sonst so alles können." Heiße Luft, meint der Bauleiter, die machen sie, "weil sie ein Mal durch alle Raster durchgefallen sind." Er selbst lasse es erst einmal laufen, vor allem aber "komme ich nicht auch noch mit neuen Rastern." Bald fänden seine Leute dann wieder zu sich und knüpften dort wieder an, wo sie in ihrer individuellen Entwicklung stehen geblieben waren. Da muss der Bauleiter sie dann abholen.
Und das wird oft schwierig. Nicht nur weil es am Bau einstweilen hart zugeht. Sondern auch "weil man durch Arbeitslosigkeit das Arbeiten verlernt", sagt Schneider, der Erfahrene. Vier fest angestellte Bauleute der Oderberger 12 verdanken ihren Job dem Programm "Integration durch Arbeit" (ida). Einer der vier ist in regelmäßig wiederkehrenden Abständen krank. Zwei weitere blieben an diesem naßkalten Tag einfach weg. "Vielleicht sind die ja auch krank", sagt Exner, "aber sie melden sich nicht."
Noteinsatz vor dem Sturm
Aber auch wenn alle da sind, ist es nicht immer ganz einfach: Eines Tages, als das Dach noch abgedeckt war, zog ein Sturm auf. Erste Regentropfen klatschten auf den Boden. Die Bauleute focht es nicht an. Sie machten gerade Pause. Exner stürmte hoch, packte den Tisch, hob ihn in die Höhe und ließ ihn wieder herabfallen. "Der Mittagstisch war durcheinandergewirbelt, aber da hatten es alle verstanden", sagt der Bauleiter. Vier Männer griffen nach einer Plastikplane, die wie ein Segel unter den Böen widerspenstig auf und ab schlug, während ein anderer das Provisorium an den Dachsparren festtackerte. Die Baustelle war gesichert.
Noch ist die Oderberger 12 ein Rohbau. Überall war Hausschwamm. Vor allem im Hinterhaus, weil das zehn Jahre unbewohnt und ungeheizt war. Wegen der agressiven Sporen mussten sogar Böden und Decken raus. Türen und Rahmen sind auch weg. Teilweise liegen Türen auf den Böden, damit die Bauarbeiter nicht von Holzsparre zu Holzsparre springen müssen. Die neuen Grundrisse der Etagen im Hinterhaus sind aber bereits zu erkennen.
Architektin Angelika Döhnert hat jeweils eine kleine Einzimmer-Wohnung und eine Zwei-Raum-Wohnung mit Essküche vorgesehen. Wer lange auf Trebe war, und Gesellschaft dort suchte, wo die Rotweinflasche kreiste, findet vielleicht in einer Zweier-Wohngemeinschaft einen anderen Rückhalt. Das wäre ein kleiner Sieg im ungewissen Feldzug gegen die Erfahrung sozialer Ausgrenzung und der üblichen Flucht davor: in die Krankheit Alkohol. Und vielleicht beugt das einem Rückfall vor. In der Einraum-Wohnung kann eine Mutter mit Kind einziehen. Zum Beispiel. Oder jemand, der für sich sein will. "Mit dem Wohnen ist es wie mit der Arbeit - wenn man es verlernt hat, muss man sich erst wieder daran gewöhnen", sagt Schneider, der Pädagoge.
Der Aufruf des Bauleiters, die Visionen der Planer - eine Welt sozialer Verantwortung nimmt Gestalt an, doch auch sie muss sich in einer widerspenstigen Realität bewähren. Bis heute fehlen einige Grundbuch-Eintragungen. Deshalb hat die Bank den Kredit noch nicht freigegeben. Ohne Geld kann der Architekt keine Aufträge vergeben. Die Bauarbeiten sind vier Monate im Verzug. Nicht nur wegen des Geldes. Auch wegen der Motivation, um die es bei einigen Bauarbeitern im Selbsthilfe-Projekt nicht immer zum Besten bestellt ist. Und wenn die ihre Arbeit schleifen lassen, "dann laufen die Profis auf", sagt Architekt Schauer.
Die Profis sind Handwerkerfirmen. Diese bekommen Aufträge, wo Gewährleistung wünschenswert ist. Für Elektro-Installationen zum Beispiel und Wasserleitungen natürlich. Auch das Dach decken erfahrene Handwerker-Betriebe. In Selbsthilfe haben die Bauleute das Haus entrümpelt, Wände abgetragen und kleinere Maurerarbeiten geleistet. Als Lohn winkt eine Wohnung. Wer sich eineinhalb Jahre verpflichtet, zehn bis fünfzehn Stunden wöchentlich zu arbeiten, der erhält eine Bleibe für 7,30 Mark pro Quadratmeter. Wer nicht helfen will, muss eine Mark mehr zahlen.
Dennoch erklären sich längst nicht so viele Leute zur Mitarbeit bereit, wie es sich der rührige Projekt-Kern aus Architekt, Bauleiter und Vereinschef wünscht. "Die Leute haben häufig nicht die Zeit dafür, sie müssen sich um ihre Einnahmen kümmern", sagt Schneider. Keine Zeit, obwohl das Sozialamt die Mitarbeiter rekrutiert? Eher eine Frage des Geldes: Die ehrenamtliche Mitarbeit bei der Sanierung bringt den Bauleuten drei Mark die Stunde. Sie dürfen außerdem nicht mehr als 40 Stunden im Monat arbeiten. Mit höchstens 120 Mark dürfen sie ihre Sozialhilfe aufbessern. Hartes Brot.
"Bei dem Lohn ist die Motivation manchmal mäßig", sagt der Architekt. Die anderen, "festen Mitarbeiter" aus dem Ida-Programm verdienen dagegen netto um die 1500 Mark pro Monat. Nicht gerade ein Vermögen. Außerdem sind die Bauleute unkündbar. "Wir haben also kein Druckmittel, zum Beispiel eine Minderung der Rechnungssumme bei einem Bauverzug", sagt der Architekt. Und schließlich arbeiten in der Oderberger 12 noch die Männer "aus dem Knast". Sie erkaufen sich einen Tag Freigang durch einen Tag gemeinnützige Arbeit. "Die sind richtig motiviert", sagt Bauleiter Exner.
Der Architekt nickt: "Das ist Kraft, die hier reingeht." Ein sehr guter Maurer sei unter den Freigängern gewesen. "Die sind besser, weil sie Ordnung und Gesetz aus dem Knast kennen", sagt Exner. Im Vollzug werde jeder Fehltritt bestraft. Da sich die Männer auf der Prenzelberger Baustelle Freiheit erarbeiten könnten, die sie auf sonst keinem Wege erlangten, seien sie fügsam. Meistens. Doch ausgerechnet an dem Tage, als die Sozialarbeiterin in der Oderberger 12 die Leistungen der Freigänger überprüfen wollte, waren zwei Männer vorzeitig verschwunden. Bauleiter Exner hatte nichts davon mitbekommen. Der Strafvollzug reagierte. Die schweren Stahltore fielen hinter den Häftlingen wieder ins Schloss, und das Geschäft, einen Sonnabend Arbeit für einen Sonntag Freiheit, sollte vorerst aufgekündigt werden.
aus: Tagesspiegel Berlin, Sonnabend, 01.12.2001
Wie die Sanierung ohne eigenes Geld gelingen soll
ball
Um die Sanierung des Wohnhauses Oderberger 12 bemüht sich der gemeinnützige Verein "obdachlose machen mobil" (mob). Der mob ist Herausgeber der "Straßenzeitung", Bauherr des Gebäudes und wird nach Abschluss der Arbeiten die Wohnungen vergeben. Gegründet 1994 zählt der mob 23 Mitglieder. Die Finanzierung des Bauprojektes erfolgt über das Programm Wohnungspolitische Selbsthilfe Mod-Inst RL 96 (Modernisierung und Instandsetzung nach Richtlinie 96). Die Baukosten der 1200 Quadratmeter Nutzfläche großen Oderberger 12 betragen 3,8 Millionen Mark. Davon erhält der Verein 42,5 Prozent als Baukosten-Zuschuss, weitere 42 Prozent als zinsgünstiges Darlehen. Die verbleibenden knapp 16 Prozent (650 000 Mark) der Baukosten bringt der Verein in Selbsthilfe auf. Ferner kann sich mob Leistungen von Mitarbeitern aus Sozial-Programmen anrechnen lassen. Beispiel "Integration durch Arbeit" (ida). Ida-Kräfte sind Empfänger von Sozialhilfe, sie schließen einen Arbeitsvertrag mit dem Sozialamt, und dieses verteilt sie auf Einsatzorte. Dazu zählen Baustellen gemeinnütziger Einrichtungen und private Unternehmen. Statt des Regelsatzes für Sozialhilfe von rund 900 Mark, erhalten Ida-Arbeiter rund 1600 Mark im Monat. Ferner sind in der Oderberger 12 Mitarbeiter aus dem Programm Gemeinnützige zusätzliche Arbeit (gzA) im Einsatz. Sie erhalten drei Mark je Stunde und dürfen maximal 40 Stunden im Monat arbeiten. Im Jahr 2000 fanden rund 30 000 Berliner durch diese und ähnliche Programme eine Stelle. Das Programm "Arbeit statt Strafe" schließlich richtet sich an Menschen, die zu Geldstrafen verurteilt wurden, doch diese nicht zahlen können oder wollen - und diese stattdessen bei einem gemeinnützigen Träger abarbeiten. Den Stundenlohn leiten die Gerichte aus dem letzten Einkommen des Betroffenen ab. Geldstrafe geteilt durch Stundenlohn ergibt die Zahl abzuleistender Strafarbeits-Stunden.
Die Bauarbeiten begannen im Winter 2000/2001 mit Abrißarbeiten in der Oderberger Str. 12. Betroffen war die Remise im zweiten Hinterhof sowie etlichen Wände im Quergebäude. Aus dieser Zeit sind nur wenige Fotos erhalten, die ich hier gerne dokumentieren möchte.
Stefan Schneider