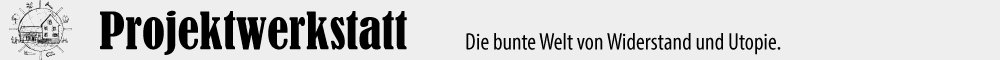Jennifer Toth
Der Untergrund in Geschichte, Literatur und Kultur
"Doch verkennt mich, wer glaubt, daß ich feige bin und etwa nur aus Feigheit meinen Bau anlege."
Franz KAFKA, Der Bau.
Der selbsternannte Engel des Bösen personifiziert die instinktive Furcht, die viele gegenüber dem Untergrund und den Lebewesen, die dort existieren, hegen. Unsere Wahrnehmung dieser Region und der Leute, die dort leben, ist durch Schrecken erzeugende Vorstellungen geprägt, die in unserer Kultur von einer Generation an die nächste weitergegeben wurden. In der Literatur und in der Geschichte wurden die Tiefen der Erde über Jahrhunderte hindurch als ein Gebiet dargestellt, in dem das Böse und Irrationale gedeihen. Sie sind der ideale Projektionsraum für das Dunkle, Unbekannte und Unheilverkündende und eine Quelle, aus der sich begierig Phantasien speisen.
Aus diesen Vorstellungen heraus ist in der Kultur des Westens der Untergrund zur Metapher für eine bestimmte Gedankenwelt, ein bestimmtes soziales Umfeld sowie ein bestimmtes ideologisches Konzept geworden. Er wird als bedrohliche Kehrseite der überirdischen Gesellschaft dargestellt. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die symbolische Bedeutung der Metaphern, die sowohl in der Geschichte als auch der Literaturgeschichte immer wieder auftauchen, stark verändert. Dennoch haben diese Metaphern weitverbreitete und zählebige Begriffsinhalte, zerstörerische Vorurteile und eine naive, aber tief verwurzelte Furcht vor der Dunkelheit hervorgebracht, woraus sich die ernsthaften Hindernisse erklären, die einer Hilfe für die Obdachlosen im Untergrund entgegenstehen. Glücklicherweise interessiert sich die Forschung für dieses kulturelle Erbe, untersucht es und stellt es dar - ein erster Schritt auf dem Weg, uns selbst von diesem Erbe und seinen schädlichen Einflüssen lösen zu können.
In der Literatur wird der Untergrund in den seltensten Fällen als ein Garten Eden entworfen. Zu den wenigen Ausnahmen gehört eine antike Legende, in der es die Verheißung eines 1500 Kilometer langen Tunnels gibt, der zu einer phantastisch wohlhabenden und hochentwickelten Zivilisation führen soll. Mehrere moderne Autoren haben versucht, den Ort aus dem dunklen Untergrund in die erhabenen Berge Tibets zu verlegen - ein Beispiel dafür ist die Hollywood-Verfilmung von Shangri-la - oder aber in die unendlichen Meere von Atlantis. Für die Anhänger der antiken Legende bleibt der Ort jedoch noch immer der Untergrund, und manche behaupten sogar, daß das Tunnelsystem unter dem New-Yorker Central Park Teil des legendären Netzwerkes sei.
Statt eines Garten Eden ist der Untergrund jedoch vor allem lange Zeit gleichbedeutend mit der Hölle gewesen, und zwar in der Bibel und ihren Auslegungen. So fuhren beispielsweise die Höllenkreise DANTES nach unten. Autoren des 19. Jahrhunderts benutzten den Untergrund als Metapher für ein Volk, das an der Oberfläche lebte, aber durch Verbrechen und drückende Armut dem Untergang geweiht war. Die heutige Welt des Verbrechens heißt in der Umgangssprache die "Unterwelt".
In ihrem Buch "Notes on the Underground" zeigt die Historikerin Rosalind WILLIAMS, daß man den Untergrund nicht immer gefürchtet hat. Sie argumentiert, daß die Untergrund-lkonographie den Interpretationen in Literatur und Geschichte folgt, wo die Unterwelten als technisches Milieu interpretiert werden. Die Furcht vor dem Untergrund tauchte historisch zeitgleich mit der Furcht vor dem technischen Fortschritt auf.
In der Urgeschichte war der Untergrund ein beruhigender Zufluchtsort vor den natürlichen Gefahren an der Erdoberfläche. Die ersten Bauten der Menschheit waren eher Höhlen als Gebäude, die "den Wunsch verkörperten, in die dunkle Sicherheit der Gebärmutter zurückzukehren, was ebenso ursprünglich ist wie vormythisch", schreibt WILLIAMS. Bis zum Anbruch des wissenschaftlichen Zeitalters hatte die Erde das Image einer Nährmutter. Laut Williams war sie "eine geheiligte Größe". "In die Erde zu graben, kam einer Vergewaltigung nahe. Aus diesem Grunde war Bergbau ein Unternehmen von zweifelhafter Moral, einer Verstümmelung und Schändung vergleichbar." Bis zum Ausgang des Mittelalters war es eine rituelle Handlung, eine Mine anzulegen, und bevor man in den geheiligten Untergrund eindrang, wurden religiöse Zeremonien abgehalten.
Aber in der Renaissance veränderten sich die Erzählungen über Reisen in die Unterwelt. Aus den geistlichen Erzählungen, die man mündlich übermittelte, wurden weltliche Erzählungen, die man nun aufschrieb. In diesen Erzählungen entdecken abenteuerlustige, verrückte oder unglückliche Reisende eine Unterwelt, die sie betreten, aus der sie manchmal jedoch nicht wieder auftauchen.
In einigen dieser Erzählungen finden sich immer noch die Spuren der früheren geistlichen Erzähltradition. William BECKFORD er zählt in "Vathek" (1787), wie der Kalif Vathek, ein hochmütiger Monarch voller Machtgier und Sinneslust, einen Pakt mit Eblis, dem orientalischen Satan, eingeht. Nachdem der Kalif seiner Religion und Gott abschwört, darf er Eblis' "Palast des unterirdischen Feuers" betreten, der unter den Ruinen einer alten Stadt liegt und in dem sich Schätze und Talismane befinden. Als sich Vathek und seine Geliebte der Ruinenstadt nähern, öffnet sich vor ihnen eine steinerne Plattform. Eine Treppe aus poliertem Marmor geleitet sie hinunter in das Reich des Eblis: "(...) sie fanden sich an einem Ort wieder, der, obgleich es sich um ein Gewölbe handelte, so weit und hoch war, daß sie ihn zunächst für eine große Ebene hielten. Langsam gewöhnten sich ihre Augen an die Größe der sie umgebenden Gegenstände, sie entdeckten Säulenreihen und Arkaden, die so weit in die Ferne reichten, bis sie sich am Horizont in einem leuchtenden Punkt trafen, so wie die untergehende Sonne das Meer mit ihren letzten Strahlen färbt." Sie sehen eine riesige Halle, die von bleichen Geistern umgeben ist, einige davon kreischen, andere sind still, alle haben glimmende Augen und bedecken mit der rechten Hand ihr Herz, das vom Feuer verspeist wird. Vathek und seine Geliebte fangen vor Haß an zu brennen und werden zu ewiger Hoffnungslosigkeit verdammt.
Jorge Luis BORGES pries in seiner Einleitung zu "Vathek" das Buch als "die erste richtig grausame Hölle in der Literatur". BECKFORD schuf den Präzedenzfall für einen dämonischen Untergrund, der sich in zeitgenössischen Arbeiten, wie Jean-Paul SARTRES "Bei geschlossenen Türen", fortsetzt.
Die Technik ermöglichte neue Vorstellungen vom Untergrund, und in einigen Büchern wurden die Tiefen als Quelle des Wissens und der philosophischen Wahrheit dargestellt. In der Spätrenaissance entstand eine neue Art intellektueller Forschung, Naturwissenschaften genannt - und heute Wissenschaft -, die die Bilder vom Bergbau dazu benutzte, um ihre Grundsätze und Methoden zu erklären. Francis BACON verwendete das Ausschachten von Erde als Metapher, wenn er Forschern nahelegte, "tiefer und tiefer in der Mine natürlichen Wissens" zu graben. Weil tief in der Erde, "in gewissen tiefen Minen und Höhlen, die Wahrheit der Natur versteckt läge" (vgl. WILLIAMS, "Notes on the Underground").
Im gesamten 18. Jahrhundert und noch Anfang des folgenden bedienten sich die Philosophen und Gesellschaftstheoretiker des Untergrundes als Metapher dafür, zur Wahrheit vorzudringen. "Die Elenden", Victor HUGOS Roman von 1862 über einen Aufstand der Unterschicht in Frankreich, ist eines der besten Beispiele für die erzählerische Erkundung des Untergrundes, sowohl in metaphorischer wie literarischer Hinsicht. Entscheidende Ereignisse läßt HUGO in den Abwasserkanälen unter der Stadt Paris stattfinden.
Der Autor erklärte, warum er metaphorisch in die Tiefen gereist ist:
"Die Mission des Moral- und Begriffshistorikers ist ebenso ernsthaft wie die des Historikers, der Ereignisse aufzeichnet. Der letztere betrachtet die Oberfläche der Zivilisation bei Tageslicht, betrachtet das äußere Geschehen: die Auseinandersetzungen der Königshäuser, die Geburten von Prinzen, die Ehen der Könige, die Schlachten, die Treffen, die großen Persönlichkeiten, die Revolutionen. Der Moral- und Begriffshistoriker beschäftigt sich mit dem Innenliegenden, mit den Grundlagen, mit den Leuten, die arbeiten, die leiden und die warten, mit überlasteten Frauen, mit schrecklicher Kindheit, mit den geheimen Kriegen, die die Männer gegeneinander führen, den verborgenen Grausamkeiten, den Vorurteilen, den bestehenden Ungerechtigkeiten, den verborgenen Auswirkungen des Gesetzes, den geheimen Entwicklungen, die die Seele nimmt, dem dunklen Erschaudern der Menschenmenge, dem Hunger, den Barfüßigen, den Unbewaffneten, den Enterbten, den Waisen, den Unglücklichen und den Ehrlosen und all den Geistererscheinungen, die in der Dunkelheit umherwandern. (...) Ist die Unterwelt der Zivilisation, weil sie tiefer und trüber ist, weniger wichtig, als der obere Teil? Kennen wir den Berg wirklich, ohne die Höhle zu kennen?"
WILLIAMS meint, daß die Historiker auf HUGOS Herausforderung eineinhalb Jahrhunderte lang eingegangen sind und unter der Oberfläche und dem, was diese zeigt, gegraben haben und unter getauchte und unterdrückte Gruppen zutage gebracht haben (Homosexuelle, Kriminelle, Frauen), unterdrückte Beweise (Träume, sexuelle Gebräuche, gedankliche Konstrukte) und unterdrückte Kräfte (ökonomische, technologische und ökologische).
Die Literatur des Realismus im 19. Jahrhundert benutzt das Thema der Reise in den Untergrund häufig als Suche. Auf der Suche nach gesellschaftlicher Wahrheit steigt der Pilger in die Niederungen der Gesellschaft hinab", heißt es bei WILLIAMS. "Der Abstieg hat stets metaphorische Bedeutung, dürfte aber angesichts der Lebensbedingungen der Armen zugleich auch wörtlich zu nehmen sein."
Insbesondere Englands viktorianische Realisten, wie Charles DICKENS, William THACKERAY und George ELIOT, wurden für ihre realistischen Darstellungen gesellschaftlichen Lebens im "Untergrund" gelobt. George GISSINGS Roman von 1889, "Die Welt dort unten", ist von unheimlicher Voraussicht, indem seine Beschreibungen von Menschen in einer Notlage auf die Obdachlosen im Untergrund von heute Verweisen. In seinem Buch sind jedoch die Menschen, die ums Überleben kämpfen und darum, sich ein Minimum an Würde zu erhalten, unter der Oberfläche tatsächlich gefangen - und zwar nicht, wie die Obdachlosen, durch soziale Umstände.
Es war HUGO, der das Bild einer dunklen Unterwelt am wirkungsvollsten benutzte, um den Reichen und Mächtigen zu drohen. Seine unterirdische Welt ist nicht nur arm, sondern zugleich verhängnisvoll für die französische Gesellschaft. "Die Männer hörten unter ihren Füßen ein gedämpftes Geräusch, als einige geheimnisvolle Maulwurfshügel an der Oberfläche der Zivilisation auftauchten, als die Erde rissig wurde, sich die Höhlenmündungen öffneten und die Männer plötzlich monströse Köpfe aus der Erde emporschnellen sahen."
Aus einem "riesigen schwarzen Loch ... hörte man das schwache Grollen der düsteren Stimmen des Volkes. Eine furchtsame und heilige Stimme, bestehend aus dem Röhren eines Scheusals und der Stimme Gottes..., die zur gleichen Zeit von unten, wie Löwengebrüll, und von oben, wie Gewitterdonner, kommt."
Obwohl HUGO den Leser der Brutalität des unterirdischen Lebens aussetzt, setzt er ebenso die unlösbaren Verbindungen zwischen der überirdischen und unterirdischen Gesellschaft in Szene, wie zum Beispiel in der Verfolgungsszene, in der Marius von Jean Valjean durch den Abwasserkanal getragen wird. HUGOS Botschaft besteht darin, daß die Gesellschaft im Untergrund zur Gesamtgesellschaft gehört und sie deshalb auch von ihrem Elend befreit werden kann.
MARX und FREUD, behauptet WILLIAMS, benutzten so häufig Untergrundmetaphorik, daß es heute nahezu unmöglich sei, einen Text über die Unterwelt zu lesen, ohne ihn im Sinne von MARX oder FREUD zu interpretieren.
Was den realen Untergrund betrifft, so wurde die unterirdische Grundlage der modernen Industrie zwischen dem späten 18. und späten 19. Jahrhundert mit dem Bau eines Verkehrsnetzes aus Kanälen und Eisenbahnlinien entwickelt. Darauf folgte die Konstruktion von Abwasserkanälen, Hauptwasserleitungen, Dampfröhren, U-Bahnen, Telefon- und Elektroleitungen und machte die Wechselwirkung und Koordination der Stadt oben mit ihrem lebenserhaltenden Inneren erforderlich.
Mit der Schaffung neuer materieller Grundlagen des industriellen und städtischen Leben bildeten sich zugleich neue gesellschaftliche Grundlagen heraus. Die Ausschachtungsarbeiten wurden zur Metapher für die grundlegenden Veränderungen, der die Gesellschaft unterworfen wurde, und sogar für den abstrakten Fortschritt der Zivilisation. Um U-Bahnlinien zu bauen, wurden lange bestehende Wohngebiete und Gemeinschaften aus den Angeln gehoben. Wegen der erhöhten Verkehrsgeschwindigkeit, die die U-Bahn zu bieten hatte, änderten sich die täglichen Verkehrsströme und die Arbeitsplätze. Diese Veränderungen brachten Besorgnisse über die neue Ordnung hervor. Und so tauchte im 19. Jahrhundert ein neuer Typus von Untergrundgeschichten auf: Die Unterwelt wurde zu einem Ort, den die Leute nicht nur besuchten, sondern an dem sie tatsächlich lebten.
In Jules VERNES Roman von 1864, "Reise zum Mittelpunkt der Erde", leben die Menschen im Untergrund völlig losgelöst von der überirdischen Welt. Dieser Gedanke eines permanenten unterirdischen Lebens entstand zeitgleich mit den Entwicklungen der modernen Wissenschaft und Technik. Mitte des 18. Jahrhunderts hatte der Gedanke, daß die Erde hohl und bewohnbar sei, noch eine Reihe ernsthafter Befürworter. Mit fortschreitendem Wissen wurde die Möglichkeit, eine verborgene innere Welt zu entdecken, immer weniger glaubhaft. Im Zuge der technischen Entwicklung wurde jedoch zugleich die Vorstellung vom Bau einer Welt im Erdinneren immer folgerichtiger.
Die technische Möglichkeit, eine unterirdische Gesellschaft zu errichten, evozierte Befürchtungen, daß die Gesellschaft manipulierbar sei, und verbunden damit die tiefe Angst, die Gesellschaft könne die Technik eines Tages nicht mehr beherrschen. Die Entwicklung der Technik ging weiter, und H. G. WELLS kritisierte, daß unkontrolliertes technisches Wachstum sowie der naive Glaube der Gesellschaft an ein Wachstum um ihrer selbst willen zu einer degenerierten Gesellschaft führen könne, in der man die Arbeiterklasse mißbrauche. WELLS Erzähler in "Die Zeitmaschine" erklärt seinen Lesern aus den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, daß die Entwicklung einer Untergrund-Menschheit zwar eine groteske Vorstellung sein möge, aber "bereits Umstände existieren, die in diese Richtung deuten."
"Es herrscht eine Tendenz, die weniger ansehnlichen Einrichtungen unserer Zivilisation unter die Erde zu verlegen - wie zum Beispiel die Untergrundbahn in London, neue elektrische Bahnlinien oder unterirdische Werkstätten und Restaurants -, und sie vermehren sich und breiten sich aus", schrieb WELLS. "Offenbar, so dachte ich, hatte sich diese Tendenz so weit verstärkt, bis die gesamte Industrie allmählich ihr Recht auf Tageslicht verloren hatte. Ich meine damit, daß sie sich mehr und mehr in Richtung größerer unterirdischer Fabrikanlagen entwickelt hatte, in denen man immer mehr Zeit verbringen mußte, bis endlich zum Schluß...! Lebt denn nicht auch heutzutage ein Arbeiter im Londoner East End unter so unnatürlichen Bedingungen, daß er nahezu vom Leben an der freien Erdoberfläche ausgeschlossen ist?"
WELLS, der die Auswirkungen einer wachsenden Untergrundtechnik auf die Zukunft untersuchte, berührte dabei etwas, was für die Vergangenheit gegolten hatte: Die Arbeiter unter Tage galten im Laufe der Geschichte als minderwertig. Die Sklaven Ägyptens und Roms wurden gezwungen, in den Minen zu arbeiten und zu leben. Im Anschluß an das Mittelalter wurde unterirdisches Leben nur von jenen erfahren, die auf der sozialen Leiter ganz unten standen. Der Untergrund verlor seine "Nährmutter"-Mystik.
Die meisten Untergrundarbeiter waren Leibeigene, Sklaven, Kriminelle oder Kriegsgefangene. Die Arbeit im Bergbau war häufig eine Form der Bestrafung. In fast allen Fällen waren die Arbeitsbedingungen auf krankhafte Weise unmenschlich. In den Vereinigten Staaten arbeiteten Zuchthäusler, Kriegsgefangene und Sklaven bis zur industriellen Revolution im Untergrund, als dererlei Arbeiten, insbesondere im Bergbau, den Einwanderern vorbehalten blieben - den jüngsten und sich zugleich in größter Geldnot befindenden Mitgliedern der Gesellschaft. Die soziale Degradierung der Untergrundarbeiter trägt zur Erklärung bei, warum die Unterwelt schließlich als Gebiet des Leidens und des Todes gefürchtet wurde.
Im 19. Jahrhundert konnten dank der Eisenbahn- und U-Bahntunnel zum ersten Mal die Mittelklasse und sogar die Oberklasse einen Geschmack vom Untergrund gewinnen. Die Erfahrung, von der Natur abgeschnitten zu sein und in eine künstliche Welt einzutauchen, machten damit nicht länger nur die Unterschichten und Außenseiter der Gesellschaft. Je stärker der Untergrund bekannt wurde und zum Wohle der Gesellschaft nutzbar gemacht wurde, um so weniger erschreckend und häßlich war er. Ganz allmählich, als man die Technik zu idealisieren begann - insbesondere mit der Einführung der Elektrizität, durch die die unteren Regionen beleuchtet werden konnten -, betrachtete man die Unterwelt als etwas Abgeschiedenes, aber auch Magisches und Erhabenes.
Einige Autoren rebellierten gegen den Untergrund und die Technik und sahen darin eine Gefahr für die Zukunft der Menschheit. H. G. WELLS setzte seine Geschichten bewußt dazu ein, die Wechselwirkungen zwischen technischem Fortschritt und menschlicher Degenerierung zu thematisieren. In "Die Zeitmaschine" äußert er die Befürchtung, daß Arbeiter zunehmend brutaler werden konnten, wenn ihre Arbeit immer stärker mechanisiert und monotoner wird und dabei das Individuum in einer feindlichen kollektiven Gewalt im Untergrund verschwindet. Er warnt "vor Leuten, die sich in aller Stille entwickeln, in Regionen, die unserer Sicht entzogen sind und in unseren Legenden als unbewohnbar angesehen werden, einer Kraft, die unsere diszipliniertesten Möglichkeiten, Gewalt auszuüben, übertrifft.
Zeitalter mögen noch verstreichen", schrieb WELLS, "bevor unsere unvermeidlichen Zerstörer an das Sonnenlicht gelangen."
In unserer heutigen Welt ist das Wort "Untergrund" mit einem Mosaik zeitgenössischer gesellschaftlicher und politischer Vorstellungen behaftet, wie Revolution, avantgardistische Zeitungen, organisiertes Verbrechen, Linksterrorismus und Drogenhandel. Außerdem gibt es in der Literatur den Begriff vom "Untergrundmenschen", dem ultimativen Abtrünnigen aus der modernen Welt. Der Literaturkritiker Edward F. ABOOD kennzeichnet seinen "Untergrundmenschen" einerseits als Schöpfung des 20. Jahrhunderts, führt uns jedoch andererseits zurück zu Fjodor DOSTOJEWSKIS "Aufzeichnungen aus einem Totenhaus".
"DOSTOJEWSKIS klassische literarische Figur, ein unsterblicher Neurotiker, findet heute mehr Seelenverwandte, als er 1864 gefunden hat", schreibt ABOOD.[1]
Laut ABOOD ist der Untergrundmensch ein Rebell gegen die dominierenden Normen der Gesellschaft, in der er lebt, und gegen die Kräfte, die ihr Fortbestehen sichern. Seine Handlungen, falls er dazu fähig ist, sind im wesentlichen eigenständige. Und wenn er sich einer Gruppe anschließt, engagiert er sich auf subjektive Art und isoliert sich damit. Er weist andere Verhaltensmuster zurück, insbesondere die Wertvorstellungen, nach denen die Mehrheit seiner Mitmenschen lebt. Aus diesem Grund lebt er im Zustand ständiger Anspannung und Angst, die durch sein wahrscheinlich hervorstechendstes Merkmal verschlimmert wird, eine wachsame, und häufig krankhafte Sensibilitat.
Dieser Untergrundmensch ist weit davon entfernt, ein romantischer Held zu sein, insbesondere deshalb, weil sein Ich die Hauptursache seiner Qualen ist. Er ist nicht deshalb isoliert, weil er die Isolation gewählt hat, sondern weil darin seine Bürde und sein Schicksal liegen.
Am charakteristischsten für den Untergrundmenschen erscheint dessen extreme Zurückgezogenheit und Isolation. Er ist ein selbsternannter Exilant aus der menschlichen Gesellschaft, mit der er nur soviel Kontakt aufrechterhält, wie zum Überleben notwendig ist. Die Welt draußen lehnt er ab, aber zugleich hegt er die grundlegende Furcht, daß man ihn in seinem "Mauseloch", wie DOSTOJEWSKI sein Zuhause nannte, vergessen konnte. Obwohl er das Exil für sich gewählt hat, findet er die Gleichgültigkeit, die die Gesellschaft ihm gegenüber zeigt, unerträglich. Seine Wohnung ist kein Zufluchtsort, sie ist eher ein Gefängnis. Er besitzt letzten Endes nichts, an das er glauben könnte. Er leidet unter Qualen, Entfremdung, einem gesteigerten Bewußtsein, das sich auf sich selbst richtet, und der wirkungslosen Wut, unterworfen, mißverstanden und schließlich vergessen zu werden.
Die beste Verschmelzung des metaphorischen und des wahren Untergrundmenschen gelingt Ralph ELLISON mit "Unsichtbar". Er kommt dem am nächsten, wie viele Tunnelbewohner ihre eigene Situation sehen - daß sie von einer Gesellschaft in den Untergrund gedrängt wurden, die sie als verloren, identitätslos ansieht. In ELLISONS Terminologie sind sie "unsichtbar".
ELLISONS Hauptfigur ist ein afroamerikanischer Mann, der erklärt, daß er in der rassistischen New-Yorker Gesellschaft der fünfziger Jahre unsichtbar ist, "weil man mich nicht sehen will". Er kämpft ums Überleben, wird jedoch am Ende von einer Bande in eine stillgelegte Kohlengrube unter den Straßen von Harlem getrieben. Weiße Männer decken den oberen Teil mit einem schweren Eisendeckel ab und setzen ihn so gefangen.
"Man hat das quälende Bedürfnis, sich von seiner Existenz in der wirklichen Welt zu überzeugen, sich zu vergewissern, daß man ein Teil allen Lärms und aller Qual ist, und dann schlägt man mit den Fäusten um sich, flucht und schwört sich, dafür zu sorgen, daß die andern einen erkennen. Aber leider hat das meist keinen Erfolg."
Er kehrt nach oben zurück, beschließt jedoch, daß er tatsächlich in ein "Loch" gehört, weil dies auf ehrlichere und korrektere Weise seine Unsichtbarkeit belegt. "Nachdem ich etwa zwanzig Jahre existiert hatte, wurde ich erst lebendig, als ich meine Unsichtbarkeit entdeckte", erklärt er. Unsichtbar und im Untergrund richtet er sich ein Zuhause ein, zapft Elektrizität ab und lebt. Von dort aus sucht er Vergeltung für die Kurzsichtigkeit der Gesellschaft. Er führt seinen eigenen, unabhängigen Kampf gegen die Gesellschaft und ihre Institutionen, nach seinen eigenen Bedingungen, wie zum Beispiel seinen Stromdiebstahl vom "Light & Power" -Konzern.
"Sie haben den Verdacht, daß Strom abgezogen wird, aber sie wissen nicht, wo. (...) Vor vielen Jahren kaufte ich wie jeder andere ihren Strom und zahlte ihre unverschämten Preise. Aber das tue ich heute nicht mehr. Das habe ich längst aufgegeben, wie ich auch meine Wohnung und meine alte Lebensweise aufgegeben habe, die auf der trügerischen Annahme beruhte, ich wäre, wie alle anderen Menschen, sichtbar. Nachdem ich jetzt weiß, daß ich unsichtbar bin, wohne ich umsonst in einem Haus, das aus schließlich an Weiße vermietet ist, in einem Teil des Kellergeschosses, das während des 19. Jahrhunderts zugebaut und vergessen wurde..."
Gibt er seine Verantwortung für die Menschheit auf?
"Verantwortungslosigkeit gehört zu meiner Unsichtbarkeit. Wie man sie auch betrachtet, sie ist Verneinung. Aber wem gegenüber sollte ich verantwortungsvoll sein, und weshalb sollte ich es sein, wenn kein Mensch mich sehen will? Man wird schon noch erfahren, wie sehr ich ohne Verantwortung bin. Verantwortung beruht auf Erkennen, und Erkennen ist eine Form der Zustimmung."
In einem Textabschnitt, in dem die Tunnel der heutigen Obdachlosen Widerhall finden, weil hier die Gründe dafür artikuliert werden, warum sie ihren Frieden im Untergrund suchen, besteht ELLISONS unsichtbarer Mann darauf, daß er weder aus Furcht noch aus Selbstmitleid unter die Erde gegangen sei.
"Ich habe ein Zuhause gefunden - oder eine Höhle in der Erde, wenn man wo will. Aber man hüte sich vor dem Schluß, mein Heim sei feucht und kalt wie ein Grab, weil ich es Höhle nenne. Meine Höhle ist warm. (...) Meine Höhle ist warm und voller Licht. Ja, voller Licht. Ich glaube nicht, daß es in ganz New York, den Broadway eingeschlossen, einen helleren Ort gibt. Das gilt auch für das Empire State Building in der Traum-Nacht eines Fotografen. Das ist bewußte Täuschung. Die zwei genannten Orte gehören zu den dunkelsten unserer gesamten Zivilisation."
ELLISON beendet sein Buch damit, daß sich der unsichtbare Mann entschließt, so lange im Untergrund zu bleiben, bis man ihn dort herausjagt. "Hier konnte ich wenigstens versuchen, die Dinge in allem Frieden, und wenn nicht in Frieden, so doch in Ruhe zu überdenken. Hier, unter der Erde, würde ich meinen Wohnsitz aufschlagen. Das Ende lag im Anfang."
Anmerkung
[1] Obwohl viele seiner Merkmale und Eigenschaften jahrhundertealt sind, ist ihre Synthese zu einem Untergrundmenschen eine moderne Entwicklung. Er ist im wesentlichen die Reaktion auf Kräfte des vergangenen Jahrhunderts. HEMINGWAYS Jake Barnes, KAFKAS Angestellte, HESSES Steppenwolf waren alle Untergrundmenschen ebenso wie SARTRES einsame Existentialisten, CAMUS' absurde Figuren, ELLISONS unsichtbarer Mann und KOESTLERS Rubaschow, betrogen vom kommunistischen Gott, den er sich selbst geschaffen hatte. Trotz der enormen Unterschiede zwischen den einzelnen Figuren sind ihnen allen deutlich Merkmale des Untergrundmenschen eigen.
aus: Toth, Jennifer: Tunnelmenschen. Das Leben unter New York City. Aus dem Amerikanischen von Sylvia Klötzer. Mit Fotos von Margaret Morton. Berlin: Chr. Links Verlag 1994, S. 180 - 190. (264 S., 8 Fotos, DM 48,--. ISBN 3-86153-079-1.)
H.P. Karr & Walter Wehner
Berbersommer
Zehn
nach zehn. Der Zeiger der Normaluhr springt einen Strich weiter. Zeit, sich im Kaufhaus zu waschen und zu kämmen. Auf dem Weg durch die Bahnhofshalle fischt Kurt eine WAZ aus dem Papierkorb. Der Schwarze aus Ghana nickt ihm kurz zu und packt seine Gürtel und Ketten auf den Tapeziertisch. Hinten bei den Schließfächern sieht er Max unter seinen Zeitungen liegen. Er läßt ihn pennen, fährt die Rolltreppe runter, schlängelt sich zwischen den Frauen und Schulkindern zum Fahrstuhl neben dem Supermarkt durch. Bei Horten auf der Restauranttoilette gibt es warmes Wasser, Seife und Stoffhandtücher. "Guter Service." Kurt grinst und stellt seine Untertasse auf die Ablage am Waschbecken und das Schild mit der Aufschrift "Danke - die Klofrau".
Max liebt Männer mit Hut. "Ej, hasse mal ne Zichte für mich?"
"Wie bitte?"
"Ej, ne Zigarette, Mann. Ich hab seit zwei Tagen nix mehr zu rauchen gehabt."
"Ich weiß nicht..."
"Mann, du wirst doch wohl mal ne Zichte abgeben könn, oder watt?"
"Ja ... Natürlich ... hier."
"Ich nehm mal gleich noch eine, für nachher, okay?"
"Ich ... "
"Bisten tofften Kumpel, Mann. Haste Feuer?"
"Was?"
"Streichhölzer, Mann!"
"Ja ... hier ... nehmen Sie ... tut mir leid ... ich muß weiter ..."
Max steckt sich eine Zigarette an und verstaut die andere mit dem Streichholzbriefchen im Unterfutter der Jacke. Hinten an den Schließfächern kontrollieren die Bahnbullen seinen Schlafplatz. Max macht sich dünne. Ab durch die Bahnhofshalle, die Rolltreppe rauf zur Galerie. Er filzt die Papierkörbe und findet ein wunderschönes Ticket Köln-Essen, gerade erst abgefahren.
"Na, wer sagt's denn!"
Neun
Telefonzellen hat Kurt schon abkassiert auf seiner Runde. Er schiebt sich in den gelben Glaskasten hinterm Saalbau. Ein Drahthaken, ein paar Handgriffe, und die von ihm eingebaute Sperre in der Geldrückgabe läßt sich mühelos herausziehen. Markstücke und Groschen klingeln in die Schale. Kurt zählt glatte neun Mäuse; nicht schlecht für die Gegend. Er bringt die Klemmvorrichtung wieder am Apparat an, durchquert den Stadtgarten. Weiter unten an der Huyssenallee hat jemand seinen Trick durchschaut. "Nicht mal ein falscher Fuffziger, so ein Mist!" Kurt flucht, stemmt sich gegen den kalten Wind und hofft, daß sich keine Konkurrenz breitmacht: das hier ist sein Revier.
Auf dem Bahnsteig ist Großreinemachen. Doppelstreife. Max hockt in der Telefonzelle, seit einer halben Stunde schon. Fur die Jahreszeit ist es schon verdammt frisch.
"He, das ist kein Hotel hier!"
"Ich wart auf meinen Zuch! Wird man ja wohl noch dürfen."
Der Bahnbulle grinst. "Quatsch nich rum. Runter vom Bahnsteig."
"Ich hab ein Recht ..."
"Einen Scheiß haste. Ohne Fahrkarte."
"Klar hab ich ne Fahrkarte." Max wedelt mit dem Ticket.
"Erste Klasse? Für wie doof hältste uns eigentlich?" Der Bulle zerfetzt das Ticket. "So, und jetzt Abmarsch. Aufwärmen kannste dich unten im Tunnel bei der EVAG."
"Ich wollt mich ehrlich nur'n Moment ausruhen ..."
"Klar ... Raus da ..."
"Die Beine ... ich habet doch anne Beine. Alles offen von dem Ekzem ..."
"Los jetzt, dein Zug ist abgefahren."
Der Bulle paßt auf, bis Max vom Bahnsteig ist.
Acht
Straßenzüge weiter hat sich seine Laune wieder gehoben und die Manteltaschen sinken unter dem Gewicht der vielen Münzen bis fast an die Kniekehlen. Unter der Grugabrücke hat er zwei Heiermanner aus dem Schacht geprockelt und fast eine Handvoll Groschen. Die Schickimickis hier im Südviertel schwimmen eben nur so im Geld. Kurt sortiert seine Einnahmen; die Pennystucke und Peseten, mit denen manche die Post bescheißen, wandern in ein extra Portemonnaie. Er muß sie vorsichtig verteilen - an den alten Zigarettenautomaten aufder Rüttenscheider und den halbblinden Rentner in seiner Trinkhalle in Frohnhausen. An der Frittenbude genehmigt sich Kurt eine Frikadelle und eine Flasche Pils Dann verzieht er sich in die Tiefgarage vom Landgericht und hält auf dem Lüftungsgitter ein Nickerchen. Wenn einem das Gebläse so die warme Luft um die Nase fächelt und man die Augen schließt, kann man fast denken, daß man in der Toskana sei.
Unten im Tunnel ist alles voller Straßenbahner.
"He, du gehn weg!" Der Braunhäutige auf dem Bock der Reinigungsmaschine wedelt mit der Hand.
"Was willst du, du Kanacker?"
"Muß putzen. Du muß weg!"
"Ich hau dir gleich was vor die Mappe!"
Der Motor der Reinigungsmaschine heult auf und Max sieht zu, daß er Land gewinnt.
Sieben,
hat der Bulle gesagt, Sie müssen die Straßenbahn Nummer Hundertundsieben vom Rüttenscheider Stern nehmen, die geht bis Katernberg. Kein Freund und Helfer, denkt Kurt, aber auf eure Ortskenntnisse ist immer Verlaß. Was soll ich mir bei dem Umsatz die Füße breitlatschen? Die Elektrische schaukelt ihn zurück in die Innenstadt. Vor ihm hockt ein Negerpärchen. Wenn das nicht doppelt Glück bringt. Er wird das Ding also heute starten: das ist sein Tag.
"Ej, Junge, hasse mal Feuer?"
"Klaro, Mann!" Aus dem Zippo zuckt ein Ding wie beim Flammenwerfer und der lange Lederjackentyp wiehert los. Sein kleiner Kumpel kriegt ein böses Grinsen.
"Wohl wahnsinnig, watt?"
"Aber immer!" Der Lange pflückt Max den Stummel von den Lippen und zermatscht ihn unterm Stiefelabsatz. "Jetzt kannste ihn kauen."
"Meinen auch!" Der Kleine rülpst und Max kriegt die Spucke ins Gesicht.
Der Lange zippt das Zippo unter Max Kinn an. "Was meinste, wie lange der brennt?"
Er drängt Max bis ans Schaufenster vom Kaufhaus. Max rutscht mit dem Rücken an der Scheibe runter und spielt toter Mann.
Sechs
Richtige oder einmal den Jackpot knacken; Kurt glotzt auf die Schokoladenauslage vom Café Overbeck. Der Sarottimohr aus dem Schaufenster starrt zurück. Nur ein einziges Mal richtig absahnen und dann ab in die Toskana. Er rülpst dem Otto vom Lotto auf dem Plakat seine Meinung rüber und bezieht Posten vor dem Pornokino. Die reinste Goldader; fast jeder Typ, den er anschnorrt, rückt was raus. Sie drücken ihm die Silberlinge nur so in die Pfote, wenn er sie beim Rauskommen anquatscht und ziehen möglichst rasch Leine.
Penta
gramm der Triebe heißt der Streifen, den sich die Kerle rein ziehen. "He, du da!" - der Kartenverkäufer zwängt sich aus seinem Kabuff und kommt drohend auf ihn zu. Kurt verduftet um die Ecke, nur jetzt keine Scherereien mehr. Heute Abend, wenn sein Ding steigt, muß er topfit sein. Sein Magengeschwür meldet sich schmerzhaft und er nimmt einen kräftigen Schluck aus dem Flachmann.
"Gib mal die Bombe ruber!"
Kurt gönnt sich einen langen Schluck aus der Zweiliterflasche. "Scheiß Kälte! Hier kannste nicht bleiben."
Sie sitzen unterm Denkmal am Burgplatz. Max behält den Eingang vom Münster im Auge.
"Haste was zum Pennen?"
"Weiß noch nicht. Hab noch was vor."
"Scheiße auch. Gib mal die Bombe."
Max setzt die Flasche an.
"He, datt is mein Stoff. Wohl verrückt geworden oder watt?"
"Das wird kalt heut nacht. Da braucht der Mensch was Warmes."
"Aber nicht auf meine Kosten."
Max schielt rüber zum Eingang vom Münster. Der Rotwein brennt ihm im Magen und macht ihn schwindelig.
"Italien", murmelt er. "Toscana! Da müßte man jetzt sein. Ganzen Tach in der Sonne liegen!"
"Da sachste watt!" Kurt macht die Augen zu. "Oben anner Volkshochschule gibt's ne Tiefgarage!" murmelt er. "Mußte halt mal sehen, wie du mit dem Hausmeister und seinem Köter zurechtkommst."
Max sagt nichts. Untem am Münster schließt ein Kaplan die Kapelle ab.
Kurt rappelt sich auf. "Also dann. Man sieht sich!"
Max krallt sich die Bombe und zieht sich den letzten halben Liter rein.
Wenn schon, denn schon!
Vier
Minuten: Kurt schafft die Strecke von der Spielhalle im Basement des Bahnhofs bis rauf auf den Bahnsteig im Spurt in genau vier Minuten. Er hat das x-mal geprobt. Die Rolltreppe ist nachts meist leer, und auf dem Bahnsteig ist dann auch niemand mehr. Der D-Zug auf Gleis vier geht um 22.34 Uhr ab: über Köln, Frankfurt, München, bis nach Rom.
"Kann ich Ihnen helfen?"
Max riecht was Süßes. Wie Blumen.
"Geht es Ihnen nicht gut?"
Max fühlt eine Hand.
"Was ist denn mit Ihnen?"
Die Frau stippst ihn mit den Fingerspitzen an die Schulter, als hätte er etwas Ansteckendes. Max hängt in einem von den tiefen Ledersesseln im Foyer der Volkshochschule. Durch die deckenhohe Glasfassade gegenüber sieht er Schneeregen durch die Nacht treiben. So eine Scheiße aber auch.
"Ich hab Sie schon vor drei Stunden hier gesehn!" Das ist wieder die Frau. "Kann ich..."
Max rülpst.
"Hören Sie, wir schließen gleich. Sie können hier nicht..."
"Aber wo soll ich denn hin?" Max glotzt ins Neonlicht, bis ihm die Tränen kommen. Dann rappelt er sich hoch. "Nichts für ungut..." Seine Beine knicken weg.
Die Frau hat die Hände vor die Brust gepreßt. "Was haben Sie denn? Sind Sie krank?!"
"Krank? Ich bin kaputt, Frau ... Das ganze Bein ... war nur noch Matsche ... Betonplatte draufgefallen, auffem Bau ..."
"Mein Gott, wie schrecklich."
"Ich warn guter Maurer. Das müssen Sie mir glauben! Bloß mit dem Bein ... halbes Jahr Krankenhaus ... Job weg ... Wohnung gekündigt. Ich weiß nich wohin, Frau ..."
Aber..."
"Ich bin fertig. Fix und alle. Ich lieg auf der Straße. ..." Er will sich wieder hochrappeln. "Nichts für ungut, Frau ..."
Ehe er wieder zusammenklappt, hat die Frau ihn in den Stuhl zurückgedrückt. "Bleiben Sie mal sitzen. Ich telefonier mal eben. Sie wollen doch Hilfe, oder?"
"Mir hilft doch sowieso keiner ... Die wollen mich anstecken."
"Anstecken? "
"Die Glatzköppe im Bahnhof. Die wolln mich verbrennen..."
Drei
Groschen kann er noch riskieren. Kurt steckt sie in den Schlitz des Rotamint, hält beide Fäuste vor das Sichtfenster und wartet gespannt auf das elektronische Gedudel. Gewonnen: dreimal die Krone - es rattert, es klackert, es klappt wie am Schnürchen.
"Aber...", sagte die Frau ins Telefon und spielt nervös mit ihrem Kugelschreiber. Aus dem Hörer quakt eine Männerstimme. Die Frau sieht zu Max heruber. Der hockt zusammengesunken auf dem Stuhl vor ihrem Schreibtisch.
"Aber", sagt die Frau wieder. "Der Mann ist..."
Max langt nach dem Kaffee, den sie ihm eingegossen hat und verschüttet die Hälfte, als er trinken will.
Die Frau legt den Hörer auf. "Das war die Krisenhilfe. Kein Bett frei."
Max sieht sie an.
"Die Notaufnahme im Klinikum ist nicht zuständig, die Caritas hat zu..."
"Ich kann nich mehr", jammert Max. "Ich geh zurück zum Bahnhof!"
Er rappelt sich hoch. "Ich schmeiß mich vorn Zuch. Ich mach Schluß."
Die Frau wird ganz blaß. "Das konnen Sie doch nicht machen..."
"Ist doch egal, oder?"
"Aber ..."
"Was hab ich denn noch? Ich bin total kaputt. Ich hab'n kaputtes Bein, meine Leber is fertig von der Sauferei, ich hab keine Wohnung, ich hab doch gar nichts mehr."
"Ich könnte es ja mal bei der Polizei probieren. Oder werden Sie ..."
"Ich bin'n ehrlicher Mensch."
"Schon gut, ich glaub ihnen ja!"
Zwei
Gäste noch in der Spielhalle; Kurt schielt nervös auf die Uhr: na endlich - jetzt nur die Ruhe behalten. Der Opa hinter der Kasse blickt in den Lauf von Kurts King-Kobra-Spielzeug-Colt und kann gar nicht schnell genug die Taler ruberschieben.
"Na, wo ist denn der Kandidat?"
Max hat schon seinen zerfledderten Personalausweis rausgezogen. Der große Bulle blättert ihn kurz durch. Sein Kollege drückt sich am Fenster rum. Draußen schneit es jetzt. Die Frau steht am Schreibtisch.
"Und du willst also die große Biege machen, eh?"
Max zieht die Nase hoch. "Ach Scheiße", sagt er.
Der Kleine beugt sich zu ihm runter. "Wieviel hast du denn drin?"
"Eine Flasche, zwei Flaschen ... weiß nich ... Ich schmeiß mich vorn Zuch. Auffem Bahnhof. Gleis zwei."
"Wohnung haste auch nicht, was?"
"Ich hab gar nix mehr."
Der Kleine guckt den Großen an. Der zuckt mit den Schultern.
"Okay", meint er dann. "Notaufnahme Klinikum, ja?"
"Die stecken ihn erstmal in die Geschlossene." Der Große grinst die Frau an. "Damit er sich nichts antun kann." Er schaut runter zu Max. "Und dann kommst du auf Entzug, mein Freund. Willst du das wirklich?"
Max nickt stumpfsinnig. "Ich geh freiwillig innen Entzuch. Ich will nix mehr mit den Sachen zu tun haben."
"Na dann. Abmarsch!"
Im Fahrstuhl nehmen sie ihn in die Mitte.
"Und nicht, daß du im Klinikum Blödsinn machst, klar?"
Max schüttelt den Kopf. "Ich sach doch, ich brauch'n Arzt. Ehrlich."
"Hast Glück, daß der Ewald heut seinen Moralischen hat!"
"Sonst war das höchste der Gefühle fur dich ne S-Bahn-Karte nach Mülheim gewesen."
"Oder ne kleine Spazierfahrt im Streifenwagen!"
Eins
weiß Kurt genau, als er durchs Basement zur Rolltreppe rast: Er hat die Kohlen in der Tasche und das ist die Chance seines Lebens, das ist die Freifahrt nach oben.
Der Arzt guckt Max an, als würde er ihn am liebsten erst desinfizieren, bevor er ihn anfaßt. Max hockt auf einem Stuhl vorm Schreibtisch und muß sagen, wer er ist und warum er sich umbringen will. Dann liegt er auf der Liege und der Arzt fingert an ihm rum. "Unter drei Monaten läuft hier nichts, das sag ich Ihnen am besten gleich."
"Mir is alles egal."
"Na, dann kommen Sie mal."
Max schnappt seine Klamotten und trottet hinter dem Arzt her.
"Erst Entgiftung, dann Therapie und dann sehn wir weiter!" Der Arzt macht eine Tür auf. "Ihr Zimmer!"
Max geht rein. Leer. Nur eine Matratze lehnt an der Wand. "Morgen früh um sieben ist Untersuchung!" sagt der Arzt.
Max sagt nichts.
"Um sieben hab ich gesagt!"
"Jawoll!"
Der Arzt macht die Tür hinter sich zu. Innen ist keine Klinke.
Max haut sich aufs Bett und starrt auf das kleine Fenster unter der Decke. Die Schneeflocken tanzen vor dem Nachthimmel. Das wird schweinekalt heute Nacht.
Max fischt die Zigarette und das Streichholzbriefchen mit der Reisebüroreklame aus dem Jackenfutter. Max raucht und denkt an den Kurt.
Er jedenfalls hat's erstmal geschafft. Drei Monate, hat der Arzt gesagt. Im Frühjahr, wenn er hier wieder rauskommt, geht's ab in die Toskana.
Kalter Wind weht über den Bahnsteig. Der Expreßgutfahrer ist blaß, als er auf Kurts verdrehten Körper starrt, dann fummelt er an seinem Sprechfunkgerät.
"Ja, genau in die Karre gelaufen...", stammelt der Fahrer. "Gleis vier... nein, ich hab ihn voll erwischt. Der ist platt, total auf
Null."
aus: H.P. Karr & Walter Wehner: Berbersommer. Kriminalgeschichten aus der Großstadt. Essen: A4 Verlag GmbH 1992, S. 27 - 37.
A4 Verlag GmbH, Rüttenscheider Str. 137, 45130 Essen
Michael Holzach
"Betteln ist schwerer als arbeiten"
Er nennt sich Gustav, ist "um die 45 rum" und "seit Dien Bien Phu auf der Rolle". In einem grau-schwarzen Mantel hockt er in brütender Hitze vor dem Franziskaner-Kloster in Paderborn, den linken Unterschenkel in einem Luftschacht versteckt, eine Zigarrenkiste mit ein paar Groschen vor sich. Er macht "Stichmaloche", er bettelt. Ab und zu wirft jemand Kleingeld in den Kasten. Meist sind es Gastarbeiter, denn "Deutsche geben nur zur Weihnachtszeit", sagt Gustav, der Penner.
Nach knapp drei Stunden hat er drei Mark achtzig für eine "Bombe" Rotwein zusammen. "Ich brauch das Zeug, damit ich schlafen kann ohne zu träumen", sagt er, "denn Träume sind furchtbar."
Der gebürtige Erzgebirgler ist in einem Waisenhaus in Zwickau groß geworden, nach dem Krieg wurde er "vom Russen ins Zinnbergwerk gesteckt". 1948 packte ihn die Abenteuerlust. Er ging in den Westen und meldete sich bei der Fremdenlegion. Die Stationen der folgenden Jahre lassen sich eintätowiert auf seinen Unterarmen nachlesen: "Algier, Saigon, Battambang, Hanoi, Dien Bien Phu." Mit einem Steckschuß im Oberschenkel kam Gustav 1955 "heim ins Reich" und "seitdem nicht mehr zur Ruhe".
Jedes Jahr zieht der kleine drahtige Mann sechs- bis achtmal kreuz und quer durch die Republik, zu Fuß, per Anhalter und gelegentlich mit dem Zug und einer "Bahnbenutzungsgenehmigung" des Sozialamtes, immer unterwegs von einem der 700 Übernachtungsheime und Herbergen ("Pennen") zur nächsten, immer auf der Suche "nach was Weichem unterm Arsch und was Warmem im Bauch".
Vierzehn Tage waren wir mit Männern wie Gustav "auf der Walze": Als Penner verkleidet, das Nötigste in ein paar Plastiktüten verstaut, zogen wir mit den Tippel- und Wermutbrüdern, den "Berbern", wie sie sich selber nennen, "Nichtseßhaften" also, über die Straßen.
Victor, die "Ratte", aus Köln treffen wir, als er mit einer alten Einkaufstasche um ein Uhr morgens Papierkörbe nach Lebensmitteln und Zigarettenkippen durchwühlt. Von den Abfällen der Kölner lebt Victor "seit ich das letzte Mal aus dem Knast bin", das ist, sagt er, nun schon vier Jahre lang. Damals mußte er wegen wiederholten Kaufhausdiebstahls und Körperverletzung ins Gefängnis.
Auf der Mülldeponie des Kaufhofs findet er eine Kiste angegorener Sahnejoghurts, und aus den Abfalleimern italienischer Restaurants klaubt er trockene Pizzaränder, die mit Wasser eingeweicht jenen Brei ergeben, der Victor bei Kräften hält.
Victor haust mit drei anderen Berbern in einer abbruchreifen Fabrik in der Nähe des Rheins. Wenn die Polizei von der "Platte", seinem Nachtquartier, Wind bekommt, zieht er um: in die nächste Ruine, in den nächsten Rohbau. Im Gegensatz zum Landstreicher Gustav, der ohne die Almosen der Nichtseßhaftenhilfe - in den Sozialämtern, Herbergen und Bahnhofsmissionen - nicht leben könnte, betont Victor seine scheinbare Unabhängigkeit: "Mir wird nix geschenkt. Betteln hab ich bis oben. Das hab ich mit meinen zwölf Geschwistern getan, um von der Mutter mehr Speck und vom Vater weniger Prügel zu kriegen. Gebettelt hab ich beim Chef, auf'm Bau, um nicht rauszufliegen, dann im Sozi (Sozialamt) wegen der paar Mark Unterstützung und schließlich beim Pfaffen um einen Teller Suppe. Es hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich kapiert hab, daß wer unten ist, im Keller bleibt. Jetzt hab ich zwar nix Bares in der Kralle, aber ich bin selbständig. Und wer mir krumm kommt, der kriegt einen drauf!"
Nach vierzehn Tagen Walze verstehen wir Victor. In unseren schäbigen Klamotten werden wir auf der Straße mißtrauisch betrachtet. Als wir, unrasiert und demütig, nach dem Übernachtungsheim fragen, wettert ein älterer Mann in Celle mit erhobenem Regenschirm: "Euch sollte man in die Gaskammer stecken, statt auf Staatskosten zu verpflegen."
Von freier Kost und Logis ist in der Celler "Herberge zur Heimat" nicht die Rede: "Wenn ihr hier pennen wollt, dann will ich Bargeld sehen", sagt Herbergsvater und Diakon Herbert Außner, 63, gleich bei der Ankunft. "Die Übernachtung kostet 1,30, die Flasche Bier 1,10."
Da über die Hälfte der Nichtseßhaften Alkoholiker ist, gehört die "Penne" in Celle nach Auskunft der lokalen Schilling-Brauerei "zu unseren besten Kunden". Tag und Nacht läßt der Diakon das Bier von den vier Kalfaktoren im Drei-Schichten-Dienst unter die Leute bringen. Bis zu 1000 Kisten "Meister-Pils" werden hier nach den Angaben der Hausgehilfen im Monat umgesetzt. Gewinnspanne pro Kiste: 9,60 Mark. Die Folge: nächtliche Schlägereien, Schnapsleichen in den verdreckten Schlafräumen und Gestank. Damit die Kasse stimmt, vermittelt Herbergsvater Außner (Spitzname "Sklavenhändler") Gelegenheitsarbeiten an seine Gäste. "Knochenmaloche, für fünf oder sechs Mark die Stunde ohne Unfallschutz und Krankenversicherung". wie mein Bettnachbar Paulemann sagt. Wegen Paulemann kann ich in Celle kaum schlafen; er schreckt mehrmals in der Nacht auf und brüllt im Traum um Hilfe. Die anderen Berber behaupten, die zwei Jahre als Wachmann in Treblinka säßen ihm noch heute in den Gliedern.
Superintendent Karl Manzke, 46, Vorstandsmitglied des Vereins Herberge zur Heimat in Celle, verteidigt den Alkoholausschank an die Penner: "Die Leute werden doch derartig diskriminiert. daß keine andere Freizeitgestaltung möglich ist." Was die Berber nicht wissen: Sie trinken für eine gute Sache. denn "jeder Pfennig, der in der Herberge erwirtschaftet wird, wandert in die Finanzierung des neuen therapeutischen Heims".
Was in Celle erst für das Jahr 1977 geplant ist - eine therapeutische Herberge -, das soll es im "Perthes-Haus" in Hamm schon seit Jahren geben: ein Heim, in dem "in einer differenzierten arbeitstherapeutischen Wiedereingliederungswerkstatt echte Resozialisierung betrieben wird". Im Gegensatz zur Herberge in Celle, wo neben 50 Nichtseßhaften auch noch 50 Rentner unter einem Dach hausen, wird in Hamm streng getrennt: Auffangstation für Neuankömmlinge; Übergangsabteilung für diejenigen, die sich in arbeitstherapeutischer Behandlung befinden: Wohnheim für Männer mit fester Arbeit und Altenheim.
Und streng sind hier auch die Sitten: Nach der knappen und korrekten Aufnahme: "Dein Ausweis? Woher? Wohin?" (an das Geduztwerden haben wir uns schnell gewöhnt) führt uns der Kalfaktor in den Keller zum "Abbienen". Wir müssen uns bis auf die Hose ausziehen und die Innenflächen von Hemd und Unterhemd nach außen krempeln. Dann fährt der Hausgehilfe mit einer Lampe dicht über die neuralgischen Zonen: Achselbereich und Kragen. Doch es rührt sich nichts - wir haben noch immer keine Läuse. Anschließend geht es unter die Dusche. Unsere Zimmer liegen gleich neben dem Duschraum. Fließend Wasser auch hier: die Wände herunter. 16 Personen teilen sich hier drei kleine naßfeuchte Räume. Aber: Es gibt frisches Bettzeug.
Im Perthes-Haus wird Ordnung großgeschrieben: Bier, in Celle unser täglich Brot, ist "strengstens verboten". Ebenso "rauchen auf den Zimmern". Wer das Haus verlassen will, muß "Abgang" und "Rückkehr" beim Pförtner minutengenau zu Protokoll geben. Besuch - nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Leitung.
Es ist 18 Uhr. Ein Gong ertönt. "Essenfassen!" Im Speisesaal stehen etwa 70 Penner um die Tische herum. Auf das Kommando "setzen" fällt der Saal wie ein Mann auf die Stühle. Nach sieben Minuten ist die Graupensuppe verschlungen, sind die Margarinebrote hinuntergewürgt. Gebetet wird heute nicht.
Der Mann, der beim Essen den Takt angibt, ist Klaus Dieter Hartmann, zuständig für die Arbeitstherapie in den Werkstätten. Ich frage Hartmann, ob ich hier arbeiten könne, da ich genug hätte von der Tippelei. Die Zigarre zwischen den Zähnen, antwortet er mir: "Wenn du hier was tun willst, dann stecken wir dich erst mal sechs Wochen in die Klammern, damit wir wissen, was für ein Windei du bist."
Gert aus Dortmund, Mitte 30, schon seit sechs Monaten ohne Gelegenheitsarbeit und seit der Scheidung vor neun Jahren "auf der Flucht vor mir selber", schildert die Folgen, die das Zusammensetzen der Wäscheklammern, einer typischen Herbergsbeschäftigung, hat: "Nach drei Stunden bluten dir die Fingerspitzen, nach drei Wochen spürste nix mehr, dann ist dat Gefühl raus." Geklammert wird im Akkord, für 1000 Klammern gibt es eine Mark. Spitzenverdiener bringen es auf 2,60 Mark am Tag. "Wenne dat vier Wochen mitgemacht hast, dann weißte, warum ich froh bin, schon morgen wieder die verdammte Landstraße unter den Schuhsohlen zu spüren."
Am nächsten Morgen verlassen wir mit Gert die Herberge und trampen und tippeln ein paar Tage gemeinsam durch die "Pennerszene" Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens.
In der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf bei Bethel schlafen wir zu acht wie die Heringe in muffigen Duschkabinen, jeder den Kopf über einem Abflußloch.
Im städtischen Übernachtungsheim in der Dortmunder Steinstraße, einem ehemaligen Gefängnis aus der Nazizeit, hat jeder eine Zelle. "Einzelhaft kriegen sonst eigentlich nur Stammkunden", sagt Gert und wundert sich.
Und im Übernachtungsheim des DRK in Gütersloh scheucht uns Heimleiter Rudolf Krebs, 60, volltrunken aus den Betten und durchsucht das Gepäck von "euch versoffenen Arschlöchern" nach Alkoholika. Kein Berber muckt auf. "Der kann sich dat erlauben", sagt Gert, "der ist ein normaler Mensch."
Ähnliche Erfahrungen mit den "normalen Menschen" machen wir jeden Tag. In Paderborn sprechen wir beim Pfarrer der Markt-Kirche, Wilhelm Jürgens, vor, und Gert läßt seine Platte laufen: "Wir sind auf der Durchreise und bitten um eine kleine Unterstützung." Der Pfarrer antwortet durch den Türspalt: "Für mich seid ihr gottserbärmliche Schufte."
Gert erlebt solche Demütigungen häufig. Er sagt, daß "betteln schwerer ist als arbeiten, besonders heute, wo durch die Krise die Konkurrenz immer stärker wird, alle sparen müssen und die Jugend nach vorn drängt". Gert muß sich daher nach neuen Geldquellen umsehen. Er fährt zum Beispiel alle zwei Monate nach Köln, wo selbst Personen ohne festen Wohnsitz Blut spenden dürfen. Jeden Mittwoch ist hier "Berbertag". Bis zu 300 Tippelbrüder stehen dann morgens um 6 Uhr vor der "Abteilung für Transfusionswesen" Schlange, um für "400 Kubik Berberblut 40 Deutsche" zu kassieren. Dr. Doris Schulten, Ärztin der Klinik: "Wir sind auf die Nichtseßhaften angewiesen."
Gert hat sein Überleben auf der Straße organisiert. Weil man in den meisten Heimen nur noch alle sechs bis zwölf Monate übernachten darf - es sei denn, man arbeitet für ein bis zwei Mark pro Tag -, trägt er in sein Notizbuch genau ein, wann er wo war und wann er wiederkommen kann: "Dienstag: Koblenz, Mittwoch: Bonn, Donnerstag: Düsseldorf." Gert nennt das "Sozialtourismus".
Mit dem Märchen vom Romantiker der Landstraße, der frei und sorglos unter der schattigen Birke liegt, die Feldblume zwischen den Lippen, hat sein Leben nichts zu tun. "Solche Typen sind die ganz große Ausnahme. Die meisten von uns wollen nicht auf die Straße, sie müssen, weil sie vor sich selbst und den anderen auf der Flucht sind. Deshalb sind die meisten Berber auch Einzelgänger, die keinem trauen."
Über die Ursachen dieser Flucht tappt Gert ebenso im dunkeln wie die zuständigen Wissenschaftler. Selbst in der Randgruppenforschung wurden die Penner bisher benachteiligt. In den Ausbildungslehrplänen der Sozialarbeiter rangiert die "Nichtseßhaftenhilfe" meist ganz unten. Trinkerheilanstalten und psychiatrische Heilstätten können den Tippelbrüdern nicht helfen, weil es keine angemessenen Therapien gibt. Erst in jüngster Zeit bemühen sich verschiedene Forschungsgruppen, Versäumtes nachzuholen. Die Bundeszentrale für Nichtseßhaftenhilfe in Bethel betreibt mit Bundesmitteln ein Forschungsprogramm, um der Genese des Problems auf die Spur zu kommen.
Da überregionale Daten bisher fehlten, wurden zunächst in einer bundesweiten Erkundungsstudie 520 Nichtseßhafte in eigener Sache befragt. Ergebnis: Die überwiegende Mehrheit der Befragten (83,9 Prozent) gehört der Unterschicht an, ist ledig (57,9 Prozent) oder geschieden (32,6 Prozent) und war nach eigener Aussage mindestens schon einmal straffällig geworden (70,5 Prozent). Fast jeder dritte (32,5 Prozent) ist in den ehemaligen deutschen Ostgebieten geboren (Bundesdurchschnitt 1970 16,5 Prozent). In Nervenkliniken waren 15 Prozent.
Da ein weit größerer Anteil der Bevölkerung ähnliche sozialökonomische Bedingungen wie Scheidung, Flucht oder Vorstrafen kennt, ohne nichtseßhaft zu werden, ist ein kausales Verhältnis zwischen den biographischen Daten als Ursache und der Lebensform als Wirkung kaum zu vertreten. Dr. Johannes Wickert, 31, Projektleiter der Nichtseßhaftenforschung am Psychologischen Institut der Tübinger Uni, glaubt zu den Umwelteinflüssen bestimmte psychische Konstitutionen kommen, die einander wechselseitig bedingen". Psychologische Untersuchungen mit den Nichtseßhaften haben ergeben, daß Situationen, die einen gewissen Grad von Verbindlichkeit bekommen, von den Berbern als unerträglich empfunden werden. "Zwar wird die Bindung an oder jemanden oft von dieser Personengruppe als wichtigstes Ziel genannt", so Wickert, "doch wenn das Gewünschte konkret wird, scheint es Anlaß zur Angst und Flucht zu sein."
Zu dem auffälligsten statistischen Merkmal der Tippelbrüder gehört, daß sie keine "Schwestern" haben. Nur drei bis fünf Prozent aller Nichtseßhaften sind Frauen. Geraten Frauen in jene Situationen, welche die Männer auf die Landstraße treiben, landen sie oft auf dem Strich. Deshalb leben auch die wenigen weiblichen Nichtseßhaften meist in den Städten.
In Düsseldorf, wo bei der Polizei 4000 Stadtstreicher registriert sind, treffen wir Marie - klein, krummbuckling, mit struppigem Haar und fettbeschlagener Brille. Sie ist 53, sieht aus wie 75 und sitzt seit drei Wochen auf einer Bank am Schwanenmarkt, einem Park vor dem Landtagsgebäude. Nachts zieht sie den Mantel über den Kopf, tagsüber trinkt sie. Aufstehen kann sie nicht mehr. Ein Dutzend Berber versorgt Marie mit dem Nötigsten: "Komm, Oma, kipp dir noch einen!"
Die interne Fürsorge klappt, bis der Kreislauf der Frau zusammenbricht. Das dauert mal drei, mal sechs Wochen. An diesem Abend ist es soweit. Marie fällt vornüber und starrt regungslos in die Bäume. Wir alarmieren das Rote Kreuz. Dr. Winfried Dreßler, Stationsarzt im Theresienhospital, zuckt bei ihrer Ankunft mit den Achseln. "Die Frau ist bei uns schon Stammkunde, und dabei ist sie hier völlig fehl am Platz. Sie müßte in ein Pflegeheim." Doch dort gibt es endlose Wartelisten.
Auch das Sozialamt, nach Paragraph 17 BSHG (Bundessozialhilfegesetz) verpflichtet, Marie eine Bleibe "auf Dauer" zu verschaffen, ist ratlos. "Solche Fälle haben wir hier zu Hunderten", sagt Sozialarbeiter Achim Ziesel, 40, "das Problem stinkt zum Himmel, und keiner tut etwas."
Aktiv werden nur die Düsseldorfer Stadtverordneten. "Law and Order" heißt hier die Devise, nachdem der Bundestag den Landstreicherparagraphen 316 StGB gestrichen hat. Ähnlich wie ihre Kollegen in Köln oder Stuttgart überlegen sie, wie die Clochards per Polizeiverordnung aus der Stadt zu vertreiben seien.
Wenn sich Marie nach ein paar Tagen im Theresienhospital einigermaßen erholt hat, dann läßt man sie wieder laufen. Bis zum Schwanenmarkt schaffen es ihre schwachen Beine gewöhnlich, und nach etwa vier Wochen geht dann alles wieder von vorne los.
Holzach, Michael: "Betteln ist schwerer als arbeiten" - In: 'Zeit'-Magazin, Nr. 36/ 29. August 1975; wieder veröffentlicht in:
Holzach, Michael: Zeitberichte. Mit Fotos von Timm Rautert. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1989, S. 40 - 46.
Klaus Trappmann
Vom Preis der Freiheit
Fahrende Leute gibt es von alters her. Wo immer sie auftauchen, die Zauberer und Wahrsager, Klopffechter, Possenreißer, Puppenspieler und Pantomimen, die Bären-, Affen- und Hundeführer, Jongleure, Seiltänzer, Kunstreiter, Komödianten, Sänger und Musikanten, versammeln sich Schaulustige und Neugierige. Wenn Messen, Wallfahrten oder Konzile, wenn Jahrmarkt, Kirchweih und Erntedank den ländlichen und städtischen Alltag unterbrechen, haben sie ihre große Stunde. Für einen Augenblick vermischen sich die Welten. Die Fahrenden haben ihren Verdienst; Bauern, Bürger und Adlige ihr Vergnügen.
Aber der Schein trügt. Man sieht zwar ihren Kunststücken gerne zu, aber die Menschen, die sie vorführen, werden mißachtet und verfolgt. Fahrende Leute gehören zu den Parias der Gesellschaft.
Und so findet sich, wer Genaueres über sie und ihr Leben erfahren will, unversehens in Gesellschaft von Landgendarmen, Schultheissen, Gefängnisaufsehern, Amtmännern, Kriminalräten und Staatsanwälten. Sie sind ihre eifrigsten Chronisten -- vom Polizeistandpunkt, versteht sich. Ein bedrückendes Netz von Überwachungen und Strafen sowie zahllose Erlässe, Magistratsentscheidungen und Gesetze zeigen, wie teuer die Fahrenden für ihr ungebundenes Leben bezahlen müssen. Kaum irgendwo haben sich die sozialen Erschütterungen, aber auch die Obsessionen und kollektiven Verdrängungen einer Gesellschaft schlimmer auswirken können als bei den Verfemten und Außenseitern von der Landstraße. Die Freiheit, die wir in ihrem Leben vermuten und bewundern, hat einen großen Preis.
In der Alten Welt glaubte man, daß die Götter arm und zerlumpt auf der Welt erscheinen, um die Menschen zu prüfen. Fremdlinge und Bettler nahm Zeus unter seinen besonderen Schutz. Wehe dem, den der Fluch eines abgewiesenen Bettlers traf. Die 'flehenden' Leute gehörten ebenso wie Athleten, Akrobaten, Seher und Ärzte zu den Demiurgen, den öffentlich Tätigen -- den 'Eingeweihten'.
Die Nachfahren der orientalischen und griechischen Gaukler dagegen, die mit dem Zerfall des Römischen Reiches nach Norden gezogen sind, gelten als 'unehrliche', ehrlose Leute. In dem Maße wie christliche Arbeitsmoral, Standesdünkel und Zunftgeist die Entwicklungsgeschichte des letzten Jahrtausends zu bestimmen beginnen, geraten die 'Leute von unterwegs' an den Rand der Gesellschaft. Ursprünglich heilige, mit magischer Wertschätzung verbundene Tätigkeiten aus vorchristlicher Zeit werden geächtet und für unrein erklärt. Aus Scheu wird Abscheu. Im Gesellschaftsgefüge der christlich-abendländischen Gesellschaft ist kein Platz mehr für das Fahrende Volk. Juden, Türken, Zigeuner und Wenden ebenso wie Spielleute, Bettler, Totengräber, Henker und Huren zählen in der mittelalterlichen Ständeordnung zu den Rechtlosen und Verfemten. Sie stehen nicht nur auf der untersten Stufe, sondern außerhalb der Gesellschaft. Sie sind Verworfene, Standeslose, Outcasts.
In einer starren, an Standes- und Ortszugehörigkeit orientierten Rechtsordnung sind die Heimat- und Besitzlosen vogelfrei. Gaukler, die außerhalb ihrer Heimatpfarre umherziehen, stellen die Landfriedenserlässe des 13. Jahrhunderts ausdrücklich extra pacem. Nach den Rechtsaufzeichnungen des Mittelalters kann man sie ungestraft beleidigen, verletzen und berauben.
"Wenn jemand einen leichten Mann, etwa einen Bettler oder einen bösen Spielmann schlägt, so soll er dem Richter nichts dafür zu geben schuldig sein, und auch dem Geschlagenen nichts, außer drei Schläge, die mag er ihm noch fröhlich dazu geben. "
(Haimburger Stadtrecht)
Es ist erlaubt, einen Klopffechter "um Geld zu erschlagen wie einen herrenlosen Hund, ohne Buße" (Hampe). Vergewaltigung fahrender Frauen wird in verschiedenen Rechtsbüchern für straflos erklärt.
"Spilleut und gaugkler sind nicht leut wie andere Menschen, denn sie nur ein Schein der menschheit haben, und fast den Todten zu vergleichen sind."
(Sächsisches Weichbildrecht)
Die so Geächteten dürfen weder Zeugen, Schöffen und Richter sein, noch können sie Eide leisten. Sie sind ausgeschlossen von Abendmahl, Altar und kirchlichem Begräbnis. Noch 1760 muß der Sarg der berühmten Theaterprinzipalin Caroline Neuberin des nachts über die Kirchhofmauer gehoben werden, nachdem Tage zuvor der Zimmerwirt die Sterbende aus dem Haus gewiesen hat, damit es durch den Tod einer Ehrlosen nicht befleckt werde.
Fahrende gelten als lehnsunfähig. Ehen mit Angehörigen ehrbarer Berufe sind ihnen versagt. Als gesetzliche Erben kommen sie nicht in Betracht. Die bayrischen Landrechte von 1553 und 1616 bestimmen, daß ein Kind enterbt werden kann,
"so ohne der Eltern Willen sich in leichtfertig Übung und Buebenleben begebe, als so es ein Freyhartsbueb oder ein Gauckler wurde, oder liesse sich, mit den Thieren zu kämpfen umb Geld bestellen".
(Danckert)
Der Zutritt zu den Handwerkszünften ist den Fahrenden verwehrt. So forderte noch im 18. Jahrhundert die Goldschmiedezunft von Köln von jedem vorsprechenden Gesellen einen amtlichen Nachweis, daß er weder eines Bartscheers, noch Baders, noch Leinewebers, noch eines Spielmanns Kind sei. Was das Zunftverbot bedeutet, kann nur ermessen, wer weiß, daß die mittelalterliche Gesellschaft den einzelnen weit mehr als heute über die Zugehörigkeit zu einer "Korporation oder sonst in irgendeiner Form des Allgemeinen" (J. Burckhardt) definiert. Für Fahrende bleiben die Stadttore verschlossen. Der Marktplatz, auf dem die Fahrenden ihre Fertigkeiten und Künste feilbieten, liegt lange Zeit außerhalb der Stadtmauern.
Erst die Reichszunftordnung von 1731 und die Französische Revolution heben die 'Unehrlichkeit' der meisten Fahrenden auf. Aber an der öffentlichen Mißachtung ändert sich wenig. Vor allem der Haltung der Kirche ist es zuzuschreiben, daß sich Verachtung und Verteufelung des Fahrenden Volks so tief im kollektiven Bewußtsein der Bevölkerung verankert hat.
Mit Haß und Abscheu verfolgt sie die, die mit Kunststücken und Musik, Possen und Parodien auf weltliche und kirchliche Herren beim Volk den Traum von einem besseren Leben wachhalten.
"Fort mit dir, wenn du irgendwo hier unter uns bist, denn du bist uns abtrünnig geworden mit Schalkheit und Liederlichkeit und darum sollst du zu deinen Genossen gehen, den abtrünnigen Teufeln; denn du heißt nach den Teufeln und bist nach ihnen genannt: du heißt Lasterbalg, dein Geselle Schandolf, so heißt ein anderer Hagedorn, dieser Höllenfeuer, jener Hagelstein. So hast du einen schimpflichen Namen wie deine Gesellen, die Teufel, welche abtrünnig sind."
(Bruder Berthold von Regensburg, 13. Jh.)
Mit Moralpredigten, Drohungen und Verordnungen versuchen kirchliche und weltliche Eiferer eine Fraternisierung mit den 'gottlosen Müßiggängern, Volksverderbern, Bettlern und Gaunern' zu verhindern.
"Ein Mensch, der den Gauklern anhanget, überkommt gar bald eine Frauen, deren Namen sein wird: Armut. Wie aber wird heißen dieser Frauen Sohn? Fürwahr: Verspottung. Gefällt dir des Gauklers Wort? Thu als ob du es nicht hörtest und an anderes dächtest. Denn wer da lachet und sich treuet an den Worten eines Gauklers, der hat sich damit selbst ein Pfand des Todes gegeben."
(Niclas von Wyle, 15. Jh)
Man scheint sich seiner Schäfchen nicht sicher zu sein. Wo Predigten nicht mehr genügen, müssen dann Strafen helfen. Eine Nürnberger Polizeiordnung aus dem 15. Jahrhundert verbietet bei Strafe von einem Pfund neuer Heller allen Bürgern, Bürgerinnen und Untertanen, herumziehende Landfahrer zu beherbergen. Artikel 137 der Polizeiordnung von Köln aus dem Jahre 1665 bestimmt:
"Die jungen starken Bettler, welche arbeiten, Vieh und dergleichen hüten können, ingleichen die Tartaren, Zigeiner, Wahrsager, Schalksnarren, Landfahrer, unnütze Sänger und Reimsprecher, als welche unseren Stifts-Unterthanen zum höchsten beschwerlich sein und oftmals viel Böses verüben, soll niemand beherbergen bei Strafe von 15 fl."
(nach Hampe)
Bis ins 18. Jahrhundert lassen sich Geldbußen gegen Leute nachweisen, die Fahrende bewirtet, beherbergt, im Dorf geduldet oder ihnen etwas abgekauft haben. Meist selber arme Leute und von Ächtung bedroht, fühlen sie sich den Fahrenden eher verbunden als ihren Herren: Eckhardt Liepp aus Oberurff wird 1750 dafür bestraft, "daß er Zigeuner Herberget"; die Gemeinde Rengshausen muß teuer bezahlen, daß sie 1728 "die ihnen in verwahrung gegebene Zeugeuner studio et data opera entwischen laßen". Ein Mann aus Ohmes, der Wirt von Ronshausen und die Frau des Schulzen von Iba schließlich werden mit Geldbußen belegt, weil sie von Zigeunern Sachen gekauft oder sich von ihnen wahrsagen ließen. (zit. nach A. Höck)
"Tartaren, Haiden, Zigeuner" nennt die ländliche Bevölkerung seit dem 16. Jahrhundert alle, die im Familienverband oder zu mehreren von Ort zu Ort ziehen. Zigeuner werden sehr schnell nach ihrer Ankunft in Mitteleuropa zu Beginn des 15. Jahrhunderts zum Inbegriff allen Fahrenden Volkes und damit zur Zielscheibe grausamster Verfolgungen und Sanktionen. Hat man zu Anfang noch geglaubt, es handele sich bei den Zigeunern um arme ägyptische Wallfahrer, die -- zu siebenjähriger Pilgerschaft verbannt -- durch Europa ziehen, werden sie schon 1498 vom Landtag zu Speyer zu "Verrätern an den christlichen Ländern" erklärt und außer Landes gewiesen. Von nun an wird ihre Wanderung durch Europa zu einem Spießrutenlauf, demgegenüber alle bisher aufgezeigten Gemeinheiten gegenüber dem Fahrenden Volk verblassen müssen.
Wer sich trotz Landesverweis noch einmal innerhalb der Landesgrenzen blicken läßt, wird geprügelt, öffentlich ausgepeitscht, an den Pranger gestellt, geschoren, verstümmelt und oftmals mit Trommelwirbel und unter den neugierigen Blicken des Publikums zur Stadt hinausgetrieben. Den so Gezeichneten ist die Rückkehr in ein normales Leben für immer verwehrt, gilt doch der Gestrafte und Gezeichnete nach mittelalterlichem Recht für alle Zeit als recht- und ehrlos.
"In Sachsen ward durch ein solches Edikt jedermann die Erlaubnis erteilt, Zigeuner, wo immer sie sich blicken ließen, und selbst wenn sie mit Pässen versehen wären, auf der Stelle niederzuschießen. Ebenso ließ ein Kurfürst zu Mainz alle männlichen Zigeuner, deren er habhaft werden konnte, ohne weiteres hinrichten, Weiber und Kinder aber mit Ruten streichen, brandmarken und über die Grenze jagen. Noch 1724 wurden zu Berneck im Gebiet des Markgrafen von Bayreuth auf ausdrücklichen Befehl des Fürsten 17 Zigeunerinnen im Alter von 15 bis 98 Jahren, davon 15 an einem Tage, an Bäumen aufgeknüpft."
Im 17. und 18. Jahrhundert veranstalteten fürstliche Landesherrn, Vögte und Schultheissen regelmäßig Treibjagden auf Zigeuner und anderes Fahrende Volk. Auf Glockenstürmen hin werden über Land ziehende oder in den Wäldern lagernde Zigeunerfamilien mit Hilfe der Nachbargemeinden verfolgt, verprügelt, ausgeplündert oder festgenommen. Seit 1710 findet man an Kreuzungen, Landesgrenzen und Stadttoren 'Zigeunerstöcke', die bald in ganz Deutschland bis ins späte 18. Jahrhundert Verbreitung finden. "Gauner und Zigeuner Straff" ist dort zu lesen. Damit auch des Lesens Unkundige wissen, was sie erwartet, sind ein Galgen und ein gestäupter Zigeuner aufgemalt.
"1726, den 14./15. November ist eine scharff. Execution vorgangen zu gißen, da sind 25 Zügener vom Leben zum Tod gebracht von wegen Mord und Diebstahls wegen, den 1. Tag sind 12, den 2. Tag 13,5 sind gradbrecht und 11 die Köpf abgeschlagen und 9 an den Galgen gehangen,"
trägt der Bauer Georg Seiß in sein Tagebuch ein.
Renaissance, Humanismus und Reformation also haben, wie man sieht, die Lage der Fahrenden wenig gebessert. Für sie gibt es keine "Neue Zeit". Im Gegenteil, die sozialen und religiösen Erschütterungen des 16. Jahrhunderts, der Bedeutungsverlust der Landwirtschaft, Merkantilismus, 30-jähriger Krieg und feudale Mißwirtschaft führen zu einer Massenarmut, die die Zusammensetzung des Fahrenden Volkes einschneidend verändern. Mehr als zuvor wird die Landstraße zur Kehrichtgrube der Gesellschaft. Bettler, Waisen, Witwen, alte Leute, Krüppel, Arbeitslose und Kriegsinvaliden liegen auf der Straße. Der Staat beginnt mit polizeitechnischen Mitteln gegen die Armut vorzugehen. Korrektionshäuser, Zwangsarbeitsstätten, Spinnhäuser für Frauen entstehen.
Zeitgenössische Abbildungen zeigen immer wieder abgerissene, müde Gestalten, Krüppel und Blinde, die nun die Straßen Europas entlangziehen. Bedroht von Bettlerakten, Razzien, Strafen und Arbeitshäusern, von Hunden und Gendarmen gehetzt, suchen sie als Kolporteure, Hausierer, Bänkelsänger und Musikanten nichts als einen spärlichen Freiraum. Im Gewerbe der Fahrenden Leute finden sie Nischen zum Überleben. Ein Patent der Schwäbischen Kreisregierung von 1742 erfaßt das ganze Spektrum der Umherziehenden:
"Alle ausländischen Bettler und Vaganten, es seien Christen oder Juden, Deserteurs und abgedankte Soldaten, Hausierer oder solche Leute, welche zum Verkauf allerhand geringe Lumpen-Sachen, als Zahn-Stierer, Zahn-Pulver, Haarpuder, Blumensträuß, Schuhschwärze, gedruckte Lieder und dergleichen herum tragen und unter diesem Schein eigentlich betteln, hauptsächlich auch die schändlichen Lieder absingen, fahrende Schüler, Leirer, Sack- und andere Pfeiffer, Hackbretter, Riemenstecher, Glückshafener, Scholderer usw."
(Hampe)
Immer öfter werden nun Gauner, Räuber, Fahrende und Zigeuner in einem Atem genannt. "Landstreicher, Zigeuner, boshafte Müßiggänger oder anderes herrenloses Gesindel" und ähnlich heißt es in Kriminalakten und Erlassen des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Volksfantasie hat darüberhinaus aus dem Leben der Umherziehenden und vor allem aus dem Treiben der Räuberbanden eine schaurige Ballade, einen grellen Moritatenbilderbogen gemacht. Aber die Wahrheit ist weit prosaischer. Die Umherziehenden sind keine gefederten und gespornten Räuberhauptmänner, Zigeunerfürsten und buntscheckigen Gaukler, sondern arme Leute. Aus den armen Dörfern Hessens und der Pfalz, vom Hunsrück, Winterhauch und Vogelsberg machen sich jedes Frühjahr Tausende 'auf die Socken', um als Krämer und Musikanten ihr Leben zu fristen. 1709 versuchen 15.000 Pfälzer nach Amerika auszuwandern. Nur 2000 kommen lebend an. In Kursachsen, das sich mit Zigeunergesetzen immer hervorgetan hat, verhungern in den Hungerjahren 1772/73 150.000 Menschen. Vor diesem Hintergrund muß man die Räuberbanden des 18. Jahrhunderts und die rücksichtslose Verfolgung all derer, die auf der Straße liegen, sehen.
In der Bande des Schinderhannes bilden Männer aus den armen Dörfern des Hunsrück, die als Musikanten und Krämer zu überleben versucht haben, das größte Kontingent. In seiner 'Actenmäßigen Geschichte der Vogelsberger und Wetterauer Räuberbanden' hat 1813 der Kriminalist von Grolmann die Lebensgeschichten der als Räuber verurteilten und hingerichteten Vagabunden nachgezeichnet. Die meisten von ihnen haben sich als Musiker und Krämer durchzuschlagen versucht und Vorurteile und Grausamkeit der Seßhaften mehr als genug zu spüren bekommen, bevor sie sich an deren Eigentum vergriffen.
"Peter Görzel (Scheeler oder Heiden-Peter). Der Vater, ein Musikant, überläßt das Kind seinem Schicksal, die Mutter ist früh gestorben. Der Stiefbruder, der sich des kleinen Peter annimmt, läßt ihn am Straßenrand zurück, als er eine Arbeitsstelle in Aussicht hat. Zwei Zigeunerfrauen nehmen sich des Kindes an und erziehen ihn als Zigeuner, daher der Name Heiden-Peter. Der Junge gerät daher in Konflikt, ob er "Zigeuner noch Teutscher sey". Als Vagant zieht er nach dem Tod seiner Mutter umher. Verschiedene Ausbruchversuche aus der "Eisenstrafe" gelingen dank seiner körperlichen Gewandtheit. Mit seiner Freundin, dem "Heiden-Cathrinchen" und seinen drei Kindern verbindet ihn ein herzliches Verhältnis. Trotz aller vergeblichen Versuche, mit gefälschten Papieren usw. seiner Familie eine sichere Bleibe zu verschaffen, geht er den vorgezeichneten Weg, der auf dem Richtplatz endet."
"Michael Borgener.
Sein Vater, der Pohlengänger, ist als Bettler unter freiem Himmel gestorben, die Mutter schlägt sich mit den Kindern alleine durch, Gefängnis und Landesverweisung bestimmen ihren Weg. Michel ergreift typische Vagantenberufe, er wird Musikant und Korbflechter, er hat für seine Frau und zwei Kinder zu sorgen. Zusammen mit seinem 10 Jahre jüngeren Bruder Hannes wird er 34jährig im Jahre 1812 vor Gericht gestellt, er kommt mit 20 Jahren Zuchthaus davon, der Bruder wird hingerichtet. Ob er die Zuchthausstrafe unter den damaligen Verhältnissen überlebt hat, ist fraglich."
Spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ändert sich die Politik der staatlichen Institutionen gegenüber dem Fahrenden Volk. Hat man bisher Räuber, Zigeuner, Bettler und Vagabunden in einen Topf geworfen, entwickeln nun die Behörden eine differenziertere Haltung. Die umherschweifenden Räuberbanden sind zerschlagen, ihr geheimes Netz ist zerrissen. Während das Leben der Fahrenden und vor allem das der Räuber in einer Art wehmütiger Rückerinnerung kolportiert und romantisiert wird, tippelt schon das Fahrende Volk der heraufziehenden Industriegesellschaft -- Saisonarbeiter, Arbeitslose, verarmte Bauern und andere Krisenopfer -- über Deutschlands Straßen. Die modernen Zeiten beginnen. Nach der Gründerkrise ziehen 200.000 bettelnd und hausierend durch Dörfer und Städte. Man wird sie kaum mit den Räuberbanden des 18. Jahrhunderts verwechselt haben, denn das neue Gespenst des Bürgertums heißt nicht Schinderhannes oder Hölzerlips sondern Sozialdemokratie. Liberales Bürgertum und Kirche plädieren aus humanitären und politischen Gründen für eine sozialreformerische Armenpolitik. Wichern gründet 1848 die 'Innere Mission', 1854 entstehen die ersten 'Herbergen zur Heimat', 1869 das erste Obdachlosenasyl in Berlin und 1882 kann Bodelschwingh die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf in Bethel einweihen. Asyle, Herbergen, Verpflegungsstationen, Wanderarbeitsstätten und Kolonien arbeiten Hand in Hand mit einem landeseinheitlich und zentral organisierten modernen Polizeiwesen. Die Zeiten des feudalen Partikularismus, die ja den Umherziehenden eine Fülle von Lücken ließen, gehen dem Ende zu. Paßwesen und Meldepflicht, Wandergewerbeschein und Wanderbuch, Gesetze gegen Bettelei und Landstreicherei, ein abgestuftes System von Bewährungsproben mit den Endstationen Zuchthaus und Irrenanstalt--das Netz der staatlichen Kontrolle und Überwachung wird immer enger geknüpft. Das 'unordentliche' Leben der Fahrenden wird überschaubar; die Wanderwege sind kontrolliert oder gar staatlich festgelegt. Die Arbeitswilligen können von den Arbeitsscheuen getrennt werden. Wer sich nicht bewährt oder sich gar der staatlichen und kirchlichen Wohlfahrt gegenüber als renitent erweist, gilt endgültig als asozial, gemieden auch von denen, die selbst einmal zu den Armen zählten und als Fabrikarbeiter oder Kleinhändler zu bescheidenem Wohlstand gekommen sind. Die Asozialen werden die 'atsingani', die Unberührbaren des 20. Jahrhunderts.
Den nationalsozialistischen Asozialen-, Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetzen fallen mehr als 500 000 Zigeuner und zahllose Bettler, Hausierer und Wanderarme zum Opfer. Der Staat organisiert die Bettelei lieber zentral: Winterhilfe, Volksanleihen, Spenden- und Hilfsaktionen Tag für Tag. Obwohl die nationalsozialistische Ideologie den seßhaften, an die Scholle gebundenen Bauern zur verpflichtenden Lebensform erheben möchte, sind am Ende des Krieges mehr Menschen heimatlos, aus ihren familiären, sozialen und regionalen Zusammenhängen gerissen als je zuvor. Was Victor Klemperer über die Judenverfolgung schreibt, trifft ebenso für die Zigeunerpolitik des Nationalsozialismus zu. Entrechtung und Verfolgung kommt nicht als mittelalterliche Raserei oder spontaner Massenmord, sondern in höchster Modernität, in "organisatorischer und technischer Vollendung", einher. Die Nationalsozialisten finden bereits 1933 einen Polizeiapparat vor, auf den die Gesetze gegen das 'Landstreicher- und Zigeunerunwesen' seit dem 19. Jahrhundert hingearbeitet haben. Auf der Münchener Konferenz vom Dezember 1913 wird ein reichseinheitliches Vorgehen gegen Zigeuner und der Aufbau einer Zentralkartei mit Fingerabdrücken, Fotos, Wanderrouten und Sippenregistern der durch Deutschland ziehenden Zigeunerfamilien beschlossen. Himmlers Zigeunerpolitik kann sich der Zentralkartei bedienen, perfektioniert sie und fügt ihr einen Aspekt hinzu, den die Verfolgung und Verfemung der Außenseiter im Mittelalter -- abgesehen von der technischen Perfektion -- noch nicht gekannt hat: den der Genealogie.
Robert Ritters 'Rassehygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle' sammelt systematisch Stammbäume von Zigeunern und Jenischen, um die 'erbliche Konstanz sozial schädlichen Verhaltens' zu untersuchen. Er und seine Mitarbeiterin Eva Justin bedienen sich für ihre Forschung der Möglichkeiten des nationalsozialistischen Polizeistaates und liefern ihm die wissenschaftliche Legitimation zur Sterilisation der 'artfremd erzogenen, sozial mangelhaft angepaßten Mischlinge'. Erst der amerikanische Fernsehfilm 'Holocaust', der Protestmarsch der Sinti nach Dachau 1979 und ihre politische Selbstorganisation haben die Bevölkerung mit dem Schicksal der Zigeuner während des 'Dritten Reiches', der verschleppten Wiedergutmachung nach 1945 und dem Kampf der Sinti ums Überleben heute bekannt gemacht.
Wenn bisher kaum von Zirkus und Rummelplatz die Rede war, so deshalb, weil die Vorurteile gegenüber den Fahrenden und ihre soziale und rechtliche Deklassierung weit älter sind als Schaustellergewerbe und Manege. Der Zirkus hat seine eigentliche Blütezeit im 19. Jahrhundert und der Rummel hat weit mehr mit der modernen Massenunterhaltung in den Metropolen zu tun als mit Jahrmärkten und Kirchweihfesten des Mittelalters.
Zwar machen die in Jahrhunderten entwickelten Vorurteile gegenüber dem Fahrenden Volk vor Zirkusleuten und Schaustellern nicht halt, aber andererseits tragen die 'großen Formen' des Volksvergnügens entscheidend zur Emanzipation der fahrenden Artisten, Komödianten und Fieranten bei. Aber die Emanzipation hat auch einen großen Haken, ähnlich dem Aufstieg des mittelalterlichen Spielmanns zum Stadtpfeifer. Als er Amt und Ehren von den Seßhaften übernahm, übernahm er auch deren Vorurteile gegenüber seinen ehemaligen Brüdern.
"Nichts zu tun hatten die fahrenden Leute mit den Zigeunern, im Gegenteil, sie kamen nicht mit ihnen in Berührung. Auch der Staat sah bald ein, daß das Wandergewerbe -- Handel wie Schausteller--ein ehrlich strebender Stand war. Die Behörden waren sich darüber klar, daß das Wandergewerbe eine gute Steuereinnahmequelle sei."
(A. Lehmann)
Auch das Fahrende Volk hat seine Parias und der soziale Aufstieg weniger fördert die soziale Hierarchie unter den Fahrenden. Während Renz seine Triumphe feiert, bedeutet die Einführung der allgemeinen Schulpflicht für manchen kleinen Familien-Wanderzirkus den Ruin. Zudem entdeckt Ende des 19. Jahrhunderts die Industrie die Massenunterhaltung. Betriebe, die kaum etwas mit dem Fahrenden Volk verbindet, spezialisieren sich auf die industrielle Produktion von Rummelplatzinventar und manch müde Bänkelsängerfamilie legte sich lieber ein Karussell oder eine Schießbude zu, als weiter ihr altes Gewerbe auszuüben.
Die zunehmende Industrialisierung und Elektrifizierung des Rummelplatzes sowie die auf die Spitze getriebene Perfektion des modernen Zirkus haben für die bescheidenen Kunststückchen der Fahrenden Leute vergangener Jahrhunderte eine große Sympathie entstehen lassen. Unwiederbringlich zur guten alten Zeit gezählt, haben wir unseren Frieden gemacht mit dem Fahrenden Volk. Jahrmarktsrequisiten, Drehorgeln und Bänkelsängertafeln gehören zu den gesuchten Trophäen aus der Subkultur der guten alten Zeit. Zigeunern, Zirkusleuten, Schaustellern und Bänkelsängern ist der Zutritt zu den heiligen Stätten der hohen Kunst nicht länger verwehrt.
Aber weiter draußen, in den Vorstädten, in den Asylen und Ghettos, auf Campingplätzen und Stellplätzen für Landfahrer geht es profaner zu.
Ruhrgebiet 1980:
"Allen Landfahrern, allen Schaustellern und allen Personengruppen, die von Haus zu Haus Waren anbieten, verkaufen oder reparieren, ist der Zutritt zu diesem Campingplatz verboten!"
Es gibt ihn noch, den Alltag von Verfolgten und Verfolgern .
Klaus Trappmann
Benutzte Literatur:
Bose, G. u. Brinkmann, E., Circus, Berlin 1978
Danckert, W., Unehrliche Leute, Bern 1963
Geigges, A. u. Wette, B., Zigeuner heute, München 1979
Hampe, Th., Die fahrenden Leute, Leipzig 1902
Hock, A., Recht auch für Zigeuner, Berlin 1976
Kopecny, A., Fahrende und Vagabunden, Berlin 1980
Lehmann, A., Zwischen Schaubuden und Karussells, Frankfurt 1952
Pätzold, L, Bänkelsang, Stuttgart 1974
In: Städtische Kunsthalle Recklinghausen (Hrsg.): Fahrendes Volk. Spielleute, Schausteller, Artisten. Katalog zur Ausstellung. Recklinghausen 1981, ohne Seitenangabe.