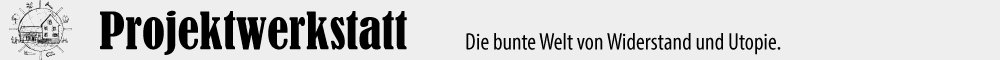Instant Housing sind Wohnsysteme für Obdachlose und andere urbane Nomaden. Instant Housing sind mobile Wohngeräte die auf die spezielle Lebenssituation der Benutzer ausgerichtet sind. Sie sind platzsparend, mobil und vor allem von einer Person handhabbar. Instant Housing soll immer nur Notquartier und Übergangsadresse für Ausgestossene und Vernachlässigte sein. Die Wohngeräte sollen auf keinen Fall eine Dauerlösung der Wohnprobleme der Obdachlosen sein. Instant Housing Ist lediglich eine temporäre Lösung. Witterung und Jahreszeiten bestimmten die Route bzw. den Stand- und Wohnort der Obdachlosen. So werden für unterschiedliche Standorte und Jahreszeiten auch unterschiedliche Ausführungen der Instant Housings angeboten.
Die Instant Housings haben neben ihrer funktionalen Eigenschaft, d.h. sie alltagstauglich für das Leben auf der Strasse sind, immer einen skulpturalen und modellhaften Charakter. Mit den Instant Housings wird Raum zur Verfügung gestellt, der in erster Linie als Schlafplatz dient, der aber auch immer Kunstraum ist. Die Wohneinheiten als Ganzes bewegen sich immer zwischen materieller Zweckhaftigkeit und künstlerischen Konzept.
Das Projekt lebt von der Spannung zwischen realem Menschlichen Elend und einem neuen Typus von Statussymbol. Ziel ist es, dass die Obdachlosen nicht als Objekte ohne humanen Status angesehen werden, sondern als Bewohner und Benutzer eines Equipments, dessen Form zugleich ihre Lebensexistenz spiegelt. Durch die Einführung von Instant Housing kommen die Benutzer in den Besitzt eines neuen Statussymbols. Paradoxerweise werden somit auch die Obdachlosen zur Zielgruppe für ein neues Produkt. Trotz allem handelt es sich bei diesem Projekt nicht um eine Verharmlosung der Situation der Obdachlosen. Das Projekt versucht das negative Image der Obdachlosen zu verändern. Ausgangslage des Projektes ist eine Überlebensstrategie für urbane Nomaden. So ist Instant Housing nicht nur als Hinwis auf die momentane Situation zu sehen sondern kann auch als zukunftweisendes Modell für moderne Nomaden in unseren Großstätten sein. Eine auf das wesentlichste reduzierte Behausung, deren wichtigstes Merkmal Mobilität ist. Die minimal ausgestatteten Basismodelle bieten Raum für individuelle Nutzung und lassen je nach den Bedürfnissen des Nutzers auch eine individuelle Zusatzausstattung zu. So ist es durchaus denkbar, dass sich die Instant Housings an das Kabel bzw. die Stromversorgung andocken und somit integrierter Bestandteil einer Vernetzten Gesellschaft sind.
In einer Zeit in der bestehende Lebensformen und Lebensräume ständig in Frage gestellt werden, in der Mobilität und Veränderung zur Lebensmaxime geworden sind, regen die Instant Housings an über die eigenen und über die Lebensformen anderer nachzudenken.
Instant Housing
- sind mobile Wohngeräte, die auf die spezielle Situation der Benutzer ausgerichtet sind.
- sind platzsparend, mobil und vor allem von einer Person handhabbar.
- sind immer nur Notquartier und Übergangs-adresse für Ausgestoßene und Vernachlässigte.
- sind Kunstobjekte mit realer Funktionstüchtigkeit.
- soll auf keinen Fall eine Dauerlösung für die Wohnungsprobleme der Obdachlosen sein.
- ist lediglich eine temporäre Lösung.
- sind multifunktinal. Sie können in erster Linie als Schlaf- und Liegestätte genutzt werden.
- haben neben ihren funktionalen Eigenschaften, d.h., dass sie alltagstauglich für das Leben auf der Straße sind, immer einen modellhaften und skulpturalen Charakter.
- dient in erster Linie als Schlafraum, ist aber gleichzeitig auch Kunstraum.
- ist soziale Plastik und Kunst im öffentlichen Raum.
- bewegt sich zwischen künstlerischem Konzept und materieller Zweckhaftigkeit.
- bewegt sich im Spannungsfeld zwischen realem menschlichen Elend und einem neuen Typus von Statussymbol.
- sieht vor allem Obdachlose als Zielgruppe für ein neues Produkt.
- versucht das negative Image der Obdachlosen zu verändern.
- ist nicht nur Hinweis auf die schwierige Situation der Obdachlosigkeit, sondern durchaus auch ein zukunftsweisendes Modell für moderne Nomaden in den Großstädten.
- ist eine auf das Wesentlichste reduzierte Behausung, deren wichtigstes Merkmal die Mobilität ist.
- haben eine zweckhafte Grundausstattung. Daneben ist eine individuelle Zusatzausstattung nach den Bedürfnissen der Benutzer möglich.
www.designmai.de/.../Exhibitors_instant_housing
12.-20. Mai, 10-20h and on the road,
please call +49 (0)172 826 47 32
Contact: Winfried Baumann, kontakt(at)instant-housing.de, www.winfried-baumann.de
Location: DESIGNMAI Forum, Spandauer Str. 2, 10178 Berlin, Tram/S Hackescher Markt, Tram/Bus/U/S Alexanderplatz
http://www.winfried-baumann.de/instant_housing/h4/index.html
http://www.winfried-baumann.de/instant_housing/h3/index.html
http://www.winfried-baumann.de/instant_housing/h2/index.html
Artikel Hannes Platte Mainz/Bingen
Gleich zu Beginn: Ich sehe mich als einen normalen Bestandteil unserer Gesellschaft. Es klingt vielleicht etwas seltsam, aber ich denke so und möchte es damit begründen, das es so etwas wie Obdachlosigkeit schon immer gab. Nomaden, Streuner, Wandersleute, Zigeuner und wie sie auch immer genannt wurden. Im Prinzip war das große Leitbild unserer Gesellschaft, Jesus, auch ein Obdachloser und sogar zum Teil Bettler! Bei den Zimmermännern gehört es sogar zur Zunft, durch das Land zu ziehen. Vergessen soll man dabei natürlich nicht diejenigen, die plötzlich abrutschen und mit Hilfe auch wieder sesshaft werden können. Nein, diesen Prozentsatz meine ich mit diesem Artikel nicht, ich schreibe von denen, die schon Jahre so leben und so leben wollen. Denn genau wie bei den Normalbürgern, gibt es bei den Obdachlosen viele Schichten, wir sind nur in dem Punkt, das wir keine Wohnung haben, gleich, das war`s aber auch schon.
Da ich einige von „meiner Sorte“ kenne, bin ich also nicht einzigartig! Also schreibe ich nun von den kleinen Ansichten, Einsichten und Problemen, die uns betreffen.
Am meisten stört mich das Vorurteil, das wir alle immer nur saufen würden! Selbst diejenigen, die auf öffentlichen Plätzen trinken, sind meist gar keine Obdachlose, für die Gesellschaft gilt aber: „Wer Dosenbier im Freien trinkt ist ein Penner!“.
Dann wären dann noch die Einrichtungen und Beratungsstellen für Obdachlose, wie zum Beispiel die Caritas, Die Schachtel, „Mampf“ und wie sie alle heißen. Eigentlich ideale Stätten dafür, das man sich als Obdachloser wieder wie ein normaler Mensch fühlen könnte, ja „könnte“. In diesen Einrichtungen und Beratungsstellen sind nämlich immer Menschen mit Wohnung und Einkommen zu finden, irgendwo am Rande des sozialen Netzes einzuordnen. Manche von ihnen waren früher obdachlos, manche unterscheiden sich nur noch durch den Besitz eines Haustürschlüssels von uns! Hier könnte eine Verbindungsnaht geschaffen werden, das ist aber zu selten, denn auch hier sind wieder Abgrenzungen zu finden. Also verschwindet der Obdachlose mehr und mehr aus dem Bild der Einrichtungen: wieder mal durch das soziale Netz gefallen? Nein, hier muß der Obdachlose selbst handeln, seinen Mund aufmachen und vor allem auf sich aufmerksam machen. Seine Gleichgültigkeit und sein latentes Selbstmitleid beiseite schieben und dieses Sprungbrett nutzen. Wir müssen nicht dauernd weglaufen, sondern stehen bleiben, wir müssen einander helfen.
Wenn es auch nicht immer einen eigenen Vorteil bringt, so doch vielleicht für den, der später kommt. Aber wenn wir von diesen Einrichtungen, Beratungsstellen und den vorhandenen Sozialarbeitern den Perfektionismus erwarten, den wir selbst nicht haben, dann geht auch diese Chance den Bach runter. Wir müssen uns wieder vor Augen halten, das wir über eine Menge Erfahrung verfügen und diese Leute über eine Menge Möglichkeiten. Also muß es doch von Vorteil sein, wenn man sich zusammentut und gemeinsam diese Einrichtungen gestaltet!
Wir müssen damit aufhören, dem anderen nur die Tasche vollzulabern, um ein paar Mark zu ergattern, sondern mitarbeiten an der Situation der Obdachlosen! Wir müssen aufstehen und mit dem wenigen, was wir haben, mehr anfangen, mitreden und mitgestalten. Wir müssen selbst den Leuten, die diese Einrichtungen gefährden, die Meinung sagen, damit sie begreifen, das sie sich damit bei uns nicht „interessant“ machen. Genug zu diesem Thema, es betrifft ja genügend Menschen, die jetzt mal anfangen können, darüber zu diskutieren.
Was bleibt jetzt noch zu sagen? Nun, ich werde wohl, wenn das Wetter besser wird, wieder weiterziehen, von Koblenz nach irgendwo. Werde wieder nach Essen und Tabak suchen und vielleicht den einen oder anderen Menschen treffen. Mich wird man nicht irgendwo mit einer Dose Bier rumstehen sehen, die trinke ich abends im Schlafsack. Ich werde irgendwo auftauchen und wieder versuchen, etwas zu verändern, werde wieder neue Erfahrungen machen und so weiter. Wenn ihr jemanden wie mich trefft, dann kommt mir nicht mit Mitleid, ich will es nicht, nehmt mich als Mensch ernst und unterhaltet euch normal mit mir. Glaubt nicht immer, das es euch besser geht, ihr könnt auch von jemanden wie mir lernen.
An all die, die nicht mehr auf der Strasse leben wollen, geht in die entsprechende Einrichtung, kneift eine Zeitlang den A... zusammen und baut von klein auf. An die, die weiter so leben wollen wie ich, baut mehr Kameradschaft auf, besiegt euer Misstrauen und helft mehr untereinander. Wenn wir nicht zusammenhalten, wer soll dann zu uns halten? Wir sind das letzte Glied in der Kette, wenn wir uns auch noch gleichgültig untereinander werden, nach uns ist nichts mehr! Leider sind wir immer mehr zu Einzelgängern geworden, voll von Misstrauen und Enttäuschungen. Genau damit aber ermöglichen wir all die Vorurteile gegen uns und nehmen all die Nachteile in Kauf. Wir sind der wunde Punkt in der Gesellschaft, die so viele Regeln, Gesetze und Behörden hat, das es „so was wie uns“ eigentlich nicht geben dürfte. Aus diesem Grund werden wir als versoffen, verlogen und dreckig verschrien, damit unsere Existenz für die Menschen erklärbar wird. Dagegen müssen wir uns wehren, auch ohne uns in ihre Lebensweise pressen zu lassen. Wir müssen zeigen, das auch wir eine normale Lebensberechtigung haben. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, wir leben eben nur anders. Wir und die Gesellschaft müssen lernen, in Harmonie miteinander zu leben, in Toleranz und Würde, das muß doch möglich sein. Da aber die Gesellschaft nicht zu uns kommt, müssen wir den ersten Schritt tun.
Laßt uns reden und schreiben von unseren Gedanken und Gefühlen und es werden sich immer mehr für uns interessieren. Zuerst aber müssen wir den Leuten zeigen, „wie“ wir sind, das wir nicht die Säufer sind, für die man uns hält. Gehen wir nicht mehr aneinander vorbei, bilden wir auch eine „Gesellschaft“ und zeigen der Welt, das wir in dieser Welt leben und nicht am Rande! In diesem Sinne bis bald
Man trifft sich,
Hannes
Margit Mayer, Dominik Veith, Jens Sambale
Das neue Gesicht metropolitaner Obdachlosigkeit
Stadtentwicklung und Obdachlosigkeit in Berlin zwischen globalen Zwängen und lokalen Handlungsoptionen
Projektantrag für die 17. Ausschreibung des Forschungsförderungsprogrammes BERLIN-FORSCHUNG der Freien Universität (FU) Berlin für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Berlin, den 28.02.1995
2. Kurzbeschreibung des Forschungsgegenstandes
3. Forschungsstand: Obdachlosigkeit und Metropolenentwicklung
3.1. Obdachlosigkeit
3.2. Metropolenentwicklung
3.3. Berlin: Vom Ort ideologischer Konfrontation zu internationaler Integration
4. Konzeptioneller Rahmen des beantragten Forschungsprojektes
5. Kooperationspartner
6. Literatur
1. Zusammenfassung
Der dramatische soziale, politische und ökonomische Umbruchprozeß Berlins im Zuge globaler Restrukturierung und nationaler Vereinigung, konfrontiert den lokalen Staat mit einem komplexen Problembündel. Die lokalen Akteure müssen der Metropolitanisierung, der Hauptstadtplanung und dem ökonomischen Transformationsprozeß gerecht werden. Zur Überwindung der gegenwärtigen Strukturkrise soll sich die Stadt zur Dienstleistungsmetropole mit Hauptstadtfunktion wandeln. In diesem Prozeß gewinnt die Berliner Lokalpolitik verstärkt unternehmerisches Profil, um sich in der inter-urbanen Standortkonkurrenz zu profilieren (Mayer 1990). Der lokale Staat verändert sein Ausgabeverhalten und mobilisiert städtische Ressourcen primär zur Ansiedlung neuer Investoren des Dienstleistungssektors. Die Baukräne in der Stadt legen Zeugnis von dieser Restrukturierung der baulichen Umwelt ab. Dieselben Baukräne und Gerüste an den Altbauten artikulieren den Wandel der Sozialstruktur: Der Druck auf den Berliner Bodenmarkt bringt die Mieter in Bedrängnis, deren Einnahmen durch den Abbau von Arbeitsplätzen und dem Ende der Berlinsubventionen stetig sinken. Die Armutsdynamik der Dienstleistungsgesellschaft führt zur rapiden Zunahme obdachloser Menschen, deren Zahl sich in Westberlin zwischen 1988 und 1992 nahezu verdoppelt (Abgeordnetenhaus 12/3162). In diesem Spannungsfeld von Stadtentwicklung und Obdachlosigkeit bewegt sich unser beantragtes Forschungsprojekt. Die politologisch relevanten Veränderungen lokaler Politiken manifestieren sich im Übergang von kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen zu Aushandlungsprozessen unterschiedlicher lokaler Akteure. Dabei ist einmal zu untersuchen, inwieweit Arme und Obdachlose in den neuen lokalen Aushandlungsformen nach dem Selbstverständnis der Planungsmoderatoren dieser Prozesse zur partizipierenden städtischen Zivilgesellschaft zählen oder ob sie ausgegrenzt bleiben. Von besonderem Interesse ist die Frage, wie und ob die Akteure ihre Handlungsressourcen im Kontext von Stadtentwicklung und Obdachlosigkeit nutzen. Die Problemwahrnehmung der Akteure und ihre Lösungsstrategien werden prozeßanalytisch durch Dokumentenanalyse, Interviews und teilnehmender Beobachtung rekonstruiert. Das Projekt dient weder bewußtloser Praxis, noch praxisferner Wissenschaft, sondern verfolgt das Ziel des empowerments der Obdachlosen, durch die Identifikation von Handlungsoptionen auf lokaler Ebene. Die zentrale Frage wird sein, wie ein Kommunikations-, Koordinations- und Kooperationssystem, d.h. Interaktions- und Vernetzungsstrategien, unter den unterschiedlichen Akteuren verbessert bzw. aufgebaut werden können, um Zielvorgaben für kommunales Handeln, Instrumentarien und Strukturen für deren Implementation zu initiieren. Diesem Ansatz liegt die Vermutung zugrunde, daß Armut und Obdachlosigkeit langfristig zentrale Rahmenbedingungen für die Berliner Politik setzen.
Die Kapitulation der traditionellen Obdachlosenhilfe vor dem dynamisch wachsenden Problem wandelt ihre Funktion von der sozialen Betreuung zum reinen Unterbringungsmanagment und dokumentiert damit den Funktionsverlust wohlfahrtsstaatlicher Sicherungssysteme. Allein die Änderung der Stadtentwicklung zugunsten einer sozialen Großstadtstrategie (Alisch/Dangschat 1993) bietet die Gewähr der schrittweisen Überwindung von Armut und Obdachlosigkeit. Zur Formulierung einer solchen sozialverträglichen Stadtentwicklung bedarf es empirisch fundierter politikwissenschaftlicher Fallstudien, die den Zusammenhang von lokaler Wirtschaftsentwicklung und Armutsentwicklung transparent machen. Für Berlin sind hier bisher starke Defizite zu verzeichnen.
2. Kurzbeschreibung des Forschungsgegenstandes
Obdachlosigkeit ist ein gesellschaftliches Produkt, das durch staatliches, soziales und individuelles Handeln tagtäglich (re-) produziert wird. Dieser Produktionsprozeß unterliegt historischen und geographischen Unterschieden/Verwerfungen: der soziale Skandal primärer Reproduktion ohne Wohnung hat daher eine eigene Geschichte und Geographie. Die reichen phänomenologischen Ausprägungen der Obdachlosigkeit in Raum und Zeit und die stets verschiedenen komplexen Ursachenzusammmenhänge wurden lange Zeit unter dem Verdikt individuellen Fehlverhaltens beerdigt - der rastlose Wandertrieb dauermobiler Asozialer[1].
Berlin weist eine reichhaltige Geschichte der Obdachlosigkeit auf. Nicht nur Krieg und Katastrophen haben zum rapiden Anstieg der Obdachlosenzahlen in Berlin geführt, sondern immer wieder auch abrupte Wachstumsprozesse, die ein Ungleichgewicht zwischen vorhandenem Wohnraum und nachgefragten Arbeitskräften erzeugten. Die gegenwärtige Obdachlosenkrise der Stadt ist jedoch nicht schlicht boom-vermittelt, im Gegenteil: Berlin befindet sich in einer schweren Strukturkrise, die durch die Vereinigung mit der östlichen Stadthälfte entscheidend verschärft wird, dieser jedoch nicht zugrunde liegt. Der Ostteil der Stadt weist die niedrigste Arbeitslosenquote aller Neuen Bundesländer auf (11,6%), die des Westteiles ist mit 13,8% die höchste der Altbundesländer (Stand: Dez. 1994)[*]. 284.000 Berliner beziehen Sozialhilfe, 70.000 von ihnen sind Männer im besten erwerbsfähigen Alter (18-50). Schätzungen zur Zahl der Obdachlosen reichen von 9.840 (Abgeordnetenhaus 12/3162) bis zu 50.000 (Mayer 1995a). Die registrierten Obdachlosen im Westteil der Stadt gliederten sich 1992 in folgende Personengruppen: 50% alleinstehende Männer, 25% Familien mit Kindern, 9% alleinstehende Frauen, 9% Elternteile mit minderjährigen Kindern, 6% Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder, 1% andere Haushalte mit minderjährigen Kindern. Seit mehreren Jahren wird eine stete Verjüngung wohnungsloser Menschen in Berlin registriert[2]. Auch diese Zahlen stammen vom Senat und sind nur eingeschränkt brauchbar, da die Abgeordnetenhaus (12/3162) einräumt, daß der Anteil der Frauen vermutlich deutlich höher liegt und im allgemeinen eine Dunkelziffer von 100% angenommen werden muß. Offensichtlich liegt der Unsicherheit über die genaue Zahl Obdachloser und ihre interne Zusammensetzung eine normative Entscheidung zugrunde, die stets politische Implikationen transportiert: Obdachlos sind immer so viele Menschen, wie der jeweiligen Definition Obdachlosigkeit gerecht werden. Amtlichen Schätzungen werden zu häufig verwaltungsrechtliche Kriterien zugrunde gelegt. Danach ist obdachlos, wer in den Einrichtungen der Obdachlosenhilfe untergebracht und bei den bezirklichen Sozialämtern als wohnungslos registriert ist. Nach dieser Definition sind Menschen, die auf der Straße leben nicht etwa obdachlos, sondern nichtseßhaft (vgl. § 4 der DVO zu § 72 BSHG[3]). Zwar tauchen in den Statistiken Berlins nur die registrierten Obdachlosen als Wohnungslose auf, doch zieht der Senat, der Definition des Deutschen Städtetages folgend, auch folgende Personengruppen in die Definition von Wohnungslosigkeit mit ein: Nichtseßhafte, Personen in überbelegten oder untragbar verteuerten Unterkünften oder in zwangskollektiven Wohnformen (Heim oder Anstalt) und Personen die wegen niedriger Einkommen potentiell von Wohnungslosigkeit bedroht sind (Abgeordnetenhaus 12/3162). Noch weiter gefaßt ist die Definition von Peter Marcuse, die unserem Verständnis von Wohnungslosigkeit am nächsten kommt:
"Obdachlosigkeit heißt, kein Zuhause zu haben, nicht in einer Wohnung (oder Nachbarschaft) zu leben, die minimale Anforderungen an Schutz, Privatheit, persönliche Sicherheit, Sicherheit der Wohndauer, Ausstattung, Raum für die wesentlichen wohnbezogenen Tätigkeiten, Kontrollierbarkeit der nächsten Umgebung und Erreichbarkeit erfüllt. 'Minimale Anforderung' ist die historische Komponente und variiert nach Zeit und Ort. Der Standard ist also relativ, und er wird sozial, nicht individuell bestimmt" (Marcuse, 1993:208).
All die Attribute, die Marcuse dem Reproduktionszusammenhang Wohnung zuschreibt, waren einmal integraler Bestandteil der städtischen Entwicklung Westberlins. Die Garantie gleichwertiger Lebensverhältnisse mit verbindlichen Versorgungs- und Leistungsstandards prägten die Westberliner Stadtentwicklungs- und Sanierungspolitik bis in die späten 70er Jahre (Jahn 1994). Mit den lokalen Großveranstaltungen und urbanen Spektakeln seit 1987 (750 Jahr Feier, IBA, Kulturhauptstadt) zeichnet sich das veränderte Leitbild städtischer Politik ab. An die Stelle des "sozialstaatlichen Stadtentwicklungsmodells" (Bodenschatz 1989) tritt das Leitbild metropolitaner Urbanität. Unter dem Druck globaler Standortkonkurrenz versuchte Westberlin bereits vor der Wende, sich durch die Sicherung und Entwicklung (weicher) Standortqualitäten und spezifischer Vorzüge der Region (endogene Potentiale) in der internationalen Städtehierachie neu zu positionieren. Die Orientierung an den hochqualifizierten neuen Mittelschichten (Kulturpolitik, Revitalisierung der Innenstadt, Exotismus) fragmentiert die städtische Gesellschaft, die kurzfristig im kulturellen Spektakel vereint wird (Großveranstaltungen, festivalisierte Stadtpolitik[4]). Diese einseitige Mobilisierung städtischer Ressourcen restrukturiert das Ausgabeverhalten des lokalen Staates, insbesondere die Versorgung der einkommensschwachen Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum kommt fast zum Erliegen[5].
Die Reintegration Berlins auf dem Weltmarkt findet im Immobiliensektor statt und betrifft dort den Wohnungsmarkt (vgl. Krätke 1991). Der Westberliner Wohnungsmarkt war schon vor der Vereinigung in unterschiedliche Teilmärkte mit ungleichen Zugangsmöglichkeiten für unterschiedliche Wohnungssuchende gespalten (öffentlich gebundene Sozialwohnungen, frei vermietbarer Altbau usw.). Mit der Öffnung des Ostberliner Wohnungsmarktes entsteht eine Verdrängungskonkurrenz unter den ärmeren Bevölkerungsschichten. In den städtischen Quartieren, wo strukturelle Massenarbeitslosigkeit und Wohnraumunterversorgung (Wohnungsarmut) räumlich zusammentreffen, verfestigen sich dauerhaft kumulative Armutslagen. Die homogen einkommensarmen Bewohner dieser städtischen Teilräume unterscheiden sich dramatisch hinsichtlich ihrer Lebensstile. Sie prägen das neue Gesicht metropolitaner Obdachlosigkeit im Sinne der Definition Marcuses[6]. Damit wird das neue Berlin nicht zur dualen Stadt der sozialräumlich strikt geschiedenen Armen und Reichen, sondern bleibt vielfach segmentiert. Trotzdem entwickelt diese aufgegebene Stadt der entwerteten Großsiedlungen und verfallenen Altbauquartiere zusammen mit den gentrifizierten Inseln gehobenen Wohnens in der Innenstadt[7] die stärkste Wachstumsdynamik in Berlin:
"Unter dem Druck neue Wohnungen zuzulassen, wird es notwendig, ursprünglich nur als Notunterkünfte geplante Billigwohnungen herzurichten, die aber zunehmend als 'Dauerlösungen' geduldet werden müssen - so z.B. in nicht mehr benötigten alten Kasernen und auf ehemaligen militärischen Übungsgelände. Es entstehen lagerähnliche Siedlungen, Barackenstädte oder gar wilde Siedlungen, in denen die ärmsten der Zuwandernden - dicht gedrängt - eine Bleibe finden" (v. Einem, 1990:7).
Diese global induzierte Krise des lokalen Staates (glokale Krise) ist für Berlin prognostiziert worden (Krätke 1991) und der erwartete wirtschaftliche Aufschwung wird sie nicht lösen. Armut und Obdachlosigkeit werden langfristig zentrale Rahmenbedingungen Berliner Lokalpolitik setzen. Konkrete Fallstudien, die die Dynamisierung der Berliner Armutsentwicklung als Resultat der Metropolitanisierung der Stadtregion Berlin rekonstruieren, stehen indes noch aus.
Wenn man den dynamischen Charakter der Berliner Armuts- und Obdachlosigkeitsentwicklung anerkennt, also die Tatsache, daß Verarmungstendenzen sich in der Rezession beschleunigen, aber auch im Aufschwung nicht umkehren, dann ist eine städtische Entwicklungspolitik, die exklusiv auf weiteres Wachstum um jeden Preis setzt, problematisch. Im Unterschied zu solch unternehmerischen Metropolenpolitik gehen wir mit unserem Projekt von der Notwendigkeit einer sozialen Großstadtstrategie (Alisch/Dangschat 1993 und v. Freyberg 1994) aus. Eine solche Entwicklungsstrategie würde alle lokalen Standortentscheidungen und Stadtentwicklungsziele einer Sozialverträglichkeitsprüfung unterziehen. Sie würde den aufgebrochenen Nexus von lokalem ökonomischen Fortschritt und dem sozialen Fortschritt der städtischen Zivilgesellschaft wieder herstellen. Diese Stadtentwicklungspolitik würde jede Finanzentscheidung dahingehend prüfen, ob sie sozialräumliche Polarisierungsprozesse vorantreibt und damit die normativen Grundlagen des städtischen Gemeinwesens zerrüttet oder aber, ob sie sozial integrativ wirkt. Dadurch werden unvermeidlich die Privilegien jener urbanen Arbeits- und Wohneliten beschnitten, die es in den 80er Jahren verstanden hatten, ihre partikularen Interessen als die der Allgemeinheit zu definieren (Jahn 1994). Damit ist ein völlig neuartiger Typus lokaler Politik beschrieben, die ihre kommunalen Entscheidungen demokratisch/partizipatorisch an alle gesellschaftlichen Schichten rückkoppeln muß. Aufgrund der fortgeschrittenen sozialräumlichen Polarisierung wird lokale Politik "in ganz neuem Maß divergierende Interessen ausbalancieren und in unterschiedlichen städtischen Regionen auch unterschiedliche Politiken entwickeln müssen" (v. Freyberg, 1994:26). Die globalisierte Urbanisierung unterwirft lokale Politik also nicht nur weltmarktvermittelten Restriktionen, sondern öffnet potentiell beschränkte Handlungsoptionen sozialer Integration, die über das enge Konzept der unternehmerisch orientierten Stadt hinausweisen (s. Keil/Kipfer 1994)[8]. Santa Monica (Keil 1993), West Hollywood (Moos 1989) und Berkeley in Kalifornien, Amsterdam und die skandinavischen Städte in Europa bieten Beispiele einer lokalen Reformpolitik. In der Bundesrepublik hat Hamburg bereits eine sozialverträgliche Stadtentwicklungsstrategie formuliert (Alisch/Dangschat 1993), Frankfurt/M. verfolgt ähnliche Ansätze (v. Freyberg 1994).
Dabei ist stets offen, wie die politische Legitimation der sozialen Großstadtstrategie zu sichern ist. In diesem Spannungsbereich von Metropolenpolitik und Obdachlosigkeit setzt unser Forschungsprojekt an. Es gilt einen kontinuierlichen und normativen Diskurs mit den lokalen Akteuren und betroffenen Wohnungslosen anzuschieben, der den Zusammenhang von städtischer Wirtschafts- und Armutsentwicklung transparent macht. Die Notwendigkeit einer solchen lokalspezifischen Fassung der Armutsdynamiken wird von den Mitarbeitern der Obdachlosenhilfe selbst gefordert[9]. In Berlin gibt es bislang keine Armutsberichterstattung, die z.B. räumlich verfestigte Armutslagen in städtischen Teilquartieren identifiziert. In anderen Städten trägt die Sozialberichterstattung häufig nur fragmentarischen Charakter. Es besteht unsererseits Kontakt zu der Sozialpolitischen Offensive Frankfurt/M., die eine komplexe Armutsberichterstattung für die Mainmetropole vorbereitet.
3. Forschungsstand: Obdachlosigkeit und Metropolenentwicklung
3.1. Obdachlosigkeit
Die soziale Marginalität (scheinbar) alleinstehender Wohnungsloser spiegelt sich in der Randständigkeit des wissenschaftlichen Interesses an dem Phänomen Obdachlosigkeit, das von einer sozialpädagogischen Hegemonie geprägt ist[10]
Dieser biographische/lebensweltliche Zugang rekonstruiert die Betroffenen als handelnde Subjekte und markiert dadurch sowohl einen Fortschritt gegenüber den psychologischen/medizinischen Ansätzen, die bis Anfang der 70er Jahre Obdachlosigkeit als Resultat individueller Devianz (zum Beispiel. Rebmann, 1968 und Blume 1969) verurteilten[11], wie gegenüber dem rigiden Strukturalismus materialistischer Ansätze, die in Ihrer kurzen Karriere Mitte der 70er Jahre Obdachlosigkeit als Sonderform der industriellen Reservearmee definierten[12].
In dem biographischen Problemverständnis ist Obdachlosigkeit Resultat eines komplexen Prozesses der aktiven, individuellen Auseinandersetzung mit konkreten gesellschaftlichen Bedingungen. Dieser Prozeß beginnt lange vor dem aktuellen Ereignis des Wohnungsverlustes und ist mit diesem längst noch nicht beendet. Ist Wohnungslosigkeit Ergebnis dieser Entwicklung oder Karriere, dann liegt die Aufgabe sozialarbeiterischer Intervention in der Umkehrung des Karriereverlaufes über die genaue Kenntnis der individuellen Biographie. Im Mittelpunkt dieser Forschung steht nicht mehr das individuelle Defizit oder die Pathologie des Opfers, sondern dessen gescheiterte Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Armutsentwicklung (Schneider 1990). Die Forschung zu individuellen Armutskarrieren identifiziert einen Set von Anlässen, die die Wahrscheinlichkeit, obdachlos zu werden, signifikant erhöhen (Kumulation von Armutsrisiken). Die Anzahl der Ressourcen, über die ein Individuum verfügt, bestimmt dessen Gefährdungslage. Im Unterschied zum Ressourcenansatz (vgl. Hauser 1984), der das verfügbare Einkommen als exklusiven Armutsauslöser ansieht[13], definiert der lebenslagenorientierte Ansatz (vgl. Döring u.a. 1990, Hauser/Neumann:1992:245-248) die (Unter-) Versorgung der Betroffenen in unterschiedlichen Lebensbereichen als auslösende Anlässe, zum Beispiel: Mangelhafte oder fehlende Wohnraumversorgung (Wohnarmut), fehlende oder unzureichende Ausbildung, prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder Arbeitslosigkeit, erschwerter Zugang zum Gesundheitssystem, soziale Isolation.
Auch wenn dieser komplexe Ansatz hinsichtlich seiner empirischen Operationalisierbarkeit umstritten ist, bietet er der Obdachlosenforschung zwei entscheidende Vorteile: Erstens erlaubt er die Erforschung der subjektiven Verarbeitung oben genannter objektiver Problemindikatoren, die die Obdachlosen scheinbar alle auf sich vereinen. Das Verhalten der Betroffenen als problemadäquates, strukturiertes Handeln zu verstehen, bedeutet einen beträchtlichen Fortschritt gegenüber dem verurteilendem Blick.
Zweitens ist dieser Nexus von objektiver Lebenslage und subjektiven Deutungsschemata allein auf lokaler Ebene rekonstruierbar. Statt nationaler Datenaggregate, die von illustrativen Einzelschicksalen beleuchtet werden, können nun die lokal/regional differenzierten Überlebenstaktiken und Gefährdungslagen der Obdachlosen beschrieben werden.
Aus der Perspektive unseres Projektes weisen diese persönlichkeitsorientierten Erklärungen zwei Defizite auf:
Erstens folgt die Kumulation von Unterversorgungslagen einer eindeutig ethnischen und sozialen Risikostruktur: EinwanderInnen, Alleinerziehende (also mehrheitlich Frauen) und Kinder[14] sind dem stärksten und dauerhaftesten Armutsrisiko ausgesetzt (Hanesch et al, 1994, Krause 1994). Diese Risikogruppen sind jedoch in der Praxis wie in den Publikationen der Obdachlosenhilfe kaum erst präsent[15]. Auch die Öffentlichkeit subsumiert diese unsichtbaren Formen der Wohnungsarmut (Überbelegung, doubling-up, Wohnungsprostitution) nicht unter der Kategorie Obdachlosigkeit.
Zweitens werden die akut Wohnungslosen über das gemeinsame Merkmal des Scheiterns als homogene Gruppe (re-) konstituiert. Da die Anzahl der Menschen, die von verschiedenen Unterversorgungslagen betroffen sind, ungleich größer ist, als die unmittelbar Obdachloser, wird der auslösende Anlaß für den Verlust des festen Wohnsitzes in der mangelnden Problemlösungskompetenz der Betroffenen verortet. Diese Sollbruchstelle wird biographisch rekonstruiert und -idealtypisch- sozialarbeiterisch therapiert. Damit steht erneut das Individuum statt der Unterversorgungslagen, denen es ausgesetzt ist, im Zentrum des Interesses.
3.1.1. Obdachlosigkeit und Armutsentwicklung
Treuberg (1989) vertritt einen stärker strukturalistisch orientierten Ansatz, der Obdachlosigkeit historisch als mobile Arbeitskraftreserve rekonstruiert. Den überzeugend ausgebreiteten historischen Ausprägungen der Obdachlosigkeit liegt seit dem Kaiserreich die Kontinuität der sorgfältigen Scheidung von Arbeiter- und Armenpolitik zugrunde. Dieser von Staat, Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften geteilte Konsens, daß Arme keine Arbeiter seien, garantierte ein kontrolliertes Reservoir an nicht-sozialversicherungspflichtigen Arbeitskräften, das im konjunkturellen Bedarfsfalle mobilisiert werden konnte. Erst die Integration der männlichen deutschen Mehrheitsbevölkerung in tariflich gesicherte Arbeitsverhältnisse und in den sozialstaatlichen Kompromiß Ende der 50er Jahre lassen diesen Arbeitskräftepool versiegen. Nachdem auch der stete Arbeitskräftezustrom aus der damaligen DDR 1961 zum Erliegen kam, garantierte der Import südeuropäischer Arbeiter erneut ein mobiles Arbeitskräfteangebot. Damit verliert Obdachlosigkeit als arbeitsmarktpolitisches Regulativ an Relevanz. Es verbleibt eine Restpopulation, die in den Nischen des Arbeits- und Wohnungsmarktes konjunkturellen Schwankungen ausgeliefert ist.
Während wir Treuberg in seinen historischen Aussagen folgen, bezweifeln wir, daß auch das gegenwärtige Phänomen Obdachlosigkeit konjunkturabhängig ist. Die These, daß niedrige Obdachlosenzahlen mit ökonomischer Prosperität korrelieren (und vice versa), kann nicht erklären, warum der Aufschwung seit Mitte der 80er Jahre mit der Explosion von Obdachlosenzahlen einhergeht. Der eigentliche Skandal liegt weniger in der Armut trotz Wohlstandes als in der Armut durch Wohlstand.
Obdachlosigkeit ist offensichtlich ein Armutsphänomen, kein subjektives Defizit. Von den neueren Ansätzen zur Armutsforschung bietet die These von der Armut im Wohlstand (Leisering/Voges 1992) wichtige Anregungen für das Verständnis der Neuen Obdachlosigkeit[16]. Armut im Wohlfahrtsstaat entsteht dadurch, daß der überforderte Sozialstaat und seine administrativen Regelungen dafür sorgen, daß soziale Ungleichheit politisch reproduziert wird. Da das Niveau sozialer Sicherungen (Arbeitslosengeld, Kranken- und Rentenversicherung) von der vorherigen Stellung auf dem Arbeitsmarkt abhängig ist, führt z.B. eine Anstellung in den dynamisch wachsenden ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen bei eintretender Arbeitslosigkeit deutlich zügiger in Armut und Obdachlosigkeit, als eine vorausgegangene Normalarbeitsbiographie. Im Bereich der Obdachlosenhilfe wirkt die administrative Reproduktion der Notlage u.a. durch das Prinzip der vertreibenden Hilfe (Holtmannspötter 1982), die die Betroffenen zu genau dem Verhalten nötigt, das ihnen als Pathologie zugeschrieben wird: rastloses Wandern. Die Herstellung multipler Deprivation ist jedoch nicht ursächlich der Hilfsadministration geschuldet, sondern wird von ihr nur dauerhaft reproduziert. Dennoch ergeben sich aus der These politischer Reproduktion sozialer Notlagen wichtige Fragen für das beantragte Forschungsprojekt bezüglich der Interaktion zwischen Verwaltung, Wohlfahrtsverbänden und Betroffenen.
Hohe Aufmerksamkeit genießen gegenwärtig Analysen individueller Armutskarrieren, die gegen die Annahme verstetigter und verfestigter gesellschaftlicher Armutskarrieren argumentieren. Längsschnittanalysen der persönlichen Armutsentwicklung kommen für den Zeitraum von 1984-89 zu folgenden Ergebnissen (Alisch/Dangschat 1993:31):
Dauerhaft arm ist nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung (3-4%). Das Risiko, im Laufe der Zeit kurzfristig zu verarmen, ist jedoch relativ hoch (ca. 30%). Die individuellen Karrieren in die Armut und aus ihr heraus betreffen nur in geringem Maße die gleiche Personengruppe.
Dieser der Theorie der Risikogesellschaft geschuldete Ansatz argumentiert gegen die 2/3 Gesellschaft und thematisiert Armut als individuelles Lebensrisiko statt als gesellschaftliches Strukturmerkmal (vgl. Zwick 1994[17]). Neben methodischen Einwänden (vgl. Alisch/Dangschat 1993:32) räumen wir dieser Erklärung für unserer Projekt vor allem deshalb einen geringeren Stellenwert ein, weil sie auf bundesweiten Daten (SOEP- Sozioökonomisches Panel) beruht und so die dauerhafte Verfestigung von Armut und Obdachlosigkeit in großstädtischen Teilräumen ausblendet[18]. Diese Entwicklung wird von zahlreichen kommunalen Armutsberichten belegt[19], die in Großstädten eine lokal konzentrierte Armutspopulation von deutlich über 10% identifizierten. Im relativ prosperierenden Essen beziehen zum Beispiel in lokalen Armutsinseln bis zu 38% der Bevölkerung Sozialhilfe (Danielzyk, 1992:86).
3.2. Metropolenentwicklung
Zur Erklärung solcher sozialräumlicher Segmentierungsprozesse eignen sich neuere Ansätze der Stadtforschung, die vor allem im angelsächsischen Sprachraum entwickelt wurden (u.a. Sassen 1991, Friedmann 1993, Harvey 1987), mittlerweile aber ebenso zur Analyse der Veränderungen in bundesdeutschen Städten herangezogen werden[20].
Wider die These von der Verflüssigung von Armutslagen in zeitlicher Perspektive (Zwick et al, s.o.) gehen wir von der Annahme aus, daß sich Armut und Obdachlosigkeit als gesellschaftliche Strukturmerkmale in großstädtischen Teilgebieten räumlich dauerhaft verfestigen. Der gegenwärtige Urbanisierungstyp, den wir als post-fordistisch (vgl. Mayer 1991a) bezeichnen, ist durch die Gleichzeitigkeit von Wachstum und Deklassierung, von Zitadelle und Ghetto bestimmt. Dieser universalisierte Urbanisierungsprozeß[21] unterliegt globalen Bedingungen und lokalen Beschränkungen. In diesem Prozeß der Transformation Berlins spielen neue lokale Akteure eine entscheidende Rolle, die (inter-) nationales Investitionskapital (Gebrauchswertinteresse an der Stadt) mit dem Tauschwertinteresse der Bewohner vermitteln.Vor allem in den Diskussionen über metropolitane Politik in den USA ist damit eine Entwicklungsstufe markiert, in der es vorrangig um die Herstellung eines urbanen Regimes (Stone 1993) oder einer Wachstumskoalition (Logan/Molotoch 1987) geht. Von genuin politologischem Interesse ist dabei die Analyse der Bedingungen, des Verlaufs, der Formen und der Entstehung von Kooperations- und Konfliktprozessen zwischen politischen, administrativen und ökonomischen Eliten auf lokaler Ebene. Analysen der Berliner Machtstruktur verneinen bislang die Formation einer kohärenten Wachstumskoalition (Strom 1994). Die politische Entscheidungsgewalt ist in unterschiedliche Fraktionen fragmentiert: Bund, Senat und die Bezirke sind noch hinter kein geschlossenes Entwicklungsziel vereint. In dieser prinzipiellen Offenheit des Entwicklungsprozesses liegt die Interventionsmöglichkeit für gegenhegemoniale Entwürfe, denn entgegen der Annahme von urbanen Regimes sind es keineswegs ausschließlich Eliten, die Politik machen (vgl. z.B. Keil 1993). Falls es den nicht-staatlichen Akteuren gelingt Zugang zu institutionellen Ressourcen zu erlangen, könnten sie nachhaltig Einfluß auf politische Entscheidungen nehmen[22] .
Im Unterschied zu unserer Verknüpfung von Metropolenpolitk und Armuts-/Obdachlosigkeitsentwicklung argumentieren die oben erwähnten Ansätze zu Armutsentwicklung und Obdachlosigkeit entweder vom Nationalstaat aus (Treuberg), oder rücken die betroffenen Individuen in das Zentrum von Forschung und Politik (Zwick et al). Da aller sozialwissenschaftlicher Obdachlosenforschung die Frage nach den Ursachen zugrunde liegt, modifiziert die unterschiedliche Verortung der Probleme die Gestaltung der Lösungsmöglichkeiten. Daher steht von einem ortsspezifischen Zugang die Entwicklung zielgenauer, lokalspezifischer Lösungsmöglichkeiten zu erwarten. Daß der Anstieg der Obdachlosenzahlen der Krise der fordistischen Stadt und ihrer Globalisierung geschuldet ist, werden wir im folgenden beschreiben. Die nachzuzeichnenden Tendenzen gesellschaftlichen Wandels bilden den theoretischen Rahmen, innerhalb dessen wir unser Projekt organisieren.
3.2.1. Globalisierung und Lokalisierung
Jennifer Wolch und Michael Dear argumentieren, daß der Zusammenbruch der pax americana durch die Krise der Bretton Woods Institutionen Anfang der 70er Jahre mit der gegenwärtigen Obdachlosenkrise zusammenhängt (Wolch/Dear 1993, ähnlich Blau 1992).
Produktionsinnovationen sowie Fortschritte im Transport- und Kommunikationssektor schufen die Voraussetzungen zur prekären Krisenüberwindung der Weltwirtschaft durch Globalisierung und Rationalisierung der Produktion[23]. Beide Strategien kosteten Arbeitsplätze und setzten dadurch die Städte als traditionelle Orte industrieller Produktion unter Druck. Von Detroit bis Duisburg[24] verloren altindustrielle Standorte standardisierter Massenproduktion Arbeitsplätze und Steuereinnahmen (Deindustrialisierung). Diese Räume entwickelten sich zu Verliererregionen in der globalen Standortkonkurrenz. Sie sind durch strukturelle Massenarbeitslosigkeit und stete Abwanderung gekennzeichnet.
Andere Regionen erfahren plötzliche Wachstumsschübe durch Re- oder Neoindustrialisierung und Tertiarisierung. Der Anschluß an internationale Transport- und Kommunikationsnetze (Flughäfen, Häfen, Hochgeschwindigkeitszüge und Autobahnknoten, Teleports), ein hochqualifizierter Arbeitsmarkt, ein innovatives Milieu (Universitäten, Forschungsinstitute usw.), eine attraktive bauliche Umwelt (hochwertige Büroflächen, aufgewerteter Altbaubestand) und viele weitere Faktoren bestimmen die Genese der Gewinnerregionen, die ihren avanciertesten Ausdruck in den global cities[25] finden.
Eine dritte Kategorie von Städten verfolgt demgegenüber einen unentschiedenen Entwicklungspfad. In einem komplexen Gegen- und Nebeneinander existieren hier gleichzeitig Strukturen der Gewinner- und Verliererregionen. In der Bundesrepublik sind hier an erster Stelle Berlin und Hamburg[26] zu nennen.
Aus der Entwicklung eines hierachisierten, arbeitsteilig organisierten Städtesystems, ist für unseren Zusammenhang wichtig, daß sich die lokalen, weniger die nationalen Einheiten, in Konkurrenz zu einander befinden und daß die sozio-ökonomische Umbruchsituation Berlins nicht nur der Vereinigung geschuldet ist, sondern vor allem auch der plötzlichen Metropolitanisierung der Stadt und ihrer neuen Positionierung in der internationalen Städtehierarchie.
3.2.2. Metropolenpolitik
Die Restrukturierung staatlichen Ausgabeverhaltens seit Ende der 70er Jahre und die inter-urbane Standortkonkurrenz haben Auswirkungen auf die Funktion städtischer Politik: Der lokale Staat wandelt sich von einer distributiven zu einer unternehmerisch orientierten Einheit (Mayer, 1990, Harvey,1989b). Nicht mehr die gleichmäßige Verteilung staatlicher Mittel zur Garantie eines standardisierten Versorgungsniveaus in allen gesellschaftlichen Schichten und städtischen Teilräumen steht im Zentrum lokaler Politik, sondern die gezielte Mobilisierung endogener Potentiale durch öffentliche Investitionen zur kommunalen Wirtschaftsförderungspolitik (Heinelt/Mayer, 1993). Stadtmarketing und städtische Außenwirtschaftspolitik, public-private-partnerships und neue institutionelle Arrangements sind Beispiele veränderter Politiken. Produktions- und Dienstleistungsprofil, Infrastruktur und bauliche Umwelt werden die wichtigsten Standortfaktoren, die lokale Politik effizient herstellen und vermarkten soll. Es sind also nicht mehr primär die traditionellen weichen kommunalen Politikfelder (Sozial- und Kulturpolitik), sondern Wirtschaftsförderung und technologische Modernisierung, in denen die Kommune Handlungskompetenz gewinnt[27]. Eines der mächtigsten Instrumente bei der Reorganisation des städtischen Gemeinwesens stellt die Stadtentwicklungspolitik dar, mittels derer die bauliche und soziale Umwelt den programmatischen Entwicklungszielen angepaßt wird. Um diese Ziele öffentlich zu legitimieren, muß ein stadtöffentlicher Wachstumsdiskurs geschaffen werden, der öffentliche Investitionen und Vorleistungen in ausgewählte urbane Räume bei gleichzeitiger Desinvestition in andere rechtfertigt. Während des kurzen Traumes immerwährender Prosperität (Lutz 1984), hatte die Kopplung von wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt den unhinterfragten Wachstumkonsens getragen. In den 80er Jahren entwickelte sich in den prosperierenden Städten weltweit ein Urbanitäts- und Metropolendiskurs, der die polarisierenden Konsequenzen lokaler Wachstumspolitik als Pluralität der Lebensstile zu legitimieren suchte[28]. In dieser Dekade stirbt das Soziale. Obdachlosigkeit und Armutsentwicklung finden im kulturellen Hype nur wenig Beachtung.
3.2.3. Die Restrukturierung der Innenstädte
Seit den 70er Jahren zieht sich das krisengeschüttelte Investitionskapital in den Büroflächenbau zurück und restrukturiert die Innenstädte dramatisch (Harvey 1989a) -zuerst in den USA, bald aber auch in Europa. Damit kündigt sich die Tertiarisierung der lokalen Ökonomie an, der sich viele Städte bedingungslos verschreiben. Tertiarisierung verlangt neben Büroflächenneubau die Allokation von qualifizierten Arbeitskräften. Ihnen zuliebe wird ein urbanes Ambiente geschaffen, werden Innenstadtquartiere revitalisiert, öffentliche Mittel für den Erwerb von Altbauwohnungen bereitgestellt usw. Es wird also gezielt massiv in städtische Teilräume investiert, um einen attraktiven Arbeitsmarkt zu schaffen bzw. zu erhalten[29]. Die Wohnquartiere und Arbeitsstätten der Restrukturierungsverlierer erfahren weniger Aufmerksamkeit. Explodierende Mietbelastungen, sinkende Einkommen, steigende Lebenshaltungskosten, die ständige Verschlankung des sozialen Sicherungssystemes usw. bringen immer mehr Großstadtbewohner an den Rande des Existenzminimums - und darunter (vgl. Fußnote 19). Diese Unterversorgungslagen ballen sich in den Großwohnsiedlungen am Stadtrand und in innerstädtischen Altbauquartieren, wo eine wachsende Zahl von Menschen mit sehr heterogenen Lebensstilen in Einkommens- und Wohnungsarmut leben. In diesen Quartieren reichen häufig kleinste Anlässe, um Obdachlosigkeit auszulösen. Hier in den Innenstädten findet sich das dichteste Netz der Versorgungseinrichtungen für Obdachlose. In dieser Armutsgeographie zwischen Stadtrand und Innenstadt bewegen sich die Obdachlosen und fallen als sichtbar Arme auf, indem sie die polarisierenden Konsequenzen städtischer Wachstumspolitik artikulieren.
In die beschriebenen allgemeinen Muster nach-fordistischer Lokalpolitik gerät Berlin im Zuge der Vereinigung beider Stadthälften.
3.3. Berlin: Vom Ort ideologischer Konfrontation zu internationaler Integration
Westberlin nimmt zwischen Kriegsende und Mauerfall unstreitbar eine Sonderrolle im internationalen Städtereigen ein. In den beiden Stadthälften verräumlichte sich die bipolare Weltordnung des Kalten Krieges. Der Westteil der Stadt zeichnete sich bis Mitte der 80er Jahre durch eine ausgesprochen distributive Lokalpolitik aus, die üppige fließende Bundesgelder in die Stadt vermittelte. Nutznießer war weniger die dem völkerrechtlichen Sonderstatus geschuldete Szene als die Industrie, die dank der Berlinhilfe eine lokale Ökonomie etablierte, die sich durch verlängerte Werkbänke und einen überdurchschnittlichen Anteil an Zigaretten- und Lebensmittelproduktion auszeichnet(e) (Häußermann/Strom, 1993). Demgegenüber war der Ostteil der Stadt in die nationale Ökonomie integriert und versammelte sowohl die Eliten der DDR, wie die Direktionszentralen der Kombinate. Weder die Subventions- noch die Kommandowirtschaft halten dem Vereinigungsdruck und der Weltmarktkonkurrenz stand. Von den 1991 in Berlin und angrenzenden Landkreisen existierenden 2 Mio. Arbeitsplätzen gehen bis 1993 18.000 im Westen und 150.000 im Osten verloren. Diese Arbeitsplätze waren überwiegend industriell geprägt, d.h. die Arbeiter können ihre Qualifikationen kaum in der anvisierten Dienstleistungsmetropole feilbieten.
Mit der abrupten Weltmarktintegration der Stadt gerät der Wohnungsmarkt unter Druck (vgl. Krätke 1991). Während Mieten steigen und Löhne sinken, zieht sich der Senat fast vollständig aus dem sozialen Wohnungsbau zurück. Die Wohnungsbaugesellschaften stunden (noch) stillschweigend Mietschulden[30] und präsentieren als Ergebnis eines neuen institutionellen Arrangements das geschützte Marktsegment als bundesweites Modellprojekt zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit: Jährlich 2.000 Wohneinheiten aus dem Bestand werden für Wohnungsnotfälle bereitgestellt, was ziemlich genau der Zahl zwangsgeräumter Wohnungen (1993) in Ostberlin entspricht (Tagespiegel, 11.10.1994).
Da die Integration Berlins in den Weltmarkt primär auf dem Immobiliensektor stattfindet[31] und zu aberwitzigen Bodenmartktpreisen führt, die nur noch durch Umwandlungen, Zweckentfremdungen, Luxusmodernisierungen usw. realisiert werden können, verschärft sich die Obdachlosenkrise, falls nicht mit gezielten Politiken gegengesteuert wird. Die von Staatssekretär Heuer (SenWiTech) angemahnten rigiden Anpassungsleistungen, mit dem Ziel, die Stadt in die erste Kategorie der internationalen Städtehierarchie zu katapultieren (vgl. Stadtforum 1994:8), lassen jedoch zunächst eine Vertiefung sozialräumlicher Polarisierungen erwarten.
Doch ist das Machtgefüge der Stadt, wie bereits erwähnt, nicht homogen, und die Öffentlichkeit nicht hinter einem eindeutigen Wachstumsziel vereint. Berlins urbanes Regime ist fragmentiert und so verfolgen andere Senatsverwaltungen und andere Ebenen politischer Partizipation konkurrierende Politiken. So nehmen Obdachlosigkeit und Verarmung besonders in der Senatsverwaltung für Soziales einen hohen Stellenwert ein.[32]
Es sieht daher so aus, als würde das Problem weniger von den zuständigen Verwaltungen (minimal: Bauen, Soziales, Gesundheit) als Querschnittsaufgabe definiert,als daß es zu einer arbeitsteiligen, funktionalen, flexiblen Bearbeitung zwischen der lokalen Staatsebene (hierzu zählt auch die Polizei), intermediären Organisationen alten und neuen Typs und Eigenorganisationsformen der Betroffenen kommt.
Dieses komplexe Zusammenspiel unterschiedlichster Akteure tritt seit den 80er Jahren immer dann auf, wenn lokale Konflikte die Problemlösungskompetenz der kommunalen Verwaltung übersteigen, also der Bedarf der Bevölkerung und die Leistungsfähigkeit der Verwaltung auseinanderklaffen. Intermediäre Organisationen nehmen eine wichtige Position in diesem neuen Kräftefeld ein. Sie initiieren Aushandlungsprozesse zwischen Basisinitiativen, staatlicher Planung und den marktwirtschaftlichen Gestaltungsprinzipien privater Akteure.
In Berlin entwickelten sich bundesweit die ersten intermediären Organisationen als zu Beginn der 80er Jahre der lokale Staat im Häuserkampf an die Grenze der Handlungsfähigkeit gerät. An diesem Beispiel erweist sich auch die Ambivalenz intermediärer Organisationen: Zwar wurden parteilich die Interessen der Betroffenen vertreten und eine Stadterneuerungspolitik gegen das zuvor hegemoniale Machtkartell (vgl.: Bodenschatz 1987) durchgesetzt, die mit dem bisherigen fordistischen Leitbild städtischer Entwicklung brach und weltweit zum Vorbild geriet: Behutsame Stadterneuerung. Doch wurde an der privatwirtschaftlichen Verwertung des Wohnraumes nicht gerüttelt. Der Einsatz intermediären Organisationen erscheint als Legitimationsentlastung des Staates durch verschobene Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.
So öffnen intermediäre Organisationen sowohl Handlungsspielräume und Partizipationschanchen benachteiligter Gruppen wie sie das Verwaltungshandeln flexibilisieren.
Unsere Forschungshypothese lautet, daß im Bereich der Armuts- und Obdachlosenpolitik die unterschiedlichsten Bedürfnisse der betroffenen heterogenen Teilgruppen nur durch neue institutionelle Arrangements und neue Aushandlungsformen zwischen allen Beteiligten befriedigt werden können. Dabei ist es notwendig, räumlich verfestigte Verarmungsprozesse als Resultate städtischer Entwicklungsoptionen zu rekonstruieren und Reformvorschläge im Rahmen einer sozialverträglichen Stadtentwicklungspolitik zu diskutieren.
3.3.1. Struktur der Hilfsangebote in Berlin
Der Berliner Senat definiert Obdachlose über den Kreis unmittelbar Betroffener (registrierter Wohnungsloser) hinaus als diejenigen, die unter unzumutbarer Wohnverhältnissen leben, von Obdachlosigkeit unmittelbar oder potentiell bedroht sind (Abgeordnetenhaus 12/3162:1f). Als Ursachen gilt das Zusammenspiel dreier gesellschaftlicher Problembereiche: Arbeitsmarkt (Arbeitslosigkeit und Niedriglohneinkommen), Wohnungsmarkt (mangelhaftes Angebot und Mietpreisentwicklung) und die Kreditvergabepraxis der Banken und Versandhäuser (Verschuldung der Haushalte). Um dieser Problemkonstellation gerecht zu werden, werden "ressortübergreifende Strategien und Maßnahmen erforderlich" (ebd.2). Angesichts des wachsenden Problemdruckes räumt der Senat der Bekämpfung von Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit hohe Priorität ein und kündigt die Erstellung eines integrativen Obdachlosenrahmenplanes an.
Die Obdachlosenhilfe in Berlin ist wie folgt gegliedert:
Die Zuständigkeit der Bezirke ist einerseits ordnungspolitisch definiert: Nach § 20 der Durchführungsverordnung zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG), nehmen die Bezirke die Unterbringungsverpflichtung Obdachloser wahr. Die zweite legislative Grundlage bildet das Bundessozialhilfegesetz. Insbesondere § 72 gewährleistet Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten Hilfe.
In 30 kommunalen Obdachlosenheimen sowie privaten Pensionen stehen 6.000 bis 7.000 Bettplätze zur Verfügung. Während in den Obdachlosenheimen die sozialpädagogische Betreuung gesichert ist, müssen die privat betriebenen Pensionen allein gesundheits- und bauaufsichtlichen Grundstandarts genügen[33]. In beiden Unterbringungsformen herrscht Anstalts- statt Mietrecht, d.h. die Rechte der Bewohner sind stark beschnitten, und Verstöße gegen die Hausordnung können polizeilich geahndet werden.
Die Aufgaben der Verhinderung von Obdachlosigkeit sowie der Beratung und Betreuung Betroffener sind den Arbeitsgruppen Soziale Wohnhilfen zugeordnet (das jeweilige Amt IV der bezirklichen Abteilung für Sozialwesen). Die Arbeitsweise der AGs unterscheiden sich von Bezirk zu Bezirk: Einige praktizieren ressortübergreifende Zusammenarbeit mit den betroffenen Abteilungen, andere nicht.
3.3.1.1. Wohlfahrtsverbände
Die freien Träger und Wohlfahrtsverbände stellen Beratungsstellen, Treffpunkte, Wohnprojekte u.ä. zur Verfügung. 1993 waren in Berlin folgende Hilfseinrichtungen vorhanden: 8 Projekte der besonderen sozialen Wohnhilfen (BESOWO), 8 Beratungsstellen für besondere Personengruppen, 7 Schuldnerberatungsstellen, 13 Wärmestuben, 24 Wohnprojekte (660 Wohnplätze), 7 Übergangswohnheime (326 Plätze), 2 Krisenübernachtungseinrichtungen (50 Plätze), 1 überregionale Notübernachtung (40 Plätze), 124 Notschlafplätze im Rahmen der saisonalen Kältehilfe für nicht-registrierte Wohnungslose.
Den bereits 1992 offiziell registrierten 9.840 Obdachlosen zu denen der Senat noch einmal soviel nicht registrierte Obdachlose hinzurechnet (Abgeordnetenhaus 12/3162:2), standen also 1993 bestenfalls 8.000 Betten zur Verfügung.
Neben diesen bezirklichen und wohlfahrtsverbandlichen Einrichtungen stellt die Senatsverwaltung für Soziales in Absprache mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften jährlich 2.000 Wohnungen für besondere Wohnungsnotfälle bereit. Die Umsetzung dieses geschützten Marktsegmentes erfordert die kostenneutrale Einrichtung ressortübergreifender Arbeitsgruppen in den Bezirken, die alle Wohnungsnotfälle zusammenfassen.
Alle genannten Maßnahmen werden im Bestand realisiert, d.h. es wird keine einzige zusätzliche Wohnung gebaut. An einer einzigen Stelle erwähnt die Drucksache des Abgeordnetenhauses "Kapitalkostenbeteiligungen der Sozialämter an Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie auch an Neubauvorhaben" (Abgeordnetenhaus 12/3162:6) zur Sicherung langfristiger Belegungsrechte für Obdachlose.
Trotz des hochgradig differenzierten Angebotes an Hilfseinrichtungen, fallen ganze soziale Gruppen aus der Wahrnehmung des Senates heraus. EinwanderInnen, die durchgängig dem stärksten Armutsrisiko ausgesetzt sind (vgl. Hanesch et al 1994), kommen in dem Bericht nicht vor, da ihre Form der Obdachlosigkeit (Überlegung) kaum sichtbar ist.
Das gleiche gilt für Frauen, die zwar als dynamisch wachsende Betroffenengruppe[34] beschrieben werden (Abgeordnetenhaus 12/1230), ohne daß angemessen reagiert wird: Auf 1.163 registrierte weibliche Obdachlose kommen 215 Wohnplätze in frauenspezifischen Projekten.
Der Bericht resümiert kritisch, daß die vorhandenen Einrichtungen weder qualitativ noch quantitativ ausreichten und daß der lokale Staat bei der Lösung der Obdachlosenkrise überfordert sei. Die Kontinuität des Elends wird im Leitbild metropolitaner Urbanität bedauernd festgeschrieben: "Auf der Straße lebende Menschen werden auch weiterhin für alle im Stadtbild sichtbar bleiben" (Abgeordnetenhaus 12/3162:6).
Der Senatsbericht veranschaulicht deutlich den Funktionswandel der Obdachlosenhilfe von der Integration zum Unterbringungsmanagement. Die Krisenrhetorik des Textes weist daraufhin, wie sehr selbst die Sicherung primärer Reproduktion metropolitaner Dynamisierung ausgesetzt ist. So finden sich kaum noch finanzierbare innerstädtische Grundstücke zum Ausbau der Hilfseinrichtungen. Damit ist die kleinteilige, dezentrale Versorgung gefährdet und wie der Städtetag 1993 warnt, ist, "das Ziel, Konzentrationen zu vermeiden, weil sie für die Betroffenen und das soziale Umfeld große Folgeprobleme schaffen, ... angesichts der Dimensionen des Problemdrucks nicht mehr aufrecht zu erhalten" (in Breckner/Kerschner:163).
Die kleinräumige Konzentration von Armutsbevölkerungen wird also bereits als Problem wahrgenommen.
3.3.1.2. Neue Akteure
In der Einheit von Problemstau und stattlicher Handlungsunfähigkeit geraten soziale Bewegungen unter Umständen zur letzten Innovationsreserve (Roth 1991). Für den Bereich der Armuts- und Obdachlosenpolitik verneint die Mehrzahl der Forschungen zu neuen sozialen Bewegungen diese Option (zum Beispiel. Bremen 1990), da sie stets von einer post-materialistischen Motivationsstruktur der Akteure ausgeht. Die Möglichkeit der Konstituiton einer Armutsbewegung wird mit Verweis auf die Heterogenität der Betroffenen weitgehend negativ eingeschätzt. Dieser sakrosankten Vorannahme stehen die Bewegungen der Armen und Obdachlosen für eine saubere Umwelt, soziale Gerechtigkeit und angemessenen Wohnraum in verschiedenen Städten der USA gegenüber (Keil 1990, Gottlieb 1993, Sambale 1994a). In der Bundesrepublik ist uns eine Fallstudie bekannt, die das Konstrukt des alleinstehenden Wohnungslosen dekonstruiert. Dieser Nichtseßhafte des § 72 BSHG zieht sich als sozial isolierter, unsteter Wanderer durch die Theorie und Praxis der Obdachlosenhilfe. Schmid (1990) beschreibt anhand der Obdachlosen und Nichtseßhaften in Augsburg Gruppenbildungsprozesse[35]. Dabei zeigt sich, das die institutionell untergebrachten Obdachlosen isolierter, abhängiger und verzweifelter sind als die Gruppe der Nichtseßhaften, die disziplinierende Hilfseinrichtungen nur in Krisensituationen aufsucht und über eine entwickelte Gruppenidentität verfügt.
In Berlin bestehen einige wenige Eigenorganisationsformen in einem institutionell gesicherten Rahmen. Neben den Kulturprojekten (Die Ratten, Unter Druck) sind dies vor allem die unterschiedlichen Zeitungsprojekte (MOB, Platte, HAZ), die den Betroffenen zielgerichtete Partizipation an neuen Formen lokaler Öffentlichkeit bieten. Daneben existiert mit der Plattengruppe e.V. ein Wohnprojekt, das aus einer Besetzung heraus entstanden ist und nun von SenSoz unterstützt wird.
Vor allem im Umfeld der Zeitungsprojekte entwickeln sich Diskussionen und Eigenorganisationsformen, die über den Charakter einer bloßen Beschäftigungstherapie hinausweisen. Hier entwickeln sich neue soziale Akteure mit denen die Sozialpolitik in Zukunft zu rechnen hat.
4. Konzeptioneller Rahmen des beantragten Forschungsprojektes
4.1. Fragedimensionen
Aus unserer Analyse des Zusammenhanges von Metropolenpolitik, Obdachlosigkeit und neuen Akteuren, sind folgende Fragedimensionen für das Forschungsvorhaben relevant.
4.1.1. Fragedimension Senat
A: Politik und Verwaltung
- Welche Konfliktlinien und Zielvorstellungen bezüglich er städtischen Entwicklungsziele bestehen innerhalb der relevanten Senatsverwaltungen und zwischen Ihnen?
- Welche Konfliktregelungsmechanismen existieren?
- Hat der gesellschaftliche Transformationsprozeß Auswirkungen auf die Problemwahrnehmung der Verwaltungen oder dominiert eine Wahrnehmung entlang der Ost/West- Problematik?
B: Armutsentwicklung und Obdachlosigkeit
- Gibt es Ansätze der Entwicklung einer sozialen Großstadtstrategie? Wenn ja, in welchen Senatsverwaltungen genießen diese Ansätze Legitimität, wo werden sie verworfen?
- Gibt es Überlegungen neue Akteure direkt in die Politikformulierung oder Implementierung einzubeziehen, z.B. bei der Erstellung des angekündigten Obdachlosenrahmenplanes wie von der AG Leben mit Obdachlosen gefordert (1994:2)?
- Werden alle städtischen Interventionsmöglichkeiten zur Sicherung preiswerten Wohnraumes ausgereizt? Beispiele sind der vermehrte Einsatz der Erhaltungssatzung, die Erhöhung der Bußgelder gegen Zweckentfremdung, Erhalt des städtischen Wohnungsbesitzes[36] (zum Beispiel Bodenvorratspolitik nach dem Vorbild der Gemeinde Amsterdam, die städtische Grundstücke - ca. 80% des lokalen Bodenmarktes - fast ausschließlich im Erbpachtsystem vergibt), Genehmigungsvorbehalte für die Aufteilung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen (durch die Nutzung der Ermächtigungskompetenz des Landes Berlins gefährdete Gebiete zu bestimmen und zu sichern).
- Fördert der Senat innovative Wege der Integration benachteiligter Bevölkerungsgruppen? Ein Beispiel bietet das Münchener WOHNFORUM, das mit Mitteln das EU-Programmes "Armut 3" ein integriertes Wohn- und Qualifizierungsprojekt für Wohnungsnotfälle entwickelt hat (s. Breckner 1994).
- Richtet der Senat die vom Städtetag geforderte "Integrierte Fachstelle zur Vermeidung und Bekämpfung von Wohnungslosigkeit" ein? Derzeit delegiert der Senat diese Aufgabe noch an die Bezirke.
4.1.2. Fragedimension Bezirk
- Wie gestaltet sich die Interaktion zwischen Bezirk und Senat in der Armuts- und Obdachlosenpolitik? Herrscht Kooperation, Konsens oder Konflikt?
- Wie verändert sich die Beziehung zwischen den Bezirken und den Wohlfahrtsverbänden im Zuge der Verwaltungsreform (Globalzuweisungen)? Setzen die Bezirke die Anbieter der freien Wohlfahrtspflege unter einen Restrukturierungsdruck?
- Machen die Bezirke im Interesse ihrer Armutsbevölkerung von der Souveränität über den Bebauungsplan Gebrauch (Ausweisung sozialer Infrastruktur)?
- In welchen Bezirken konzentrieren sich Armutslagen? Gibt es eine Geographie der Schlichtwohnungen und Provisorien? Entwickeln sich die Großsiedlungen der 60er Jahre zu Abschiebecontainern für Wohnungsnotfälle? Wenn ja, welche Rolle spielt das geschützte Marksegment bei diesen kleinräumigen Desintegrationsprozessen?
- Gibt es Bemühungen die Unterbringung Obdachloser in gewerblichen Pensionen abzubauen? Können kommunale Notunterkünfte saniert und die Nutzungsverhältnisse in einkommensabhängige Mietverhältnisse überführt werden?
- Inwieweit reproduziert die bezirkliche Unterbringungspraxis und das Unterbringungsmanagement der Verbände die soziale Notlage der Betroffenen?
4.1.3. Fragedimension Akteure
- Wie reagieren Wohlfahrtsverbände und andere Träger auf die Armutsdynamik?
- Lassen sich Konfliktlinien zwischen den kostenintensiven Anbietern professioneller Hilfe und den ehrenamtlich getragenen kirchlichen Einrichtungen ausmachen?
- Wie artikulieren die Träger ihre Interessen gegenüber Senat und Bezirk?
- Lassen sich neue Akteure identifizieren, die die Interessen der Armen und Wohnungslosen authentisch artikulieren? Wenn ja, haben diese Akteure feste organisatorische Formen, sind sie institutionell abgesichert? Gibt es unter ihnen Formen der Binnendifferenzierungen? Werden diese neuen Akteure von Bezirk und Verwaltung wahrgenommen? Partizipieren sie an politischen Entscheidungen oder werden sie ignoriert?
- Wie nehmen Politik, Verwaltung, Träger und Betroffene die unsichtbaren Formen der Wohnungslosigkeit wahr? Gibt es niedrigschwellige Angebote für obdachlose Einwanderer und Flüchtlinge? Wie kann man Frauen erreichen, die eher in einer Mißbrauchsbeziehung verbleiben (Wohnungsprostitution) als Hilfsangebote wahrnehmen?
Schließlich läßt sich anläßlich der Wahlen zum Abgeordnetenhaus während des Förderungszeitraumes prüfen, inwieweit Armut und Obdachlosigkeit den Diskurs über die Zukunft Berlins strukturieren. Gelingt es den Trägern, Betroffenen und fortschrittlichen Kräften der Stadt den hegemonialen Entwicklungspfad in Frage zu stellen und soziale Gerechtigkeit einzuklagen? Oder wird innerstädtische Obdachlosigkeit zum wahlkampfwirksamen Thema der inneren Sicherheit?
4.2. Arbeitsprogramm
4.2.1. Untersuchungsbereiche
Im Kontext unserer Forschungshypothese ist es notwendig, nicht allein das Handeln der Akteure zu untersuchen, die sich mit Obdachlosenpolitik auseinandersetzen, sondern auch mit denen, die ihre wohnungs- und sozialpolitische Verantwortlichkeit gerne leugnen. Neben zentralen Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände und den zuständigen Senatsverwaltungen und Bezirksämtern ist das Handeln der Senatsverwaltung für Wirtschaft und das der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz zu untersuchen. Weiter ist zu prüfen welche Rolle Polizei und Wachschutzdienste, BVG und Bahn AG spielen, die den Obdachlosen die wichtigen Ressourcen Innenstadt und öffentlicher Raum entziehen. Welche Zielvorstellungen verfolgen diese Akteure hinsichtlich der Obdachlosen, welche Handlungsressourcen kommandieren sie, welche Strategien verfolgen sie?
Zentral ist die Untersuchung der Obdachlosen und ihrer Organisationen: Wie reagieren sie auf die unterschiedlichen Politiken verschiedener Akteure? Mit welchen Taktiken antworten sie auf die Strategien der Ausgrenzung? Entstehen kollektive Lernprozesse, die zu einer veränderten Problemwahrnehmung führen?
Abgesehen von programmatischen Politikformulierungen des Senates und gesamtstädtischen Konflikten, werden wir unser Projekt auf der Bezirksebene focusieren, da hier die Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände konzentriert sind. Wichtiger noch ist, daß sich unsere These von der kleinräumigen Segmentierung hier belegen läßt. Wir denken daran, je einen innerstädtischen Bezirk in Ost und West auszuwählen und einen entwicklungsdynamischen Randbezirk[37]. Wir gehen davon aus, daß sich die krisenhaften Tendenzen in jedem der auszuwählenden Gebiete deutlich unterscheiden und werden die Politik der betroffenen Bezirke und die Angebote der Träger daraufhin befragen, ob und wie sie diesen Unterschieden gerecht werden.
4.2.2. Methoden
Unseren methodologischen Bezugsrahmen bildet die ethnologische Stadtforschung, die davon ausgeht, daß sich globale Prozesse lokal sozialräumlich und im Handeln der Akteure artikulieren (Kokot/Bommer 1991,Welz 1994, Lang 1994)). Die Rekonstruktion der Veränderungen erfolgt über Interviews, Dokumentenanalyse (Sitzungsprotokolle, Aktenanalyse, Auswertung der Tagespresse und der Straßenzeitungen, Fachliteratur) und der teilnehmenden Beobachtung (Sitzungen, Fachtagungen und Veranstaltungen).
Die strukturellen Bedingungen metropolitaner Verarmungsprozesse lassen sich hauptsächlich über Dokumente und Statistiken eruieren, während politische Bedingungen wie das Selbstverständnis der Akteure, ihre Problemwahrnehmung, ihr Verständnis des Verhältnisses von Bürokratie, Politik und neuen Akteuren usw. über strukturierte Gespräche oder Interviews ermittelt werden muß.
Aus unseren Voruntersuchungen hat sich ergeben, daß die teilnehmende Beobachtung sich über die gesamte Dauer des Forschungsvorhabens erstrecken wird, da die Diskussion über Wohnungslosigkeit nicht nur intensiv ist, sondern steten Veränderungen unterliegt. Wir werden unsere Zwischenergebnisse in diesen Prozeß der Diskursformation einbringen (konkrete Publikationsmöglichkeiten bestehen bei MOB und bei der TAZ)[38].
Während der Vorstudie wird der methodische Schwerpunkt auf der Dokumentenanalyse und den Experteninterviews liegen, um die zentralen Interessenskonflikte und die Planungsprozesse in Verwaltung und Verbänden zu rekonstruieren. Hier gilt es zur Erhärtung unserer These des Zusammenhanges von Metropolen- und Armutsentwicklung Daten und Aussagen zu sammeln. In diese Phase fällt die Identifikation der städtischen Teilräume, die wir einer genauen Analyse unterziehen. Im Rahmen dieser Voruntersuchung werden bestehende Kontakte vertieft und neue geknüpft. In diese Phase fällt auch die Ermittlung von Kenntnissen über die praktische Arbeitsweise aller relevanter Akteure und Institutionen. Dank dieser Bestandsaufnahme des Akteursnetzes und der Systematisierung der Arbeitsweisen, kann durch Vorgespräche ein Gesprächsleitfaden für die Intensivinterviews der Hauptphase entwickelt werden. Aufgrund unseres derzeitigen Kenntnisstandes beabsichtigen wir folgende Verteilung der Interviews: Verwaltungen (10-15), Vertreter der jeweiligen Bezirksverordnetenversammlung (je 3-5), Wohnungsbaugesellschaften (5), Wohlfahrtsverbände und Hilfseinrichtungen (10-15), Eigenprojekte der Obdachlosen (15-20). Wegen des Arbeitsaufwandes, den insbesondere Interviews mit sich bringen, soll die Obergrenze 50-60 Expertengespräche nicht überschreiten.
Kritische Stadtforschung kommt ohne Beteiligung der Forscher nicht aus. Wir planen eine Fachtagung mit den Akteuren, Betroffenen und interessierten Wissenschaftlern, um die Kluft zwischen dem Verständnis sozialer Verhältnisse und ihrer Veränderung zu überwinden. Die (fach-) öffentliche Diskussion unserer ersten Forschungsergebnisse soll der Entwicklung angemessener neuer Hilfsangebote und neuer institutioneller Arrangements dienen, die der spezifischen Situation Berlins gerecht werden. Darüber hinaus sollen während des gesamten Forschungsprojektes handlungs- und praxisrelevante Ergebnisse unserer Arbeit den Akteuren zur Verfügung gestellt werden, um den Forschungsprozeß kontinuierlich an die Praxis rückzukoppeln und einen Beitrag zum politischen, administrativen und sozialen Lernen der Handelnden und Forschenden zu leisten. Dadurch sollen differenzierte und problemadäquate wissenschaftliche Analysen und Handlungsspielräume der Praxis gleichzeitig verbessert werden, indem wir unsere Ergebnisse moderierend in die Praxis vermitteln, um Handlungsblockaden und Interaktionshemmnise unter den Akteuren zu beseitigen.
4.2.3. Untersuchungsschritte
Aus dem oben genannten Vorgehen, ergibt sich eine Aufteilung des Arbeitsprogrammes in vier Stufen:
Stufe 1: Voruntersuchung/Vorstudie (Oktober 1995 bis Februar/März 1996)
Oktober bis Dezember 1995
-> Bestandsaufnahme zur aktuellen Armuts- und Obdachlosigkeitsentwicklung in Berlin, zur Struktur und Geographie der Hilfseinrichtungen, zur Identifikation räumlich verfestigter Armutslagen, zur Kompetenzverteilung zwischen Bezirk/Senat/Wohlfahrtsverbänden, insbesondere vor dem Hintergrund der Verwaltungsreform
-> Analyse der Wahlkampfaussagen zu Armut und Obdachlosigkeit in Berlin, teilnehmende Beobachtung von Veranstaltungen in diesem Rahmen.
Januar bis Februar 1996
-> Entwicklung des Erhebungsinstrumentariums (Gesprächsleitfaden), Identifikation der Akteure und Kontaktaufnahme, Auswahl der Bezirke
Stufe 2: Hauptuntersuchung (März 1996 bis Dezember 1996)
März 1996
-> Pretest des Gesprächsleitfadens anhand von Probeinterviews mit je einem Vertreter des Senates, der Bezirke, der Wohlfahrtsverbände, der Wohnungsbaugesellschaften und der Eigenorganisationsformen Obdachloser.
-> Erstellung des ersten Zwischenberichtes
April bis November 1996
-> Durchführung der Intensivinterviews
-> Teilnehmende Beobachtung
-> Erste Auswertung der Arbeitsergebnisse
Dezember 1996
-> Verfertigung des zweiten Zwischenberichtes
Stufe 3: Fachtagung und Auswertung (Januar 1997 bis August 1997)
Januar und Februar 1997
-> Vorbereitung und Durchführung der für Februar vorgesehenen Fachtagung zur Obdachlosigkeit und innovativen lokalen Problemlösungsansätzen in Berlin. Wegen der saisonal bedingten Konjunktur des Themas kann mit erheblicher öffentlicher Aufmerksamkeit gerechnet werden.
März bis Juli 1997
-> Auswertung und Dokumentation der Fachtagung
-> Abschluß der Interviewauswertung und der teilnehmenden Beobachtung
Stufe 4: Schlußbericht (August bis September 1997)
August bis September 1997
-> Anfertigung des abschließenden Forschungsberichtes
4.3 Aufgabenbeschreibung (je Mitarbeiter)
Das oben dargestellte Arbeitsprogramm erfordert zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, um den notwendigen Umfang zu bewältigen. Dabei garantiert ein arbeitsteiliges Vorgehen nicht nur ein effektiveres Arbeiten, sondern ermöglicht auch in den einzelnen Arbeitsschritten (Kontakte, Kooperationen und Veranstaltungsbesuche im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung und auf die Materialsammlung und -auswertung) auf Kontakte und Ressourcen der Antragsteller zurückzugreifen. Diese orientieren sich an den inhaltlichen Vorarbeiten der Antragsteller (s.u.). Der oben formulierte Anspruch der praxisorientierten, zukunftsgerichteten Erweiterung der Bearbeitungskapazität aktueller lokaler Probleme durch die stete Rückkopplung mit den Gesprächspartner aus der Praxis erfordert die Teilnahme beider Mitarbeiter an jedem Expertengespräch und Interview, um systematisch Kommunikationsstörungen zu erkennen und zu beheben. Die Zusammenführung der Ergebnisse und deren Auswertung bzw. die Erstellung der Zwischenberichte und des Endberichtes wird in Teamarbeit geleistet.
4.3.1. Eigene Vorarbeiten und Studienschwerpunkte
Die Zusammenarbeit der Mitarbeiter hat sich bereits seit 1991 in unterschiedlichen universitären Arbeitszusammenhängen als erfolgreich erwiesen. 1991 wurde im Rahmen eines Spezialisierungskurses (Staat, Planung, Verwaltung) bei Prof. Dr. Wollmann eine empirische Studie zur Internationalen Bauausstellungs GmbH erstellt (in Zusammenarbeit mit Ö. Sütçü). Unter Betreuung von Prof. Dr. M. Mayer und Dr. R. Roth erarbeiteten die Antragsteller 1992 eine Projektkursarbeit zu innerstädtischen Konflikten und Akteuren am Beispiel der Spandauer Vorstadt in Berlin-Mitte (zusammen mit C. Schneider und C. Schaffelder). Im Rahmen dieser lokalen Fallstudien wurden umfangreiche Expertengespräche geführt.
Bei Priv.-Doz. Dr. B. v. Greiff und Dr. König wurde 1993 eine Projektkursarbeit erstellt, die die räumlichen Konsequenzen 'neuer Produktionskonzepte' zum Inhalt hatte (zusammen mit G. Geiger, D. Veith und H.-J. Passon).
Diese fruchtbare Zusammenarbeit wurde im Rahmen der Diplomvorbereitung und - durchführung fortgesetzt. Die Diskussionen, die während der jeweiligen Diplomphasen auf der Grundlage ähnlicher Studienschwerpunkte geführt wurden, wirkten sich aufschlußreich auf die jeweilige inhaltliche Arbeit aus.
Sowohl die Theorie- und Strategiediskussionen, als auch empirische Studien zur Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaupolitik und der 'städtischen sozialen Bewegungen' wurden von den Antragstellern über Jahre hinweg verfolgt. Einen Schwerpunkt bildete die Beschäftigung mit 'lokaler Politik' im Zeichen 'globaler Restrukturierung', von wo sich der theoretische Rahmen und bestimmte analytische Kategorien auch für die hier zu verfolgende Fragestellung ergaben.
Zur Vorbereitung dieses Antrages wurde zur Erarbeitung des Kontextwissens eine Analyse von Presseberichten und Dokumenten ebenso vorgenommen, wie die Auswertung der im Internet/Usenet (insbesondere csf.colorado.edu) international geführten Diskussion. Weiterhin wurden bereits umfangreiche Literatur und Datenbankrecherchen durchgeführt.
Darüber hinaus haben die Antragsteller zur Erstellung des vorliegenden Antrages bereits zahlreiche Kontakte geknüpft (vgl. Kooperationspartner- und einrichtungen) und mehrere Fachkonferenzen, Podiumsdiskussionen und Koordinationstreffen in Berlin besucht.
Von besonderem theoretischem Interesse waren dabei ein internationales Ph. D.-Seminar mit dem Thema 'Economic and Social Restructuring - Technological Change and Local Economic Policy' in Kopenhagen vom 12.-18. September 1994 (nur Jens Sambale) und eine Fachtagung zum Thema 'Stadtforschung und Regulation' in Frankfurt im Januar 1995, in deren Mittelpunkt sozialräumliche Polarisierungstendenzen und deren Regulation in deutschen Städten stand.
Wichtige Informationen und Anregungen für die empirische Arbeit konnten die Antragsteller bei zahlreichen Veranstaltung und Podiumsdiskussionen zum Thema Obdachlosigkeit sammeln. Herauszuheben ist hier die zweitägige Fachtagung der AG Leben mit Obdachlosen (Zusammenschluß überwiegend kirchlicher Obdachlosenprojekte) am 1./2. November 1994 und die Veranstaltung "Obdachlosigkeit und Widerstand. Erfahrungen aus Los Angeles, San Jose, Chicago und Berlin" am 26.07. 1994.
Seit Sommer 1994 besteht eine Zusammenarbeit mit der Obdachlosenzeitung MOB e.V., insbesondere zu deren Vorsitzenden Stefan Schneider, der zu dem Thema Obdachlosigkeit an der HdK promoviert. In diesem Rahmen wurden Kontakte zu Prof. Talmadge Wright an der Loyola University Chicago geknüpft und seit Oktober 1994 eine internationale Kooperation mit der Chicagoer Obdachlosenzeitung Streetwise aufgebaut.
Dipl.-Pol. Jens Sambale
Nach meinem Wechsel von der Johann-Wolgang-Goethe Universität in Frankfurt/M. an das Otto-Suhr-Institut der FU, habe ich mich im Hauptstudium auf Probleme der Stadtentwicklung und Industriegeographie konzentriert . Im Frühjahr und Sommer 1993 habe ich ein sechsmonatliches Praktikum in der Berliner Partnerstadt Los Angeles absolviert, die als Labor post-fordistischer Urbanisierungsmuster gilt. Ich habe mein Praktikum in einem multiethnischen sozialen Projekt (Labor/Community Strategy Center) abgeleistet, das sich der überaus erfolgreichen umwelt- und verkehrspolitischen Mobilisierung der Armuts- und Einwanderergemeinden der Stadt verschrieben hat. Darüber hinaus hatte ich Gelegenheit als Gasthörer an Seminaren der Graduate School of Architecture and Urban Planning (GSAUP) der University of California, Los Angeles (UCLA) teilzunehmen, an der die wichtigsten stadttheoretischen und industriegeographischen Ansätze der letzten Jahre entwickelt wurden.
Dipl.-Pol. Dominik Veith
Nachdem ich mich im Grundstudium mit den Problemen des bürgerlichen Verfassungsstaats in der Bundesrepublik und der Instiutionalisierung von Neuen Sozialen Bewegungen (z. B. DIE GRÜNEN) beschäftigt hatte (v. a. bei Prof. Dr. J. Agnoli sowie Dr. Murphy), legte ich im Hauptstudium mein Schwergewicht auf die Bereiche Stadtforschung und Theorie(n) der Regulation bzw. Fordismus/Postfordismus (u. a. bei Prof. Dr. M. Mayer, Prof. Dr. R. Roth, Dr. D. Rucht und Prof. Dr. P. Grottian). In zwei kürzeren Auslandsaufenthalten wurden theoretische Erkenntnisse praktisch vertieft (1990: Drei Monate in den USA/New York, 1995: Acht Monate in Bern). An der Universität Bern verfolgte ich bei Prof. Dr. C. Honnegger als Gasthörer kultursoziologisch orientierte Veranstaltungen mit dem Teilschwerpunkt Stadt.
Meine Diplomarbeit hat den Funktionswandel der bürgerlichen Kleinfamilie im Fordismus und Übergang zum Postfordismus zum Thema.
Prof. Dr. Margit Mayer
Die betreuende Hochschullehrerin, Prof. Dr. Margit Mayer (John F. Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin) arbeitet seit geraumer Zeit intensiv zu veränderten Formen "Lokaler Politik in der unternehmerischen Stadt" (1990, 1991a&b, 1992a&b, 1994a&b, 1995b&c), die sich weltweit durchsetzen. Die erforderlichen Anpassungsleistungen der Städte favorisieren weniger die traditionellen kommunalen Entscheidungsträger, als daß sie die Einbeziehung nicht-traditioneller Gruppierungen in die Politikformulierung und Implementierung fördern. Häufig geschieht dies in Form von Public Private Partnerships (Mayer 1994a) zwischen kommunalen Institutionen und marktwirtschaftlich orientierten Anbietern. Aber wie die Texte von Frau Mayer zeigen, ist diese Form nicht zwingend, ebensogut können intermediäre Organisationen aus dem Milieu der lokal verankerten Initiativen und Gruppen entstehen, die einen wachstumskritischen Entwicklungspfad fördern. Ihre These einer veränderten Stadtpolitik ist in verschiedenen Fallstudien für unterschiedliche Städte geprüft worden (vgl. Keil 1993), während die Fallstudien zu Berlin rar sind (z.B. das von Frau Mayer betreute laufende Projekt der Berlinforschung von Karin Lenard und Jürgen Ungerer zum Alexanderplatz).
Weitere relevante Erfahrungen für das beantragte Projekt ergeben sich aus ihrem Beitrag zur Neuen Obdachlosigkeit (1983), ihrer jüngsten Hinwendung zur komparativ orientierten Stadtforschung (Mayer 1995a, Mayer/Heinelt 1993) und den fortlaufend angebotenen Seminaren zur Metropolenpolitik. Frau Mayer ist in verschiedene internationale Arbeits- und Publikationszusammenhänge eingebunden, die sich mit verändernden Formen städtischer Regulation befassen (Centre for Research in European Urban Environments, University of Newcastle; International Journal of Urban and Regional Research; Series Editor of Blackwell for Studies in Urban and Social Change).
5. Kooperationspartner
Wir haben vor, mit folgenden Einrichtungen und Personen zu kooperieren. Von einigen haben wir bereits schriftliche Zusagen (*), von anderen telephonische (tel).
5.1. Verwaltungen:
Senatsverwaltung für Soziales (IV), Kontakt: Frau Burkhardt, Tel.: 2122 - 2829 (tel)
Senatsverwaltung für Soziales (Sozialplanung/Stadtentwicklungsplanung), Kontakt: Herr Wiebusch, Tel.: 2122 - 2815 (tel)
Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen (Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung [IV]), Kontakt: Herr Fuderholz, Tel.: 867 - 4849
Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen (Mieten und Wohnungspolitik, Neubauförderung [IVA]): Herr Weippert, Tel.: 867 - 4810 (tel)
Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen (Städtische Wohnungsbaugesellschaften/ juristische Angelegenheiten [IVF/Jur]), Kontakt: Herr Groth, Tel.: 867 - 4703
Senatsverwaltung für Jugend und Familie
Bezirksämter
5.2. Universitäten / Wissenschaft
Prof. Dr. Hartmut Häußermann, HUB, Tel.: 20315-215 (tel)
Prof. Dr. Jens Dangschat, Uni Hamburg, Tel.: 040 - 4123 - 2463 (tel)
Thomas v. Freyberg, Institut für Sozialforschung Frankfurt, Tel.: 069 - 756183 - 41 (*)
Prof. Talmadge Wright, Loyola University Chicago, E-Mail:
Dr. Roger Keil, York University Toronto, E-Mail:
Prof. Dr. Dieter Goll, Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit Berlin, Tel.: 8214526
Prof. Dr. Otto Schlosser, FHSS Berlin, Tel.: 21458 - 331
Stefan Schneider, HdK Berlin, Tel.: 31852527 (*)
5.3. Wohlfahrtsverbände
Diakonisches Werk, Kontakt: Hermann Pfahler, Tel.: 82097 - 190 (tel)
Caritas, Kontakt über Beratungsstelle Levetzowstraße (s.u.) (*)
5.4. Projekte
MOB, Kontakt: Stefan Schneider und Redaktion, Tel.: 2834624 (*)
Odachlosenzeitungen 'Die Platte' und 'HAZ'
AG Leben mit Obdachlosen, Kontakt: Pastoralreferent H.-J. Ditz, Tel.: 6144052 (*)
Beratungsstelle Levetzowstraße, Kontakt: Sven Bahlmann, Tel.: 3913095 (*)
Obdachlosentheaterprojekt 'Die Ratten', Kontakt: Roland Brus
Plattengruppe Köpenick, Kontakt: Jürgen Putze, Tel.: 6519043
Die Laufmasche; Beratungsstelle für Frauen, Tel.: 28464161/2
Sozialpolitische Offensive Frankfurt/M., Kontakt: C. Petersen, Tel.: 069 - 439396 (tel)
5.5. Wohnungsloseneinrichtungen
St. Michaelis Gemeinde, Kontakt: H.-J. Ditz, Tel: 6144052 (*)
Berliner Initiative Nichtseßhaftenhilfe, Kontakt über Beratungsstelle Levetzowstraße
Wohnungslosentagesstätte Seeling Treff (Charlottenburg), Kontakt: D. Berndt (Leiterin), Tel.: 3212026
Krankenwohnprojekt Lichtenberg Magdalenenstraße, Kontakt: B. Mallman
Wohnungslosentagesstätte Schöneberg, Kontakt: M. v. Münchhofen (Leiter), Tel.: 2117956
5.6. Sonstige
Wohnungsbaugesellschaften (GSW, u.a.)
Die Tageszeitung, Kontakt: D. Wildt (Redakteur für Landespolitik, Berlin), Tel.: 25902 - 246 (*)
6. Literatur
- Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 12/1230 (1992): Große Anfrage der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD über die Lebenssituation Obdachloser und Nichtseßhafter, unter besonderer Berücksichtigung der Frauen, im Land Berlin
- Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 12/3162 (1993): Mitteilung -zur Kenntnisnahme- über die Fortschritte in der Tätigkeit des Senates zur Wiedereingliederung von Obdachlosen und der Verhinderung drohender Obdachlosigkeit
- Arbeitsgemeinschaft Leben mit Obdachlosen (1994): Politische Forderungen, unveröffentliches Manuskripte
- Arbeitsgemeinschaft Leben mit Obdachlosen, o.T., o.J., o.O.
- Alisch, Monika/Jens Dangschat (1993): Die solidarische Stadt: Ursachen von Armut und Strategien für einen sozialen Ausgleich, Darmstadt, 1993
- Amin. Ash (Hg.) (1994): Post-Fordism: A Reader, Oxford
- Arch+ (1994): Von Berlin nach Neuteutonia, Heft 122
- BAGS, Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales der Freien und Hansestadt Hamburg (1993): Armut in Hamburg, Beiträge zur Sozialberichterstattung, Hamburg
- Bernsdorf, W. (Hg.) (1969): Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart
- BINFO (1990): Informationsdienst der Berliner Initiative für Nichtseßhaftenhilfe e.V., Januar/Februar 1990, Nr. IV, Berlin
- Blanke, B./Benzler, S., Hg. (1991): Staat und Stadt. Systematische, vergleichende und problemorientierte Analysen 'dezentraler' Politik. PVS Sonderheft, Opladen
- Blau, J. (1992): The Visible Poor. Homelessness in the US, NYC
- Blume, O. (1969): Obdachlose, in: Bernsdorf: 743-749
- Bodenschatz, Harald (1987): Platz frei für das neue Berlin. Geschichte der Stadterneuerung in der größten Mietskasernenstadt der Welt seit 1871, Berlin
- Bodenschatz, Harald (1989): Zur Krise des sozialstaatlichen Stadtentwicklungsmodells, in: RaumPlanung 46/47
- Borst, R. et al, Hg. (1990): Das neue Gesicht der Städte. Theoretische Ansätze und empirische Befunde aus der internationalen Debatte, Basel, Boston, Berlin
- Breckner, I. (1994): Lokales Handeln gegen Armut und Wohnungsnot. Konzeption und Ergebnis des EG- Modellprojektes WOHNFORUM München, in: Breckner/Kerschner: 97-123
- Breckner et al (1989): Armut im Reichtum. Erscheinungsformen, Ursachen und Handlungsstrategien in ausgewählten Großstädten der Bundesrepublik, Bochum
- Breckner, I./Kerschner, K. (1994): Armut und Wohnungsnot. Von der Ohnmacht zu praktischen Handlungsalternativen, Münster
- Bremen, Klaus (1990): Partizipation und Selbstorganisation von Armen
- Bündnis '90/DIE GRÜNEN, Landesverband Berlin (1995): Berlin als umwelt- und menschenfreundliche Metropole. Programmatische Grundsätze 1995, unveröffentlichter Entwurf für die Landesdelegiertenkonferenz am 03. März 1995
- Danielzyk, Rainer (1992): Gibt es im Ruhrgebiet eine postfordistische Regionalpolitik? in: Geographische Zeitschrift, 1992, Heft 2, Schwerpunkt Regulationstheorie
- Davis, Mike (1990): City of Quarz. Excavating the Future of Los Angeles, New York, 1995 unter dem gleichen Titel auf deutsch erschienen
- Döring, D./Hanesch, W./Huster, E. (1990): Armut als Lebenslage. Ein Konzept für Armutsberichterstattung und Armutspolitik, in: Döring, D. et al
- Döring, D./Hanesch, W./Huster, E. (Hg.) (1990): Armut im Wohlstand, Frankfurt/M.
- Duncan, S., Goodwin, M., Halford, S., (1987): Politikmuster im lokalen Staat. Ungleiche Entwicklung und lokale soziale Verhältnisse, in PROKLA 68: 8-30
- Dunford, Mike/Grigoris Kafkalas (Hg.) (1992): Cities and regions in the new Europe, London: 255-274
- Einem, E.v. (1990): Berlin-Scenario 2010 - Flächen und Standorte. Referat zum Symposium "Metropole Berlin: Mehr als Markt!", Hrsg. Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH, Berlin
- Eick, Volker (1994): Killing Them Softly...: Berlin And Its Post-Fordist Security System, Vortragsmanuskript für das Ph. D. Seminar: Economic And Social Restructuring- Technological Change And Local Economic Policy, Copenhagen
- Esser, J., Hirsch, J. (1987): Staatsoziologie und Gesellschaftstheorie: Von der Fordismuskrise zur 'postfordistischen' Regional- und Stadtstruktur, in: Prigge 1987: 31-56
- Feagin J.,Smith P. (1990): <Global Cities> und neue internationale Arbeitsteilung, in: Borst et. al. (1990): 62-89
- Freyberg, Thomas von (1994): Bedingungen und Möglichkeiten einer kommunalen Armutsberichterstattung, Institut für Sozialforschung: Mitteilungen, Heft 4, September 1994:14- 41
- Friedmann, J., (1986): The World City Hypothesis, in: Development and Change, Vol. 17, No. 1: 69 - 83
- Friedmann, J., (1993): Where we Stand: A Decade of World City Research, Paper Prepared for the Conference of World Cities in a World System, Sterling, VA
- Friedmann, J., Wolff, G., (1982): World City Formation. An Agenda for Research and Action, in: IJUUR, 1982:309-343
- Getimis, P./Kafkalas, G. (Hg.) (1993): Urban And Regional Development in The New Europe, Athen
- Gottlieb, R. (1993): Forcing the Spring. The Transformation of the American Environmental Movement, Washington/Covelo
- Hanesch, Walter et. al. (1994): Armut in Deutschland. Der Armutsbericht des DGB und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Reinbeck
- Harvey, D., (1989a): The Urban Experience, Baltimore
- Harvey, D. (1989b): From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism, in: Geografiska Annaler, 71 B, 1: 3-17
- Harvey, D. (1987): Flexibele Akkumulation durch Urbanisierung. Reflexionen über den Postfordismus in amerikanischen Städten, in: PROKLA 69, 109-145
- Hauser, R. (1984): Armut im Wohlfahrtsstaat, in: Lampert/Kühlewind
- Hauser, Richard/Udo Neumann (1992): Armut in der Bundesrepublik Deutschland. Die sozialwissenschaftliche Thematisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Leibfried/Voges: 237-271
- Häußermann, H., (1991a): Lokale Politik und Zentralstaat. Ist auf kommunaler Ebene eine 'alternative Politik' möglich? In: Heinelt, H., Wollmann, H. (Hg.): 52-92
- Häußermann, H., (1991b): Die Bedeutung 'lokaler Politik' - neue Forschung zu einem alten Thema, in: Blanke,B., Benzler, S.
- Häußermann, Hartmut (Hg.) (1992): Ökonomie und Politik in alten Industrieregionen Europas, Probleme der Stadt- und Regionalentwicklung in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien - Basel, Boston, Berlin
- Häußermann, Hartmut/Walter Siebel (Hg.) (1993a): New York. Strukturen einer Metropole, Frankfurt/M.
- Häußermann, H./Siebel, W. (Hg.) (1993b): Festivalisierung der Stadtpolitik. Stadtentwicklung durch große Projekte. Leviathan Sonderheft 13, Opladen
- Häußermann, H./Strom, E. (1993): Berlin: The Once And Future Capital, unveröffentlichtes Manuskript
- Healy, Patsy et al (Hg.) (1995): Managing Cities: The New Urban Context, Chister
- Heinelt, H., Wollmann, H., (Hg.) (1991): Brennpunkt Stadt, Basel, Boston, Berlin 1991
- Heinelt, Helmut/Margit Mayer (1993): Europäische Städte im Umbruch: Zur Bedeutung lokaler Politik, in: Mayer/Heinelt
- Hitz, Hansruedi et al (Hg.) (1995): Capitales Fatales - Urbanisierung und Politik in den Finanzmetropolen Frankfurt und Zürich, Zürich (im Erscheinen)
- Holtmanspötter, H. (1982): Plädoyer zur Trennung von dem Begriff Nichtseßhaftenhilfe, in: Gefährdetenhilfe 4/82, S.1-2
- Jahn, Walther (1994): Von der fordistischen zur post-fordistischen Stadt. 30 Jahre Stadterneuerungspolitik in Berlin, Diplomarbeit am Fachbereich 15 der FU Berlin
- Keil, R., (1990): Neue Bewegung in der Stadt: Strategien zwischen Arbeiten und Wohnen am Beispiel von Los Angeles, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegung Nr. 4, 57 - 65
- Keil, R., (1993): Welt-Stadt - Stadt der Welt: Internationalisierung, Urbanisierung und lokale Politik in Los Angeles, Münster
- Keil, R./Kipfer, S (1994): Weltwirtschaft/Wirtschaftswelten. Globale Transformationen im lokalen Raum, in: Noller et al: 83 - 94
- Keil, R., Lieser, P., (1992): Frankfurt: Global City - Local Politics, in: Smith, M., 1992: 39 - 69
- Keil, R., Ruddick, S., (1988): Living in a Box. Nachbarschaft am Ende der Straße, in: Kommune 12/1988: 36 - 41
- Keil, Roger/Ronneberger, Klaus (1991): Macht und Räumlichkeit. Die Weltstadt geht aufs Dorf, in: Brauerhoch: 125-147
- Keil, Roger/Ronneberger, Klaus (1993): Riding The Tiger of Modernization: Red-Green Municipal Reform Politics in Frankfurt am Main, in: Capitalism, Nature, Socialism, 4(2), June 1993: 19-50
- Kokot, W./Bommer B. (Hg.) (1991): Ethnologische Stadtforschung, Berlin
- Kommunalverband Großraum Hannover (1992): Die sozialen und politischen Strukturen Hannovers in kleinräumlicher Gliederung. Beiträge zur regionalen Entwicklung, Band 30.1/30.2, Hannover
- Können, Ralf (1990): Wohnungsnot und Obdachlosigkeit im Sozialstaat, Frankfurt 1990
- Krätke, S. (1991): Berlins Umbau zur neuen Metropole, in: Leviathan 3/1991:327-352
- Krätke,S./Schmoll, F. (1987): Der lokale Staat-Ausführungsorgan oder Gegenmacht? in: PROKLA 17,3 :30-72
- Krause, Peter (1994): Zur zeitlichen Dimension von Einkommensarmut, in: Hanesch et. al: 189-205
- Kronawitter, Georg: (Hg.) (1994): Rettet unsere Städte jetzt! Das Manifest der Oberbürgermeister. Düsseldorf, Wien, New York, Moskau
- Lampert, H./Kühlewind, G. (Hg.) (1984): Das Sozialsystem der Bundesrepublik. Bilanz und Perspektiven. Beiträge zu Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Band 38, Nürnberg
- Lutz, Burkhard (1985): Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Eine Neuinterpretation der industrie-kapitalistischen Entwicklung im Europa des 20. Jahrhunderts. Frankfurt/M. und New York
- Landeshauptstadt Stuttgart (1990): Soziale Ungleichheit und Armut. Sozialhilfebericht für die Stadt Stuttgart. Beiträge zur Stadtentwicklung, Band 30, Stuttgart
- Landeshaupttadt München, Sozialreferat (1991): Münchener Armutsbericht `90. Beiträge zur Sozialplanung, Band 6, München
- Lang, Barbara (1994): Mythos Kreuzberg, in: Leviathan 4/1994:498-519
- Leibfried, Stephan/Voges, Wolfgang (Hg) (1992): Armut im modernen Wohlfahrtsstaat, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialphilosophie, Sonderheft 32, Opladen
- Leisering, Lutz/Voges, Wolgang (1992): Erzeugt der Wohlfahrtsstaat seine eigene Klientel? Eine theoretische und empirische Analyse von Armutsprozessen, in: Leibfried/Voges
- Logan, J.R./Molotch, H.L. (1987): Urban Fortunes. The Political Economy of Place, Berkeley und Los Angeles
- Mädje, Eva/Claudia Neusüß (1994): Alleinerziehende Sozialhilfeempfängerinnen zwischen sozialpolitischen Anspruch und gesellschaftlicher Realität, in: Zwick et al: 134-156
- Marcuse, Peter (1993): Wohnen in New York. Segregation und fortgeschrittene Obdachlosigkeit in einer viergeteilten Stadt, in: Häußermann/Siebel (1993a): 205-239
- Mayer Margit/Katz, S. (1983): Neue Obdachlosigkeit, in: Dollars und Träume 8
- Mayer, Margit (1987): Restructuring and Popular Opposition in West German Cities, in: Smith/Feagin
- Mayer, Margit (1990): Lokale Politik in der unternehmerischen Stadt, in: Borst, R. et al 1990: 190-208
- Mayer, Margit (1991a) :'Postfordismus' und 'lokaler Staat', in: Heinelt, H./ Wollmann, H., 1991: 31-52
- Mayer, Margit (1991b): Neue Trends in der Stadtpolitik - eine Herausforderung für die Lokale Politikforschung, in: Blanke,B./Benzler,S., 1992: 51-69
- Mayer, Margit (1992a): Lokale Politik: Zivilisierung durch neue Funktionen und Institutionen?, in: Wentz
- Mayer, Margit (1992b): The Shifting Local Political System in European Cities, in:Dunford/Kaskalas: 255-274
- Mayer, Margit (1993): The Role of Urban Social Movement Organizations in Innovative Urban Policies And Institutions, in: Getimis/Kafkalas: 209-226
- Mayer, Margit (1994a): Public-Private Partnerships, in: Roth/Wollmann
- Mayer, Margit (1994b): Post-Fordist City Politics, in: Amin:316-337
- Mayer, Margit (1995a): Städte im Vergleich: Los Angeles und Berlin, unveröffentlichtes Vortragsmanuskript
- Mayer, Margit (1995b): Stadtpolitik im Umbruch, in: Hitz et al
- Mayer, Margit (1995c): Urban Governance in the Post-Fordist City, in: Healy et al
- Mayer, Margit/Heinelt Helmut (Hg.) (1993): Politik in europäischen Städten: Fallstudien zur Bedeutung lokaler Politik, Basel/Boston/Berlin
- Moellenkopf, Castells, M. (1991): Dual City. Restructuring New York City, NY 1992
- Moos, A. (1989): The Grassroots in Action: Gays And Seniors Capture The Local State in West Hollywood, California, in: Wolch/Dear:351-370
- Noller, Peter et.al. (1994): Zur Theorie der Globalisierung, in Noller et.al.: 13-24
- Noller, Peter, Walter Prigge, Klaus Ronneberger (Hg), (1994): Stadt-Welt: Über die Globalisierung städtischer Milieus, Frankfurt am Main, New York
- Prigge, W., Hg., (1987): Die Materialität des Städtischen: Stadtentwicklung und Urbanität im Umbruch Basel/Boston/Berlin 1987
- Rebmann, H (1968): Das Erscheinungsbild nichtseßhafter Männer aus der Sicht einer Arbeiterkolonie, in: Der Wanderer, 10, Nr.1/2: 8-11
- Rommelspacher, Thomas (1992): Wandel der Großstadtpolitik in einer alten Industrieregion: Die Beispiele Duisburg, Essen und Bochum, in: Häußermann: 154-177
- Ronneberger, Klaus (1994a): Die Neuen Städter, in: Noller et. al.: 249-258
- Ronneberger, Klaus (1994b): Zitadellenökonomie und soziale Transformation der Stadt, in: Noller et.al.: 180-198
- Roth, R., (1991): Städtische soziale Bewegungen und grün-alternative Kommunalpolitik, in: Heinelt, H./Wollmann, H. (Hg.): 167-187
- Roth, R./Wollmann, H.(Hg.) (1994): Kommunalpolitik in der Bundesrepublik in den 90er Jahren
- Ruddick, Sue (1995): Heterotopias of The Homeless: Strategies And Tactics of Plcemaking in Los Angeles, im Erscheinen
- Sambale, Jens (1994a): Fluchtpunkt Los Angeles. Zur Regulation sozialer Verhältnisse durch lokale Umweltpolitiken in einer internationalisierten urbanen Region, Diplomarbeit am Fachbereich 125 der FU Berlin
- Sambale, Jens (1994b): Organizing The Postfordist City. The Emergence of an Anticorporate Movement Around Environmental Issues in Los Angeles, Vortragsmanuskript für das Ph. D. Seminar: Economic And Social Restructuring- Technological Change And Local Economic Policy, Copenhagen
- Sassen, S. (1991a) : The Global City. New York, London, Tokio
- Sassen, S. (1991b): Neue Trends in der sozialräumlichen Organisation von New York City, in: Wentz: 1991
- Schmid, Carola (1990): Die Randgruppe der Stadtstreicher im Teufelskreis der Nichtseßhaftigkeit, Wien
- Schneider, Stefan (1990): Wohnungslose sind gesellschaftliche Subjekte. Gesellschaftliche Bedingungen und individuelle Tätigkeiten am Beispiel der Besucher der Wärmestube Warmer Otto in Berlin-Moabit, Berlin, unveröffentliche Diplomarbeit an der TU Berlin
- Scott, A. (1988): Metropolis. From the Division of Labor to Urban Form, Berkeley/Los Angeles
- Smith, M., Hg., (1992): After Modernism, Global Restructuring and the Changing Boundaries of City Life, New Brunswick, London
- Smith, M.P./Feagin, J. (Hg.) (1987): The Capitalist City. Global Restructuring and Community Politics, Oxford, New York
- Smith, N. (1992): New City, New Frontier: The Lower East Side as Wild Wild West, in: Sorkin:1992: 61-94
- Smith, N., (1987): Of Yuppies and Housing: Gentrification, Social Restructuring, And The Urban Dream, in: Environment And Planning D: Society and Space, Vol.5, 1987:151 - 172
- Sorkin, M., Hg. (1992): Variations on a Theme Park, New York 1992
- Stadt Essen, Amt für Entwicklungsplanung, Statistik, Stadtforschung, Wahlen und Stadtarchiv (1990): Soziale Ungleichheit im Stadtgebiet. Kleinräumige Betrachtungen der Sozialstruktur, Essen
- Stadt Frankfurt am Main, Dezernent für Soziales, Jugend und Wohnungswesen (1988): Stadtteil-Sozialatlas. Ergebnisse für die Gesamtstadt. Reihe Soziales, Jugend und Wohnungswesen, Band 12, Frankfurt/M
- Stadtforum Berlin (1994): Protokoll der 35. Sitzung des Stadtforums. Zukunft der Arbeit in der Stadt (10 und 11. Dezember 1993)
- Stone, C.N. (1993): Urban Regimes: A Political Economy Approach, in: Journal of Urban Affairs, 15 (1): 1-28
- Storper, M., Walker, R., (1989): The Capitalist Imperative:Territory, Technolgy and Industrial Growth, New York
- Storper, Michael (1995): The Resurgence of Regional Economies, Ten Years Later: The Region as a Nexus of Untraded Interdependencies, in: European Urban and Regional Studies, forthcoming
- Strom, Liz (1994): In Search of The Growth Coalition: American Urban Theories And The Redevelopment of Berlin, submitted to: Urban Affairs Quarterly, November 1994
- Treuberg, Eberhard von (1990): Mythos Nichtseßhaftigkeit. Zur Geschichte des wissenschaftlichen, staatlichen und privatwohltätigen Umganges mit einem diskriminierten Problem, Bielefeld
- Toth, J. (1993): The Mole People. Life in the Tunnels Beneath New York City, Chicago, 1995 auf deutsch erschienen
- Wagner, David/Marcia B. Cohen (1991): The Power of The People: Homeless Protesters in The Aftermath of Social Movement Participation, in: Social Problems, Vol. 38, No. 4, November 1991
- Welz, Gisela (1994): Der Tod des Lokalen als Ekstase des Lokalismus, in: Noller et.al.: 218-228
- Wentz, M. Hg. (1991): Stadt-Räume, FFM Campus
- Wentz, Martin (Hg.) (1992): Planungskulturen. Die Zukunft des Städtischen, Frankfurt/M
- Wolch, J./Dear, M., Hg. (1989): The Power of Geography. How Territory Shapes Social Life, Los Angeles
- Wolch, Jennifer/Michael Dear (1993): Malign Neglect. Homelessness in an American City, San Francisco
- Wollman, H., Heinelt, H. (Hg.), (1991): Brennpunkt Stadt: Stadtpolitik und lokale Politikforschung in den 80er und 90er Jahren, Basel, Boston, Berlin
- Wright, Talmadge (1993): Forcing Collective Identities: Student And Homeless Resistances to Spatial Dispersment, submitted to: Social Problems, December 1993
- Wright, Talmadge (1994): Homeless Collective Empowerment Strategies: San Jose, California vs. Chicago, Illinois, Votragsmanuskript für den 13. Weltsoziologenkongreß in Bielefeld, July 1994
- Wüst, Thomas (1994): Political, Economic and Social Developments And Current Problems of Hamburg, Vortragsmanuskript für das Ph. D. Seminar: Economic And Social Restructuring- Technological Change And Local Economic Policy, Copenhagen
- Zwick, Michael (Hg.) (1994): Einmal arm, immer arm? Neue Befunde zur Armut in Deutschland
Anmerkungen
[1] Dieser Kampfbegriff des Unmenschen wurde Mitte der 1920er Jahre in der Wanderarmenhilfe zur Stigmatisierung der Fürsorgeempfänger geprägt und bereitete deren spätere Vernichtung diskursiv vor (Treuberg:59).
[*] Alle Zahlen, soweit nicht anders vermerkt, entstammen dem Statistischen Jahrbuch 1993 für Berlin oder der, über Datex-J zugänglichen Datenbank des Statistischen Landesamtes Berlin.
[2] Nach Schätzungen der Treberhilfe halten sich allein im Westteil Berlins 4.500 obdachlose 18-25jährige auf (zitiert in Abgeordnetenhaus 12/1230).
[3] Die tautologische Definition lautet: "Nichtseßhafte sind Personen, die ohne gesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage umherziehen oder die sich ... in einer Einrichtung für Nichtseßhafte aufhalten". Der Begriff der Nichtseßhaftigkeit ist nationalsozialistischen Ursprungs und wird von der Senatsverwaltung für Soziales abgelehnt. Auch der Entwurf zur Neufassung des BSHG verwendet diesen Begriff nicht länger. Zur Karriere des Begriffes vgl. Treuberg (1989).
[4] Vgl. Häußermann/Siebel (1993b).
[5] Der Wohnungsbau geht von 21.671 Wohneinheiten 1971 auf 8.344 neue Wohnungen 1993 zurück, von denen nur noch 3.265 im Sozialen Wohnungsbau errichtet werden.
[6] Der Einwand Obdachlosigkeit entstehe nicht notwendig am Ort ihrer Sichtbarkeit, sondern sei der bundesweiten Attraktivität der Stadt Berlin und ihres Hilfesystems geschuldet, läßt sich zumindest für die registrierten Obdachlosen statistisch nicht erhärten: Von den 1992 nahezu 10.000 erfaßten Obdachlosen in Berlin-West hatten 631 zuvor eine Wohnung in den Altbundesländern, bei 757 Betroffenen war der frühere Wohnsitz entweder nicht auszumachen oder lag im Ausland. Kein Obdachloser kam aus den Neuen Ländern oder aus Berlin Ost! Über 86% hatten also zuvor eine Wohnung in Westberlin (Statistisches Jahrbuch 1993:450).
[7] Die kleinräumige, verdrängungswirksame Aufwertung innerstädtischen Altbaubestandes (Gentrification) artikuliert den Umbau der städtischen Sozialstruktur und die Polarisierung der Einkommen architektonisch, vgl. Smith (1987 und 1992).
[8] Die von den Liebhabern wie den Verächtern der Metropole aufgemachte Antagonismus zwischen dem omnipotenten internationalen Investitionskapital und der wehrlosen Lokalbevölkerung ist nicht haltbar. Erstens verlaufen die Konfliktlinien eher zwischen internationalen Investoren und Lokalunternehmen, wie zum Beispiel. im Berliner Architekturstreit (s. Arch[+] 1994) und zweitens müssen globale Kapitalströme über lokale Akteure und Institutionen in die konkrete Stadt vermittelt werden und sich lokalen Machtverhältnissen anpassen. Das Tauschwertinteresse der Investoren an der Stadt muß immer politisch mit dem Gebrauchswertinteresse ihrer Bewohner vermittelt werden.
[9] So mahnt die AG Leben mit Obdachlosen "Theoriebildung in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Fachhochschulen" (o.O., o.J.) als Bestandsvoraussetzung der Bekämpfung der Obdachlosenkrise an.
[10] Ein Überblick über den Forschungsstand zeigt, daß über weite Strecken die durch Fremdheitserfahrung bestimmte Hilfepraxis, die soziale Marginalisierung und Stigmatisierung und die räumliche Ausgrenzung Obdachloser, durch den Forschungsmainstream reproduziert und in den Stand unhinterfragten Alltagswissens erhoben werden (vgl. Treuberg 7.4.5.)
[11] Friedrich von Bodelschwingh spricht noch 1959 von "Verwitterungserscheinungen am Volkskörper" (zitiert nach Treuberg, 1989:152).
[12] Für einen Überblick siehe Ralf Können (1990: 6.2.1. und 6.2.2.)
[13] Als (einkommens-) arm gilt, wer sich für den Bezug von Sozialhilfe (HLU) qualifiziert.
[14] Laut dem gemeinsamen Armutsbericht von DGB und Paritätischem Wohlfahrtsverband (1994) zählen 42% aller ostdeutschen Haushalte mit 3 oder mehr Kindern zu den Verarmten.
[15] Dazu trägt die administrative Trennung in Obdachlose (Familien und Teilfamillien) und Nichtseßhafte (alleinstehende Männer ohne festen Wohnsitz) bei.
[16] Als Neue Obdachlosigkeit verstehen wir die Erscheinungen der Wohnungslosigkeit, die sich von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung entkoppeln.
[17] Diese Aufsatzsammlung wurde bis in die liberalen Medien hinein positiv rezipiert (Zeit 28.10.1994 und TAZ 22.10.1994)
[18] Das heißt keineswegs, daß der Ansatz völlig untauglich wäre. So kann nur er erklären, wieso Armutsphänomene mittlerweile zur Lebensrealität auch der Mittelschicht gehören und nicht auf den unteren Einkommensbereich beschränkt bleiben, wie die These der 2/3 Gesellschaft suggeriert. Vgl. z.B. den Text von Mädje/Neusüß (1994) zum offensiven Einsatz von Sozialhilfe durch alleinerziehende Mütter in Berlin.
[19] siehe zum Beispiel: Stadt Frankfurt am Main (1988), Breckner et al. (1989), Landeshauptstadt Stuttgart (1990), Stadt Essen (1990), Landeshauptstadt München (1991), Kommunalverband (1992), BAGS (1993)
[20] Grundlegend Esser/Hirsch (1987), für einen Überblick Borst et al (1990), auf europäischer Ebene Heinelt/Mayer (1993), zu Frankfurt/Main Keil/Ronneberger (1993) und Keil/Lieser (1992), zu Hamburg Alisch/Dangschat (1993), zu Berlin Krätke (1991).
[21] Wir begreifen Urbanisierung als das Wachstum und die Veränderung von Städten sowie derer interner sozialer Regulation. Der spezifische Urbanisierungsprozeß ist somit Ausdruck sozialer Praxis.
[22] Zum Beispiel in der Form intermediärer Organisationen, s.u.
[23] Zu den industriegeographischen Konsequenzen, also der Frage: Wer investiert wo und warum?, siehe die Arbeiten von Scott (1988) und Storper (1989 und 1995).
[24] Duisburgs Haushalt ist seit 1975 mit Ausnahme dreier Jahre chronisch defizitär. Die Stadt verliert zwischen 1970 und 1989 109.000 Einwohner (überwiegend jung, qualifiziert und einkommensstark) und 74.000 Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote beträgt 27% und 33.000 Personen erhalten Sozialhilfe/HLU (alle Zahlen: Rommelspacher 1992).
[25] In diesen ausgesuchten Zentralen (New York, London, Tokio) konzentrieren sich die Entscheidungszentralen transnationaler Konzerne zur Koordination ihrer weltweit verstreuten Produktionsanlagen (Sassen 1991a&b Friedmann 1986 und 1993). Im deutschen Sprachraum werden Zürich und Frankfurt/M. zu global cities zweiter Ordnung gerechnet (Hitz et al 1995). Besonders Frankfurt/Main zeichnet sich durch extreme sozialräumliche Polarisierung und ethnische Segmentierung der Arbeits- und Wohnungsmärkte aus (Ronneberger 1994a, Keil/Ronneberger 1993 und 1991, Stadt Frankfurt am Main, 1988).
[26] Nach dem programmatischen Wandel der Stadtentwicklungspolitik in Hamburg 1983 from ships to chips, von der Schwerindustrie zu Hochtechnolgie und Dienstleistungen steigt das lokale Bruttosozialprodukt zwar von 75 Millionen auf 125 Millionen (1992) bei steten Arbeitsplatz- und Bevölkerungszuwächsen, doch gleichzeitig wächst der Bevölkerungsanteil der permanent von Sozialhilfe abhängig ist 1992 auf 10% (vgl. Wüst 1994).
[27] Diese Annahme erhöhter städtischer Handlungskompetenz wurde als Theorie des lokalen Staates in Großbritannien entwickelt (Duncan/Goodwin 1985 und Duncan/Goodwin/Halford, 1987) und seit Mitte der 80er Jahre auch in der Bundesrepublik rezipiert. Für Berlin vgl. Krätke/Schmoll (1987), generell Mayer (passim) und Blanke (1991), ablehnend Häußermann (1991a&b).
[28] Vgl. Zum Beispiel Ronneberger zur expressiven Ungleichheit in Frankfurt am Main: "Während die moderne Großstadt für Egalität und Massenkultur stand, stellte metropolitane Urbanität eine Form dar, in der soziale Gegensätze als ein natürlicher Bestandteil pluraler Lebensstile legitimiert und festgeschrieben werden konnte" (1994:255).
[29] Die Sicherung der hohen Attraktivität und Lebensqualität innerstädtischer Erlebnisräume wird in Krisenzeiten zur Aufgabe von Architektur, Polizei und Wachdiensten, die sanitäre Funktionen erfüllen und den Zugang zu öffentlichen Räumen kontrollieren. Ethnizität und Kaufkraft reglementieren den Zugang und setzen so besonders jugendliche Einwanderer und Obdachlose einem steten Vertreibungsdruck aus, vgl. Davis zu Los Angeles (1990) und Eick zu Berlin (1994).
[30] Die Summe der Mietschulden allein der Ostberliner Wohnungsbaugesellschaften beträgt mittlerweile 51 Millionen DM (Tagesspiegel 11. 10. 1994).
[31] In der Euphorie der Haupstadtentscheidung wird 1991 ein jährlicher Büroflächenbedarf von 900.00 qm prognostiziert (Krätke 1991) - trotz des vorhandenen Nachholbedarfes eine überzogene Zahl, da selbst die Boomtown Frankfurt/M im Jahresdurchschnitt nur 360.000 qm absetzt. Gegenwärtig sind 11 Million qm Bürofläche im Bau oder in Vorbereitung, 280.000qm stehen bereits leer (Bündnis '90/DIE GRÜNEN, 1995:46)
[32] Allerdings wird das Problem auch exklusiv hier fixiert.
[33] Die skandalösen Zustände in diesen überteuerten Läusepensionen haben dazu geführt, daß mittlerweile an einer überbezirklichen Vereinbarung zur Kontrolle gewerblicher Herbergen gearbeitet wird (Berliner Zeitung 8.10.1994).
[34] Vor allem in den östlichen Stadtbezirken zeichnet die Überschuldung von Haushalten alleinerziehender Frauen mit der absehbaren Konsequenz des Wohnungsverlustes ab (Abgeordnetenhaus12/3162:5).
[35] In den USA sind die Prozesse des Community-Building und des Collective Empowerment unter Obdachlosen weitaus besser untersucht. Siehe z.B. Wright (1993 und 1994), Ruddik (1995), Wagner/Cohen (1991), Wolch/Dear (1993) etwas sensationalistisch Toth (1994), auf deutsch Keil/Ruddik (1988).
[36] Derzeit sind 590.000 Wohneinheiten im Besitz städtischer Wohnungsbaugesellschaften, diese Zahl soll bis zum Jahr 2000 auf 443.000 verringert werden (Tagesspiegel 23.08.1994).
[37] Kreuzberg bietet sich wegen der internationalisierten Bevölkerung und nachtraditionellen Lebensformen zur Untersuchung unsichtbarer Formen der Obdachlosigkeit an. Zudem weist der Bezirk schon im Oktober 1989 fast 1000 untergebrachte Obdachlose und 110 Bauwagen und Zelte auf (BINFO 1990), was auf eine lokale Konzentration der Obdachlosen schließen läßt: Über 10% der Betroffenen auf weniger als 1.5% der Stadtfläche.
[38] siehe Anhang.
Vollständiges Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung
2. Kurzbeschreibung des Forschungsgegenstandes
3. Forschungsstand : Obdachlosigkeit und Metropolenentwicklung
3.1. Obdachlosigkeit
3.1.1. Obdachlosigkeit und Armutsentwicklung
3.2. Metropolenentwicklung
3.2.1. Globalisierung und Lokalisierung
3.2.2. Metropolenpolitik
3.2.3. Die Restrukturierung der Innenstädte
3.3. Berlin : Vom Ort ideologischer Konfrontation zu internationaler Integration
3.3.1. Struktur der Hilfsangebote in Berlin
3.3.1.1. Wohlfahrtsverbände
3.3.1.2. Neue Akteure
4. Konzeptioneller Rahmen des beantragten Forschungsprojektes
4.1. Fragedimensionen
4.1.1. Fragedimension Senat
4.1.2. Fragedimension Bezirk
4.1.3. Fragedimension Akteure
4.2. Arbeitsprogramm
4.2.1. Untersuchungsbereiche
4.2.2. Methoden
4.2.3. Untersuchungsschritte
4.3. Aufgabenbeschreibung (je Mitarbeiter)
4.3.1.Eigene Vorarbeiten und Studienschwerpunkte
5. Kooperationspartner
5.1. Verwaltungen
5.2. Universitäten / Wissenschaft
5.3. Wohlfahrtsverbände
5.4. Projekte
5.5. Wohnungsloseneinrichtungen
5.6. Sonstige
6. Literatur
Anmerkungen
THEATER - DER WEG ZUM EMPOWERMENT
Die unkonventionelle Methode zur Arbeit mit KlientInnen von sozialtherapeutischen Einrichtungen im Bereich der Obdachlosigkeit
Diplomarbeit verfaßt von
Erstbegutachterin: DSA Angelika Pfeisinger-Riedl
Zweitbegutachter: DSA Bernhard Lehr Wien, Februar 1997
Bundesakademie für Sozialarbeit, Grenzackerstraße 18, 1100 Wien
Inhaltsverzeichnis
-
Vorbemerkung/ Danksagung
1. Einleitung
2. Empowerment
3. Theater in der sozialen und therapeutischen Praxis
4. Versuch der Charakterisierung von KlientInnen sozialtherapeutischer Einrichtungen
am Beispiel des Vinzenzhauses der Caritas
5. Theater als Methode zum Empowerment
6. Praxisteil
7. Zusammenfassung
8. Anhang
9. Anmerkungen
10. Quellenverzeichnis
Vollständiges Inhaltsverzeichnis
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei ...
- ... meinen Eltern, Gertraude und Gottfried, und meinem Lebensgefährten Franz, die an mich geglaubt und mir die Ausbildung an der Akademie für Sozialarbeit erst möglich gemacht haben.
- ... Mag. Christian Wetschka, der mich seit Jahrzehnten in allem unterstützt.
- ... Walter Obermülner und Barbara Laimer, die sich die Zeit nahmen diese Arbeit zu korrigieren.
- ... Mag. Gerhard Leis, den ich auch noch zu später Stunde um Rat bezüglich der deutschen
- Rechtsschreibung fragen konnte.
- ... DSA Angelika Pfeisinger-Riedl, die sich viel Zeit nahm, damit diese Arbeit überhaupt zustande kam und sogar während der Ferien belästigbar war.
- ... DSA Johanna Coulin-Kuglitsch und DSA Bernhard Lehr für das Zur- Verfügung-Stellen von Literatur.
- ... Ludwig Zeissner, Dr. Jutta Guttmann, Petra Bayr und Mag. Christian Wetschka für die
- Gedanken, die ich in den Interviews einfangen durfte.
- ... dem K.a.W.-Team (ehem. PRO-95) für die jahrelange freundschaftliche Zusammenarbeit, sowie den TeilnehmerInnen am Projekt PRO-95, die die Grundlage für diese Arbeit geschaffen haben.
- ... Barbara Guwak, Verena Spitz, Penny Bayr, Ernst Ruppert, Roman Rathler, Clemens Schneider, Sibylle Koch, Barbara Novak und allen anderen AktivistInnen der StudentInnengruppe der Gewerkschaft der Privatangestellten, die mich in den letzten Monaten unterstützt, am Leben erhalten, aufgebaut, beraten, mit Beispielen beliefert, u.s.w. haben
- ... meiner lebenslangen Freundin Margit Lindner, die mich aufnahm, wenn ich eine Arbeitsklausur, fern von daheim, für notwendig befand.
- ... allen anderen Menschen, die mich eine Zeit lang durch mein Leben begleitet und zu meinem Empowermentprozeß beigetragen haben.
"Die grundlegende Regel, wonach Spiel kein Spiel, sondern todernst ist, macht das Leben zu einem Spiel ohne Ende, das eben nur der Tod beendet. Und - als wäre das nicht schon paradox genug - hier liegt eine zweite Paradoxie: Die einzige Regel, die dieses todernste Spiel beenden könnte, ist nicht selbst eine seiner Regeln, Für sie gibt es verschiedene Namen, die an sich ein und dasselbe bedeuten: Fairneß, Vertrauen, Toleranz."
"Wir zeigen demjenigen, der das Auseinanderfallen seines Ichs erlebt hat, daß er die Stücke jederzeit in beliebiger Ordnung neu zusammenstellen und daß er damit eine unendliche Mannigfaltigkeit des Lebensspiels erzielen kann. Wie der Dichter aus einer Handvoll Figuren ein Drama schafft, so bauen wir aus den Figuren unseres zerlegten Ichs immerzu neue Gruppen, mit neuen Spielen und Spannungen, mit ewig neuen Situationen."
Hermann Hesse
"Von allen Künsten ist die dramatische Kunst am stärksten mit unserem Lebensgefüge vermengt. Sie ist nicht nur an unsere Vergnügungen und unsere Feste gebunden, sondern es genügt schon ein Blick um uns herum, und wir sehen, wie sie spontan geboren wird und sozusagen in verschwommenem Stadium aufblüht. Komödie spielen ist eine Übung, der sich kein Lebender entziehen kann: Die Verwandlungsfähigkeit bei Tier und Pflanze, das Spiel bei Menschen und Tier, sind bereits Theater." 01
Das menschliche Lernen erfolgt noch während seiner Kindheit im Spiel, wie uns die Entwicklungspsychologie und die Pädagogik lehrt. Viele Menschen verlernen allerdings im Laufe ihres Lebens im kindlichen Sinne zu spielen. Fortan sind Brett-, Karten- oder neuerdings Video- und Computerspiele der Inbegriff des Spiels. Nun will ich den Wert von Wissens- oder darstellenden Kreativspielen nicht mindern, doch mußte ich feststellen, daß viele unserer KlientInnen im Bereich der ehemals obdachlosen AlkoholikerInnen große Scham zeigen, wenn es um das freie Spiel geht.
Unsere Arbeit zeigt uns, daß der Einsatz von Kreativität und Spiel Empowermentprozesse nicht nur inizieren, sondern sie auch tragend fortführen kann. In diesem Zusammenhang spielt besonders das Theater mit seinen ungeahnten Möglichkeiten des Spiels und der Kreativität eine große Rolle.
Diese Arbeit soll zeigen, daß Theaterspielen, das zu den Grundspielformen der Menschen zählt (wir erinnern uns alle an die Puppenecke im Kindergarten und das "Mutter-Vater-Kind"-Spiel ...), und Empowerment (vgl. Pkt. 2) kongeniale Allianzen im Kontext der Sozialarbeit eingehen. Sie stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Von ihm geht alles aus, zu ihm fließt alles zurück. Theater ist Lebensbewältigungstraining, Empowerment ist die sozialarbeiterische Grundhaltung in die sich Theaterarbeit mit KlientInnen einbettet.
Die nachfolgende Arbeit kann nur als ein Versuch betrachtet werden, diesen Themenbereich wissenschaftlich aufzuarbeiten. Ich glaube, daß alle mit dem Menschen arbeitenden Professionen sich mehr mit der Theaterarbeit in ihrem Berufsfeld und somit einer Orientierung an den Kompetenzen ihrer KlientInnen bzw. PatientInnen (Empowerment) beschäftigen müssen, denn sie vereinigt Innen- und Außenzweck in sich. Das heißt sie unterstützt und iniziert Empowermentprozesse bei den KlientInnen und ist Träger der institutionellen Inhalte nach Außen (Öffentlichkeitsarbeit). Nur durch ein verstärktes Einbeziehen von Theatertechniken und Empowermenthaltung in die Sozialarbeit können wir der Öffentlichkeit und somit auch den Financiers unserer Arbeit klar machen, daß dramatische Kunst und Kreativprozesse nicht nur Jux und Tollerei, Spaß für die KlientInnen und die Professionellen sind - das alleine würde einen Einsatz von Geldressourcen meiner Meinung nach schon rechtfertigen -, sondern daß kreative Empowermentarbeit KlientInnen stärkt, sodaß sie ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen können. Hilfe zur Selbsthilfe, ein klassisches Schlagwort der Sozialarbeit, das auch für das in dieser Arbeit behandelte Thema gilt.
"Solange es Unwissenheit und Not auf der Welt gibt, werden Werke wie dieses nicht unnötig sein." Victor Hugo "Les Miserables"
2. EMPOWERMENT
2.1. Zum Begriff des Empowerments
Grundsätzlich übersetze ich Empowerment mit "Selbststärkung". Bei STARK wird Empowerment nicht ins Deutsche übertragen, es wird kein Wort in unserer Sprache dafür belegt. STARK möchte damit vereinfachende und verfälschende Begrifflichkeiten vermeiden.
"Ein Blick in das Lexikon liefert folgende, eher passivierende Übersetzungen des englischen Begriffs: "to empower" - jemanden ermächtigen, jemandem die Vollmacht erteilen, etwas zu tun; "to be empowered" - ermächtigt oder befugt sein, die Vollmacht zu haben, etwas zu tun. Im sozialen Zusammenhang werden diese eher juristischen Bedeutungen jedoch erweitert und in einer aktiveren Form gebraucht." 02
Aus diesem Grund, und weil für mich "Empowerment" den Fachausdruck zu einer Haltung bzw. einem Ziel in der Sozialarbeit darstellt, möchte auch ich das englische Wort beibehalten.
Empowerment ringt uns eine neue Denkform ab. Es stellt nicht nur einen Begriff dar, mit dem eine sozialarbeiterische oder therapeutische Methode bezeichnet wird, sondern es ist eine Grundhaltung, die die SozialarbeiterInnen verinnerlichen müssen, um Empowermentprozesse gezielt unterstützen zu können.
Um dem Thema Empowerment näher zu kommen, möchte ich an dieser Stelle eine Geschichte aus W. STARK zitieren, die die bestehende Situation in der psychosozialen Praxis sehr gut darstellt:
"There was once a health worker who found herself by a raging river, when she heard a cry for help. She immediately jumped into the river, pulled the man to the shore, and applied artificial respiration. Just when he started breathing, she heard another cry for help, so she jumped back into the river, pulled the man to the shore and applied artificial respiration. Just when he began to breath, she heard another cry for help, so back into the river she jumped. Now, she was so busy jumping in, pulling to the shore, and applying artificial respiration that she had no time to see who the hell was upstream pushing all those guys in." 03
Das Zitat zielt auf die Entwicklung der Selbsthilfebewegung im sozialpolitischen Kontext ab. SozialarbeiterInnen sind zum Teil auch heute noch damit beschäftigt, KlientInnen "zu retten", ihnen zu helfen, sodaß sie sich den Umständen, die zur KlientInnenflut führen, unter der die meisten aber leiden, nur schwer zuwenden können. Nicht weil SozialarbeiterInnen nicht fähig sind die gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge zu analysieren, sondern weil das Problem, das sie tagtäglich in Form einer Unzahl von hilfsbedürftigen KlientInnen vor Augen haben, ihnen die Aussicht auf die Ursachen, die dahinter stehen, versperrt. Diese Behauptung ist mit der einfachen Boal'schen Übung des Manipulationsspiels zu belegen. Beim Manipulationsspiel 04 hält einE FührerIn der/dem/den PartnerInnen die Handinnenfläche nur wenige Zentimeter vor die Nase. Die Geführten müssen jede Bewegung der Hand mitmachen. Bei den Nachbesprechungen kommt es immer zu der Aussage, daß das "Rundherum" nicht wahrgenommen werden konnte, weil die Konzentration auf die unterdrückende und sehr präsente Hand den Blick auf die anderen Dinge verstellt hätte. Das bedeutet, daß SozialarbeiterInnen aufgrund von Streß, zu wenig Kapazitäten, geringer Ressourcen, Burn-Out, etc. die Symptome einer kranken Gesellschaft bearbeiten, die "Wurzel der Krankheit" aber außer acht lassen müssen, um die tägliche Arbeit bewältigen zu können.
Empowerment ist keine Methode und deshalb schwer zu fassen. Empowerment zeigt sich am deutlichsten in der Einstellung und Orientierung der SozialarbeiterInnen. Diese Sichtweise, daß nämlich die "philosophische Orientierung des Beraters" 05 für die Steuerung von Prozessen im psychischen oder sozialen Bereich ausschlaggebend ist, ist durch die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie von C.R. ROGERS überzeugend dargelegt worden.
"Richtiger wäre es zu sagen, daß der Berater, der in der klientbezogenen Therapie erfolgreich tätig ist, über ein zusammenhängendes und ständig sich weiterentwickelndes, tief in seiner Persönlichkeitsstruktur verwurzeltes Sortiment von Einstellungen verfügt, ein System von Einstellungen, das von Techniken und Methoden, die mit diesem System übereinstimmen, ergänzt wird. Nach unserer Erfahrung ist ein Berater, der versucht, eine Methode anzuwenden, zu Mißerfolg verurteilt, solange diese Methode nicht mit seinen eigenen Grundeinstellungen übereinstimmt." 06
Aus späteren Publikationen ROGERS' wissen wir, daß er seine klientenzentrierte Methode auch auf die Sozialarbeit angewendet sehen wollte. 07 Wenn wir uns fragen, was der Kern der "philosophischen Orientierung des Beraters" in der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie und im Empowerment ist, dann ist dies zunächst die Übereinstimmung von Denken und Tun. Zugleich aber, ist es der Glaube an die Würde des Menschen. Mit ROGERS müssen wir uns mit folgenden Aspekten auseinandersetzen:
"Gestehen wir jedem Menschen seinen ihm gemäßen Wert, seine ihm gemäße Würde zu? Wenn wir diese Auffassung auf der verbalen Ebene vertreten, wie weit ist sie dann auf der Verhaltensebene praktisch wirksam? Neigen wir dazu, Individuen als Menschen von Wert zu behandeln, oder entwerten wir sie insgeheim durch unsere Einstellungen und unser Verhalten? (...) Achten wir seine Befähigung und sein Recht zur Selbstlenkung, oder glauben wir im Grunde, daß sein Leben am besten von uns geleitet würde? Bis zu welchem Grad haben wir das Bedürfnis und den Wunsch, andere zu beherrschen? Sind wir damit einverstanden, daß das Individuum seine eigenen Werte auswählt und erwählt? (...)" 08
Die Überzeugung von der Selbstregulierungsfähigkeit des Individuums in Verbindung mit dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten zum persönlichen Wachstum, ist für ROGERS, sowie für das Empowermentkonzept, tragend. Dadurch, daß Empowerment ein Prozeß ist, der sowohl die KlientInnen als auch die SozialarbeiterInnen einbezieht, läßt sich der Prozeß Empowerment nur umschreiben und nicht genau definieren. Die persönliche Reife der SozialarbeiterInnen aber auch die Strukturen, in denen Sozialarbeit stattfindet, stellen Ausgangspunkte dar. "Reife" jedoch ist wissenschaftlich kaum operationalisierbar.
Vor diesem Hintergrund - Empowerment als Philosophie der Reife - läßt sich auch erkennen, daß Empowerment ein Potential der Kritik an sozialen Institutionen in sich birgt, nämlich dann, wenn Institutionen vorgeben, Ziele zu erreichen (die sie genau genommen sowieso nicht erreichen können), aber ihre Grundhaltung zur Erreichung der Ziele denselben widerspricht. Im Zeitalter des Qualitätsmanagements wird es für soziale Einrichtungen zur Notwendigkeit Ziele zu formulieren, die Erreichung dieser Zielvorgaben kann jedoch nicht in jedem Fall überprüft werden. Es verhält sich dabei so wie bei der Überprüfung von Zielvorgaben in der Psychotherapie: Entwicklungsfortschritte bei Menschen können nur höchst individuell bestimmt werden. Zwischen den "objektiven" Zielvorgaben und der subjektiven Erreichung der Ziele klafft ein unüberbrückbarer Abgrund. Für ein Qualitätsmanagement im sozialen oder therapeutischen Bereich müßte die Bewertung von Prozeßfortschritten herangezogen werden, dies ist aber praktisch nicht durchführbar. Die Empowermentperspektive hält uns an, die innere Haltung, respektive den Focus, der zur Beurteilung von Fortschritten angewendet wird, zu hinterfragen. Dies müßte in ein sozialtherapeutisches Qualitätsmanagement einfließen. In Suchttherapiestationen ist es das vorgegebene Ziel, mit den PatientInnen eine Totalabstinenz zu erreichen. Gemessen an dieser Zielsetzung scheitern 80 % dieser Therapien. 09 Die "Fortschritte" der PatientInnen liegen vielfach jedoch in einem anderen Bereich. Wer es z.B. nach einer Therapie schafft weniger, das heißt kontrolliert, zu trinken, ist gemäß der Zielsetzung nicht erfolgreich, das heißt aber auch, daß es gerade die Zielvorgaben sind, die die Feststellung des Erfolges unmöglich machen.
Mit A. WILSON SCHAEF ist Empowerment als Weg zu sehen, der die Selbstheilungskräfte des Menschen fördert, der vom Suchtsystem, in dem wir leben, zum System der Lebensprozesse führt. "Sucht" ist für SCHAEF ein Begriff für den kranken Zustand unserer gesamten Gesellschaft, die Sucht des einzelnen ist nur ein Spiegelbild des Suchtprozesses der Gesellschaft. SCHAEF verwendet hier den Vergleich mit einem Hologramm:
"Das wesentliche Merkmal eines Hologramms liegt darin, daß jedes seiner Teilchen die gesamte Struktur des gesamten Hologramms enthält; das einzelne Teilstück ist nicht etwa bloß Teil des Ganzen, vielmehr enthält es das vollständige Modell und die Funktionsweise des Ganzen. Genauso müssen wir uns das Suchtsystem vorstellen. Das System schließt das Individuum ein, und das Individuum trägt das System in sich. Anders formuliert: Das Suchtsystem weist die selben Züge auf wie der einzelne Alkoholiker oder Süchtige." 10
Die Heilung der Sucht bedeutet immer einen Paradigmenwechsel, ein neues Denken, eine neue Haltung gegenüber dem Leben und der Gesellschaft. Empowerment fordert ebenso eine Veränderung der zugrundeliegenden Einstellung gegenüber sich selbst (als SozialarbeiterIn) und den KlientInnen. Gleichzeitig wird sichtbar, daß Empowerment nichts ist, was sich alleine in einem Individuum oder innerhalb einer Gruppe ereignet, sondern daß Prozesse in Gang gesetzt werden, die auf die Gesellschaft als Ganzes rückwirken. Die Dynamik von Empowermentprozessen kann innerhalb eines Systems z.B. eines Wohnheims, einer Theatergruppe, einer Haftentlassenengruppe beginnen, kann aber auch politische Dimensionen annehmen. Empowermentprozesse
2.2. Empowerment nach STARK
"Empowerment kann als ein andauernder, zielgerichteter Prozeß im Rahmen kleiner, meist lokaler Gemeinschaften verstanden werden. Er beinhaltet wechselseitige Achtung und Fürsorge, kritische Reflexion und Bewußtwerdung der Akteure, durch die eine Form der Teilhabe für die Personen oder Gruppen ermöglicht wird, die einen unzureichenden Zugang zu wichtigen sozialen Ressourcen haben. Durch diesen Prozeß können sie diesen Zugang verbessern und die für sie wesentlichen sozialen Ressourcen stärker kontrollieren." 11 STARK steht für ein Umdenken in der psychosozialen Praxis ein. Er kritisiert die derzeit übliche Form der Sozialarbeit mit Orientierung auf die Defizite. Er plädiert für die Ausrichtung der Arbeit an den Kompetenzen der KlientInnen. Diese gelte es vor allem zu sehen, zu erkennen und in den Mittelpunkt der eigenen Arbeit zu stellen.
SozialarbeiterInnen sind darauf trainiert Defizite zu sehen, diese anzusprechen und Lösungsstrategien zu finden, die das erkannte "Loch" stopfen könnten und von den KlientInnen angenommen werden. Aufgrund der manifesten Autoritätshörigkeit hierzulande sowie den materiellen Ressourcen, die hinter der Institution bzw. SozialarbeiterIn stehen, machen KlientInnen - sehr oft halbherzig - mit. Beteiligen sie sich nicht, so erhalten sie Auflagen oder es erfolgt der Rausschmiß aus einer Unterbringungseinrichtung, nur die Teilauszahlung der Sozialhilfe, die Streichung der Sonderbeihilfen, etc. Das Ergebnis der "aufgezwungenen" Therapie, des "geregelten Arbeitsplatzes" als Grundlage für eine weitere Leistung, der "konzeptmäßigen" Abstinenz, etc. bewirkt in den meisten Fällen einen Rückfall in alte Verhaltensmuster und Lebensweisen. Wir wissen seit langem, daß nur jene Interventionen wirklich erfolgreich sind, die die KlientInnen auch selbst wollen und unterstützen. Sie können nur jene Strategien für gut heißen, die sie kennen und für die sie die Kraft haben. Hier setzt Empowerment an.
Wenn wir den KlientInnen ermöglichen sich zu stärken, dann werden sie unsere Angebote eher annehmen und Veränderungen in ihrem Leben leichter durchstehen.
2.2.1. Die Bewältigung von Lebensereignissen und -situationen
Die Sozialpsychiatrie definiert psychische Störungen über die bio-psycho-soziale Ebene. Das bedeutet, daß für das Entstehen, den Ausbruch und den Verlauf von psychischen Krankheiten, zu denen natürlich auch die Sucht zählt, die körperliche Konstitution, die innere seelische Verfassung der PatientInnen, das familiäre und soziale Umfeld, sowie Faktoren wie z.B. die Lebenssituation, die finanzielle Situation, etc. verantwortlich sind. Die KlientInnen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, sind sehr oft auch psychisch krank oder sie haben "inadäquate" Copingstrategien entwickelt. Das bedeutet, sie sind drogenabhängig, alkoholkrank, neurotisch, psychotisch, etc. und leb(t)en aufgrund eines "Life-event" auf der Straße. Sie gehören zu jener Gruppe, die nach derzeit gültiger SozialarbeiterInnenmeinung eine große Anzahl von Defiziten in sich vereinen. Die Bearbeitung und Rückführung in ein - unserer Meinung nach - geregeltes Leben gelingt oft nur bedingt, selten zur Gänze.
Tatsächlich wäre eine Forschung, die erhebt, warum Persönlichkeiten, trotz einer negativen Ausgangssituation und anderer Life-Events, nicht zu unseren KlientInnen werden, sinnvoll. Das bedeutet, daß STARK eine Erforschung des positiven Aspekts der Bewältigung von Lebenskrisen für weitaus aussagekräftiger erachtet. Der Focus auf die Kompetenzen eröffnet unserem täglichen professionellen Handeln mehr Möglichkeiten, als das Wissen über die Fakten "Warum es nicht geht". Folgende Forschungsbereiche geben ansatzweise Aufschluß, warum positive Veränderungen im Leben eines Menschen stattfinden bzw. warum es zu Empowermentprozessen kommen kann:
a. In der Life-Event-Forschung finden wir Hinweise auf den Beginn von Empowermentprozessen.
"Wichtig ist hierbei offensichtlich, daß solche auslösenden Ereignisse als eine qualitative Veränderung in der Lebenswelt einer Person zu sehen sind, die relativ abrupt, d.h. räumlich-zeitlich lokalisierbar geschieht und subjektiv bedeutsam von starker emotionaler Beteiligung geprägt ist." 12
b. Die Forschung zu Copingstrategien von A. LAZARUS und S. FOLKMAN (1984) 13 besagen, daß Bewältigung nur ein Überbegriff für innere und äußere Anforderungen an eine Person sind und sie sich nach dem Anlaß und dem Ziel unterscheidet. Damit allerdings Varianten von Problemlösungsverhalten oder Beschaffung von Informationen entstehen können, muß die Bewältigung der Situation problembezogen sein. Die Akzeptanz der Situation stellt das Ergebnis eines emotionsbezogenen Copings dar.
Als Ressourcen werden von der Copingforschung genannt:
"- Soziale Ressourcen: soziale Beziehungen, Netzwerke und Stützsysteme
- psychologische Ressourcen: Selbstwertgefühl, Kontrollbewußtsein, geringe Selbstabwertungstendenz
- Bewältigungsverhalten: Situationen verändern (objektiv), die Bedeutung des Problems verändern (kognitiv), Kontrolle der emotionalen Belastung (emotional)" 14
Der Bewältigungsprozeß besteht aus vier Phasen (Abwehr, Meisterung, Adaption und Anpassung) und dient der (Wieder)Herstellung einer Lebenssituation, in der man sein "Gleichgewicht" wiedererlangt. Sie geht aber nicht über diesen Aspekt hinaus und gibt daher nur Aufschlüsse über mögliche Persönlichkeitsstrukturen und Prozesse, die Grundlage für Empowermentprozesse sein können.
c. Die Daseinsforschung nach H. THOMAE 15 definiert Daseinstechniken als Kompetenzen, die nicht ausschließlich in Streßsituationen zum Einsatz kommen, sondern auch im Alltag ihre Relevanz haben. Sie gehen also über die Bewältigungstechniken hinaus.
d. Die Streßforschung nach A. ANTONOVSKY 16 bringt ein Konzept der Theorie der Gesundheit, die Salutogenese, was mich zurück zum sozialpsychiatrischen Konzept führt. ANTONOVSKY meint, "das Gesundheitsniveau des Menschen sei ein dynamisches Zusammenspiel zwischen belastenden (z.B. physische oder psychosoziale Stressoren) und schützenden Faktoren" (Copingressourcen). Als besonders wichtig sieht ANTONOVSKY den Kohärenzsinn, der dafür sorgt, daß Personen ihre eigenen Handlungs- und Bewältigungsfähigkeiten positiv und aktiv wahrnehmen.
Die obgenannten Forschungsergebnisse zum Verhalten und der Entwicklung von Menschen in schwierigen und/oder bedrohlichen Lebenssituationen stellen für das Empowermentkonzept Grundlagen dar.
"Für eine Perspektive des Empowerment wären hier Grenzüberschreitungen über die individuelle Ebene hinaus wichtig, die erklären helfen, unter welchen Bedingungen Formen gemeinschaftlicher Selbstorganisation und kollektiver sozialer Aktion entstehen." 17
Empowerment beeinflußt die Persönlichkeit im kognitiven, verhaltens- und handlungsorientierten Bereich und bezieht sich eindeutig auf die gesamte Person in ihrer Lebenswelt bzw. in ihrer sich verändernden Lebenswelt. Es verlangt uns allerdings ab, daß wir Coping als Lebensbewältigung, die einen aktiven, kreativen und formenden Prozeß darstellt, begreifen, welcher zwingend über die Bewältigung von Lebenskrisen hinausgeht. "Die bisherige Focussierung auf die behavioralen und kognitiven Aspekte reicht für ein Verständnis von Bewältigungsprozessen im Sinne von Empowerment nicht mehr aus." 18 Im Konzept des Empowerment sind Menschen dazu aufgerufen, sich selbst zu fördern und zu stärken. SozialarbeiterInnen übernehmen die Rolle der UnterstützerInnen, die die Basis und den Rahmen für die notwendigen Prozesse schaffen. Wie weit sich einE KlientIn im Rahmen einer Krise weiterbewegt und neue Handlungskonzepte erwirbt bzw. sich einfach mehr zutraut, bleibt der Persönlichkeit der/des KlientIn überlassen und kann von der/dem SozialarbeiterIn nicht bestimmt, aber gefördert werden.
2.2.2. Empowerment als Methode der Gemeinwesenarbeit
Bei STARK zeigt sich Empowerment als anzustrebendes Ziel zur Durchführung von gemeinwesenorientierter Sozialarbeit. N. HERRIGER bezeichnet Empowerment als "offenen Begriff, der individuell mit Inhalt zu füllen ist". 19 In seinen Überlegungen zum Empowerment ist für HERRIGER der Ausgangspunkt jener:
"Der Einzelne empfindet sich als Objekt, das von Umweltgegebenheiten abhängig ist, nicht aber als Subjekt, das die Lebenswelt aktiv zu gestalten vermag."
Besonders Selbsthilfegruppen, BürgerInneninitiativen, Stadtteilgruppen, etc. können ihre Mitglieder durch die geleistete und zu leistende Arbeit "empowern", indem sie die Möglichkeit geben zu erfahren, daß wir der Umwelt nicht ohnmächtig ausgeliefert sind, sondern daß wir sie aktiv umgestalten können. In der Gruppe werden neue Verhaltenstrategien erlernt, kann eine neue gestaltende Haltung zur Umwelt eingenommen werden. Die Motivation, die zunächst überwiegend extern bestimmt ist, wird durch die gemeinsame Dynamik zur Selbstmotivation. Die im Empowermentprozeß eingebundenen Mitglieder stärken sich selbst in ihrer Arbeit, wenn sie Erfolge oder Teilerfolge erzielen. Besonders politisch ausgerichtete Gruppen, welche von GemeinwesenarbeiterInnen unterstützt werden, sind ein gutes Lern- und Erfahrungsfeld für Empowerment. Auch etablierte Großorganisationen stellen einen Nährboden für persönliches und gruppenbezogenes Empowerment dar, weil "Übungen" zur Stärkung des Selbstbewußtseins, wie z.B. Gruppenerfahrungen, Verhandlungsführung in Gremien, in "Plattform"-Zusammenkünften, mit Politikern, u.s.w., und zum Abbau von Ängsten, durch den alltäglichen, und somit zur Normalität werdenden, Umgang mit Entscheidungsorganen und PolitikerInnen systemimmanent sind, das heißt FuktionärIn in einer politischen Partei, einer Gewerkschaft, etc. zu sein bedingt ein Zusammentreffen mit EntscheidungsträgerInnen, die in der Öffentlichkeit stehen und die aufgrund dessen einen Kompetenz- und Machtvorsprung in einer Verhandlung oder Sitzung genießen. Die Politik birgt ohne Zweifel immer wieder Reibungsflächen, bietet aber auch die Möglichkeit sich neue Verhaltens- und Handlungskompetenzen anzueignen.
Jede BürgerInneninitiative, jedes Jugendzentrum, jeder PensionistInnenclub hat seine Interessen, die verwirklicht werden wollen. Dies erfordert Duchsetzungsvermögen. Die gewerkschaftliche These "Gemeinsam sind wir stärker" stimmt ohne Zweifel. Die Antithese "Jede Gruppe ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied" läßt sich auch kaum bestreiten. Die Synthese daraus heißt Empowerment. Durch den Zusammenschluß in einer Gruppe, werden starke Persönlichkeiten mit vielen verschiedenen Kompetenzen zu AnführerInnen. Unter der Annahme, daß die schwächeren Gruppenmitglieder den AnführerInnen nicht blindlings folgen bzw. sich zurückziehen, weil die Arbeit ohnehin von den anderen gemacht wird, ergibt sich ein Lernverhalten bei den Schwächeren. Wenn nun SozialarbeiterInnen zu Beginn einer Initiative als "Starke" auftreten und die BewohnerInnen eines Stadtteils als "Schwache", dann muß von den GemeinwesenarbeiterInnen darauf geachtet werden, daß sie rechtzeitig Kompetenzen und Aufgaben an die Gruppe der BewohnerInnen abgeben und somit aus der Autoritätsrolle aussteigen. SozialarbeiterInnen werden nach und nach zu aufgesuchten Beratungsinstanzen, die mit der alltäglichen Arbeit der Gruppe nicht mehr befaßt sind. Den BewohnerInnen wird die Basis für einen Empowermentprozeß geboten, ihr Empowerment wird aber nicht von den SozialarbeiterInnen gemacht.
Empowerment und Abnabelung von Vorbildern und "direkten" Autoritäten gehen Hand in Hand. Verläuft der Empowermentprozeß von externer Attribution (das heißt auch Unterwerfung unter Autoritäten) zu interner Attribution (Infragestellung von Autoritäten und Übernahme von Eigenverantwortung), so bedeutet das für die GemeinwesenarbeiterInnen, die in einer Gruppe arbeiten, daß sie sich ab einem gewissen Punkt des Empowermentprozesses in Frage stellen lassen müssen. Die gängige Formulierung, daß sich eine Eigendynamik 23 entwickle, sollte nicht mehr negativ aufgefaßt werden, sondern als Auftreten einer neuen Qualität, welche langfristig zur Stabilisierung von Selbstregulierungsmaßnahmen führen kann. Dies bedeutet auch, daß wir Unsicherheiten und Desorientierung phasenweise in Kauf nehmen müssen. Empowerment erweist sich hier einerseits als eine Entwicklung, die durchaus auch chaotische und vielleicht destruktive Elemente aufweisen kann, andererseits aber auch die SozialarbeiterInnen verunsichern kann, zumal sie in ihrer "FührerInnen/LeiterInnenrolle" relativiert werden. Die Kunst für die SozialarbeiterInnen besteht darin, daß sie sich im richtigen Moment zurücknehmen können und ihre Leitungskompetenzen an die Gruppe abgeben müssen, selbst dann, wenn ihr Vertrauen in die Selbstregulierungsfähigkeit der Gruppe (noch) gering ist. Es gilt, das vielfach gesicherte Wissen aus der Sozialpsychologie umzusetzen und sich darauf zu verlassen, daß demokratisch geleitete Gruppen effizienter arbeiten als autoritäre bzw. im Laissez-fair-Stil geleitete. Hier sind die Untersuchungen von K. LEWIN von 1937-1940 in Kleingruppen anzuführen. Demokratisch geführte Gruppen zeigten mehr spontanes Verhalten und eigene Initiative, die Verhaltensweisen waren vielfältiger, produktiver und konstruktiver. Die Atmosphäre war ausgeglichener und zufriedener, das Verhältnis zum Leiter war positiver und freier, mehr partnerschaftlich als hierarchisch. Die Gruppe zeigte einen stärkeren Kohärenzsinn, es überwogen die freundlichen und hilfsbereiten Kontakte. Das Aggressionspotential war geringer als in anderen Führungsstilen. 24 Für die GemeinwesenarbeiterInnen, die die Empowermentphilosophie ernstnehmen wollen, stellt dies eine große Herausforderung dar, insofern, als sie ihr herkömmliches Rollenbild der kompetenten und abgegrenzten HelferInnen (advokatorisches Modell) flexibilisieren müssen.
2.2.3. Die Stellung von Empowermentprozessen in der sozialtherapeutischen Praxis
Die Überzeugung von der eigenen Unfähigkeit ist in manchen Sozialeinrichtungen stark spürbar. Viele Institutionen machen wenig Öffentlichkeitsarbeit und wenn, dann nahezu nur in Richtung Klientel.
" In jedem Konzept sozialer Organisationen findet sich auch der Begriff Öffentlichkeitsarbeit. Nicht selten ist dieser Punkt ganz zuletzt angeführt. Dies Platzierung sagt mehr als tausend Worte: Was nach einem harten Arbeitstag an Energien noch übrig geblieben ist, kommt dann vielleicht dieser letztgereihten Aufgabe zugute." 25
SozialarbeiterInnen finden viele Gründe, der Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit aus dem Weg zu gehen. Die Argumentation in Richtung "Nicht-Zuständigkeit" verdeckt das fehlende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Empowermentprozesse in der Sozialarbeit setzen Empowermentprozesse im Individuum SozialarbeiterIn voraus. Das Selbstbild der SozialarbeiterInnen geht zumeist in die Richtung, daß sie die Kompetenzen, die sie sich im Laufe ihrer Ausbildung angeeignet haben, den KlientInnen zugute kommen lassen. Auf der einen Seite stehen die Kompetenzen der SozialarbeiterInnen auf der anderen Seite die Defizite der KlientInnen. Die Empowermentperspektive sowie die Erkenntnisse von ROGERS zeigen, daß der geforderte Paradigmenwechsel in Denken und Verhalten sowohl in den SozialarbeiterInnen als auch in den KlientInnen stattfinden muß. SozialarbeiterInnen und KlientInnen stehen in einem systemischen Zusammenhang. Die Dogmen der Abgrenzung, der einseitigen Verteilung von Kompetenzen und Defiziten entsprechen dieser systemischen, empowermentmäßigen Situationswahrnehmung nicht. Das heißt auch, daß die SozialarbeiterInnen selbst an der Entwicklung ihrer eigenen Kompetenzen interessiert sein müssen, und dies nicht nur in Form von "Fortbildungen", sondern als permanenten Prozeß. Genau genommen ist Empowerment kein einmal errungenes Ziel, sondern das Ringen um Klarheit (vgl. Pkt. 2.2.3. - S.17 "Sobriety"), das nie abgeschlossen ist.
"Konkrete Ziele vor Augen zu haben ist kein Widerspruch zu Empowerment eher sogar im Gegenteil: Wenn einem die Ziele die man erreichen will und auch erreichen kann immer klarer vor Augen stehen, dann ist es geradezu ein Indiz für einen effizienten Empowermentprozeß. Wachsende Identität, wachsende Klarheit und wachsende Motivation sind ein Anzeichen dafür, daß wirklich ein Prozeß stattfindet." 26
In der täglichen Praxis der sozialtherapeutischen Einrichtungen, wie z.B. des Vinzenzhauses der Caritas, Wien (Übergangswohnheim für obdachlose Männer), werden besonders die materiell-sozialen Defizite bearbeitet und nur zu einem geringen Teil, wenn es das Konzept und der Personalstand der Institution erlaubt, die psychischen, wie z.B. die Alkoholsucht. Die Defizite der KlientInnen stehen im Mittelpunkt und der Mittelpunkt der klientInnenzentrierten Arbeit liegt in der Bearbeitung der äußerlichen Situation der KlientInnen. Ziel ist die "vollständige Reintegration in die Gesellschaft" mittels Abbau der bestehenden sozialen Defizite, d.h. Entzug, Finden einer Arbeitsstelle, Tilgung der Schulden, Bezug einer eigenen Wohnung und Ausscheiden aus dem Betreuungsmodus. Augenmerk sind und bleiben die Defizite der KlientInnen. In der Empowermentperspektive muß gleichzeitig danach Ausschau gehalten werden, inwiefern die gesellschaftlichen Bedingungen verändert werden können, d.h. nicht nur Anpassung an die Gesellschaft sondern auch Adaption der Gesellschaft bzw. der psychosozialen Umwelt (z.B. Arbeitsplatz, Familie, Schule, Wohnheim ...). STARK plädiert für eine Abkehr von der defizitorientierten Sozialarbeit hin zu einer kompetenzorientierten Sichtweise. Er geht davon aus, daß KlientInnen einer "fürsorglichen Belagerung" ausgesetzt sind, die ihre "Power" und Kompetenzen tendenziell ignoriert und sie von den Handlungen der SozialarbeiterInnen und deren Denkweise abhängig macht.
"Abhängige Personen, eben weil sie abhängig sind und sich oft nicht selbst helfen können, müssen mehr als andere Menschen vor den unbeabsichtigten Folgen unserer Güte und den unvorhersehbaren Folgen unserer guten sozialen Absichten geschützt werden." 27
"Gut sein" und "Gutes tun" scheint ein zentrales Bedürfnis von professionellen HelferInnen zu sein. Die Erhaltung des Systems, welches Hilfsbedürftige produziert und die nahezu ausschließliche Bearbeitung der Symptome, die KlientInnen zeigen, stellt somit ein Interesse der Sozialarbeit dar. Kaum eine Methode der Sozialarbeit lenkt den Blickwinkel weg von den Defiziten hin zu den Ressourcen der Klientel. Wie bei der eigenen Person, ist es auch bei den KlientInnen einfacher, jene Dinge zu erkennen und zu benennen, die diese Menschen nicht können. Das Gekonnte zu sehen dauert länger und erfordert mehr Nähe zu denKlientInnen. Vor dieser Anforderung schrecken wohl die meisten SozialarbeiterInnen zurück.
Im Kontext des Abhängigkeitsproblems, zu dem auch die Bewertung der "Abgrenzung" zählt, können wir aus der von A. WILSON SCHAEF vorgelegten Analyse der Co-Abhängigkeit Wesentliches lernen. Das Gefälle von SozialarbeiterIn zu KlientIn verdeckt das in der Sozialarbeit verbreitete Phänomen der Co-Abhängigkeit. Überspitzt ausgedrückt bedürfen die Hilfespendenden der Hilfsbedürftigen, die sozialen Einrichtungen bedürfen der KlientInnen und tragen dazu bei, daß KlientInnen in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, d.h. auch daß soziale Institutionen gewissermaßen empowermentfeindlich sein müssen, weil sie von ihren KlientInnen abhängig sind. Dies kann bis zur psychischen Abhängigkeit von den KlientInnen führen, wie W. SCHMIDBAUER in seinem mittlerweile 20 Jahre alten Klassiker "Die hilflosen Helfer" analysiert hat. Mit Co-Abhängigkeit bezeichnet SCHAEF jene Suchttendenzen in BetreuerInnen/SozialarbeiterInnen/LehrerInnen, die durch die Suchterkrankung der KlientInnen hervorgerufen wird. Die BetreuerInnen selbst lassen sich in den Suchtprozeß hineinziehen, verlieren ihre innere Klarheit ("Sobriety") und weisen verschiedene Merkmale der Suchtkrankheit auf: Verleugnung, gestörtes Gefühlsleben, übertriebene Kontrolle, Perfektionismus, Angst, moralisierendes Verhalten, u.s.w. 28 Was SCHAEF über PsychotherapeutInnen sagt, läßt sich auch auf SozialarbeiterInnen anwenden:
"Ich bin erschüttert, wie wenig Psychotherapeuten über Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit Bescheid wissen, wo doch Charles Whitfield überzeugt ist, daß alle Menschen unserer Kultur - sofern sie nicht behandelt oder besonders geschult sind -, von dem Suchtsystem geschädigt sind, gleich, ob sie nun eine nähere Beziehung zu einem Alkoholiker haben oder nicht. (...) Diese Erkenntnis läßt ihn folgern, daß wir unser Augenmerk auf jene Therapeuten richten müssen, die er "ungeschult" und "unbehandelt" nennt. Das sind diejenigen, die sich dieser Krankheit gar nicht bewußt sind und sie deshalb bei sich selber nicht erkennen können." 29
In diesem Zusammenhang wird einsichtig, daß "Abgrenzung" alleine den Prozeß der Co-Abhängigkeit nicht ausschalten kann, sondern daß Sobriety gefordert ist. Dies bedeutet, daß die Beziehung zu den KlientInnen nicht durch Abgrenzung gesteuert werden soll, sondern von der Klarheit für KlientInnen und SozialarbeiterInen über das, "was in dieser Beziehung vor sich geht".
Hier läßt sich der Zusammenhang mit der erwähnten "philosophischen Orientierung des Beraters" herstellen. Wenn die angewandte Methode nicht im Einklang mit der zugrundeliegenden Einstellung steht, bleibt die Methode nur Hülse und setzt keine Prozesse in Gang. Eine prozeßorientierte Methode jedoch ist nur so gut, als sie tatsächlich Prozesse ins Leben ruft. In diesem Kontext ist auch das Problem der Abgrenzung zu sehen. Als SozialarbeiterInnen, die Empowermentprozesse in Gang setzen wollen, müssen wir genau unterscheiden zwischen einer Abgrenzung, die aus der eigenen Angst entspringt und einer Abgrenzung, die dem betreuten Menschen hilft, seine eigenen Kompetenzen zu entdecken und zu entfalten. Eine Abgrenzung ohne "wenn und aber" ist nicht im Sinne des Empowerments. Hier kommen alte sozialarbeiterische Dogmen ins Wanken, insbesondere dann, wenn die KlientInnen zu PartnerInnen der SozialarbeiterInnen werden, wie es im Empowerment möglich sein muß.
Besonders sozialtherapeutische Einrichtungen sollten kompetenzorientiert arbeiten. Als höherschwellige Institutionen verfügen sie oft über die materiellen Ressourcen, wie z.B. Geldmittel, Materialien für Zeichnen, Malen, Schneidern, Werkstatt, etc., freie Räume für Aktivitäten, Verbindung zu Spendern, etc., die Empowermentprozesse erfordern. Empowermentarbeit mutet jedoch vielen Professionellen, PolitikerInnen, Gesellschaftsgruppen und nicht zuletzt auch vielen KlientInnen, als Luxus und etwas Unnötiges an, weil es Geld kostet die Rahmenbedingungen für Empowermentprozesse zu schaffen und eine Erfolgskontrolle unmöglich ist. (vgl. Pkt. 6.1.4. Die Finanzierung)
2.2.4. Kritik an Stark
a. STARK bestimmt Empowerment nahezu ausschließlich formal. Die praktischen Beispiele, die er anführt, reichen nicht aus für eine überprüfbare Methodologie und Kriteriologie. Obwohl einzusehen ist, daß es STARK um die Bestimmung einer Perspektive geht, die für die GemeinwesenarbeiterInnen leitend sein soll, wäre es dennoch wünschenswert, daß neben diesem Schwerpunkt Hinweise auf konkrete Handlungsansätze angeführt würden.
b. STARK bestimmt Empowerment als Prozeß, in dem der Schwerpunkt auf dem Gemeinwesen, dem Kollektiv, liegt. Das Individuum könne seine Individualität nur in der Gemeinschaft verwirklichen. So sehr dieser Ansatz theoretisch seine Richtigkeit hat, fehlt in STARKs Konzept eine Theorie des Individuums, insbesondere das Menschenbild bleibt im Unklaren. Dies hat auch zur Folge, daß die Umsetzung der Theorien von STARK in die Einzelfallhilfe vage bleibt (Das heißt sie kommt in seinem Buch nicht vor. Wir können höchstens Rückschlüsse aus seinen Theorien für die Gemeinwesenarbeit ziehen...).
c. STARK betont an verschiedenen Stellen, daß die Wiedererlangung der Kontrolle über das eigene Leben Zielsetzung zu sein habe. Er bezieht sich hier z.B. auf Y. HASENFELD. Mit A. WILSON SCHAEF will ich STARK eine Kritik am Kontrollideal entgegenbringen. Für SCHAEF ist die übermäßige Kontrolle ein Suchtmerkmal. 30 Sie bezeichnet die Kontrolle als eine auf vielen komplizierten Wegen konstruierte Illusion (über Erzeugung von Krisen, Depression, Streß, Lügen, Verwirrung, u.s.w.). Insbesondere in unserer Kultur ist die Kontrolle der Gefühle und des Verhaltens ein mitunter krankhaft überzogenes Ideal, das zur neurotischen Anpassung an krank machende gesellschaftliche Bedingungen führt. Dies kann nicht das Ziel von Empowerment sein. Die Hinterfragung der Kontrollmechanismen innerhalb des Zivilisations- und Sozialisationsprozesses wäre hier eine entsprechende Zielsetzung. Eine Orientierung am Ideal der Anpassung und der Kontrolle verstellt den Blick auf die Möglichkeiten, die Umwelt mitzuverändern. Ich schlage daher vor, den Begriff der Kontrolle und der Anpassung, welche beide ambivalent und teilweise obsolet geworden sind, durch den positiven Begriff der Selbstgestaltungsfähigkeit zu ersetzen.
3. THEATER IN DER SOZIALEN UND THERAPEUTISCHEN PRAXIS
"Das Unsichtbare in unserem Spiel, vermagst du es zu sehen? Das Geschehene in unserem Werk, vermagst du es zu erkennen? Den Weg, den wir gegangen, vermagst Du ihn zu gehen? Wie wir uns getragen und ertragen? Was erträgst du davon?
O Menschlein, gib acht ...
Im Lachen verbirgt sich unser Ernst. Im Spiel, im Tanz verbirgt sich, was wir sind und was wir wären ... Wir haben Masken abgelegt und uns geöffnet ... Wir haben Masken aufgesetzt und uns getragen ... Wirst du es merken in unserem Spiel?" 31
Keine Theorie der Sozialarbeit kommt ohne transzendentes Konzept vom Menschen aus, genausowenig, wie jede psychotherapeutische Schule. Dies bedeutet, daß sich menschliches Leben nicht in praktischen Bezügen (Arbeit, Familie) erschöpft, sondern über sich selbst hinausweist. Menschliches Dasein ist ausgerichtet auf die Verwirklichung von Sinndimensionen (Frankl) 32 es will seine eigene Aufgabe erkennen und verwirklichen. In diesem Kontext ist Sozialarbeit und Therapie eine Orientierungs- und Verwirklichungshilfe, das heißt auch, daß sich "Transzendenz- kriterien", wie etwa die Frage nach dem Sinn einer Krisensituation, aus der Sozialarbeit nicht ausblenden lassen.
Ob Theaterspiel oder Spiel überhaupt in der Sozialarbeit einen therapeutischen oder pädagogischen Nutzen hat, hängt davon ab inwiefern wir transzendente Bezüge im sozialarbeiterischen Handlungsfeld zulassen. In den verschiedenen Arten des Spiels verwirklicht der Mensch seine persönliche und existenzielle Freiheit. HUIZINGA stellt in seinem Hauptwerk "Homo Ludens" das Spielen als eine "unbedingt primäre Lebenskategorie" heraus. Als Spielender (homo ludens) erlebt sich der Mensch in seinen transzendenten Möglichkeiten, das heißt er geht nicht mehr in den alltäglichen Notwendigkeiten des Lebens auf, sondern löst sich aus der Zweckbestimmtheit und "spielt sich frei".
"Mit dem Spiel aber erkennt man, ob man will oder nicht, den Geist. (...) Schon in der Tierwelt durchbricht es die Schranken des physisch Existenten. Von einer determinierten Welt reiner Kraftwirkungen her betrachtet, ist es im vollsten Sinne des Wortes ein 'Superabundanz', etwas Überflüssiges. Erst durch das Einströmen des Geistes, der die absolute Determiniertheit aufhebt, wird das Vorhandensein des Spiels möglich, denkbar und begreiflich. Das Dasein des Spiels bestätigt immer wieder, und zwar im höchsten Sinne, den überlogischen Charakter unserer Situation im Kosmos. Die Tiere können spielen, also sind sie bereits mehr als mechanische Dinge. Wir spielen und wissen, daß wir spielen, also sind wir mehr als bloß vernünftige Wesen, denn das Spiel ist unvernünftig." 33
Auf der psychologischen Ebene wissen wir, daß jede Art von Spiel für die Entwicklung der Persönlichkeit von ausschlaggebender Bedeutung ist. Dies gilt für Kinder, wie auch für Erwachsene. Es ist daher verständlich, daß sich auch die Psychotherapie der Möglichkeiten des Spielens auf verschiedensten Ebenen angenommen hat (Kunst-, Gestalt-, Musiktherapie, ...). Berühmt geworden ist die Bewegung des Psychodramas, das heute als Überbegriff für verschiedene Arten des therapeutischen Spiels zu gelten hat. Auf der Ebene des Miteinander- Spielens und des Sich-Selbst-Spielens werden Rollenfixierungen aufgelöst und neue Lebenskonzepte erarbeitet. In diesem Kontext ist die Beziehung zum Empowerment, in dem die Hinwendung von der externen zur internen Attribution beabsichtigt ist, bereits erkennbar. Empowerment heißt in dieser Hinsicht alte Rollen zu hinterfragen und neue Rollen auszuprobieren - dies gilt sowohl für die KlientInnen als auch für die SozialarbeiterInnen. Der Empowermentprozeß wird zum Spielprozeß.
Für die Anwendung des Theaterspiels in der Sozialarbeit/Gemeinwesenarbeit gibt es weltweit ausreichend Belege, z.B. die politische Arbeit von A. BOAL. Auch in Wien gibt es eine Vielzahl von erfolgreichen Beispielen des Einsatzes von Theater als Methode in den verschiedensten Bereichen der Sozialarbeit, wie z.B. das moderne Krippenspiel im Regenbogenhaus 1990, das offene Kliniktheater in Salzburg 1975, das Kontaktiertheater des Buddy Vereins 1992, das animatorische Theater von Jugend am Werk Sobieskigasse (Langzeitprojekt), das Theater in der Justizanstalt Mittersteig, etc. 34
Für die folgende Betrachtung werde ich auf das Psychodrama und die Methode von A. BOAL eingehen.
Das Psychodrama stellt das erfolgreichste Beispiel in der Entwicklung des therapeutischen Theaters im 20. Jahrhundert dar. Als solches ist es in andere Therapieformen, wie z.B. die Familien- und Gestalttherapie, eingegangen. Alle theaterpädagogischen bzw. - therapeutischen, und auch sozialtherapeutischen, Bemühungen werden sich am Konzept des Psychodramas messen lassen müssen.
BOALs "Theater der Unterdrückten" stelle ich ergänzend an die Seite des Psychodramas, nicht nur weil diese Methode in den letzten 20 Jahren auch in Europa große Resonanz findet, sondern weil sie therapeutische und sozialpolitische Anliegen in sich vereinigt.
3.1. Psychodrama
Das Psychodrama stellt eine sinnvolle und zielführende Art der Psychotherapie dar. Wie in allen anderen psychotherapeutischen Formen gibt es auch im Psychodrama verschiedene Schulen, die sich aus MORENOs Psychodramatechnik, oder parallel zu ihr, entwickelt haben:
1. Therapeutisches Theater
2. Expression-Scénique
3. Behaviordrama
4. Analytisches Psychodrama
5. Jungianisches Psychodrama
6. Adlerianisches Psychodrama
7. Experimentelles Psychodrama
8. Triadisches und tetradisches Psychodrama
9. Gestaltdrama
J. L. MORENO (1889-1974), der Begründer des klassischen Psychodramas 35 , lebte bis 1925 in Österreich, bevor er in die Vereinigten Staaten auswanderte und in Beacon ein psychiatrisches Privatsanatorium mit einem angeschlossenen therapeutischen Theater gründete. Wesentliche Elemente seiner Methode entwickelte MORENO bereits in seiner Wiener Zeit, bzw. in seiner Zeit als Gemeindearzt von Vöslau (z.B. die Soziometrie). Nicht unwesentlich ist die Tatsache, daß MORENO Therapie immer auch als künstlerischen und kreativen Akt verstanden hat. Psychodrama ist für MORENO eine Methode, in der Rollenfixierungen aus der Vergangenheit, wie sie z.B. im Familiensystem entstanden sind, thematisiert und kathartisch durchgearbeitet werden können. Die/der ProtagonistIn im Psychodrama bestimmen Rolle, Situation und MitspielerInnen ihres/seines eigenen Psychodramas. Die Intensität des Erlebens in dieser "Surplus-Reality" kann so ausgeprägt sein, daß es zu einem inneren Aufbruch kommen kann. "Jedes wahre zweite Mal ist die Befreiung vom ersten." 36 Eine traumatisierende oder einfach "offene" Situation aus der eigenen Lebensgeschichte wird in der vertrauensvollen Umgebung der Gruppe wiedererlebt. Die/der ProtagonistIn kann z.B. seine Ängste und gehemmten Wünsche zwanglos darstellen, da sie/er sich in einer Atmosphäre befindet, die das reale Leben zwar nachempfindet, aber nicht dessen physische und psychische Gefahren und Konsequenzen enthält. Grundsätzliche Intension des psychodramatischen Prozesses ist dabei die Aufhebung der Trennung von Innen- und Außenwelt, der inneren Geschichten und Phantasien und der Realität: "It can be said, psychodrama is an attempt to breache the dualism between fantasy and reality and to restore the orginal unity" . 37 Die Stärkung des Realitätsprinzips des Ichs, dies wäre der psychoanalytische Kontext, bzw. das Hervortreten des Erwachsenen-Ichs, im transaktionsanalytischen Kontext, ist somit auch ein Anliegen des Psychodramas. Gleichsam gilt es abgespaltene Gefühle zu integrieren und Traumata aufzuarbeiten.
Gilt es in der Transaktionsanalyse, das "Lebensskript" (BERNE) eines Menschen zu hinterfragen und neu zu definieren (Wer hat mein Lebensskript geschrieben? Ich selbst oder die Umwelt?), so gilt für das Psychodrama, daß die Rollenprägungen aufgelöst werden sollen. Rollen entwickeln sich durch zwischenmenschliche Erfahrungen, sie sind Werkzeuge, Vermittler und Mittel, mit denen das Individuum im sozialen Raum agiert. "Rolle meint ein Insgesamt von Erwartungen und Zuschreibungen, die an eine bestimmte Funktion in einer bestimmten Situation geknüpft, kulturell geformt und festgelegt und persönlich und interpretiert sind." 38 Im familientherapeutischen Kontext wissen wir, daß sich die Rollen aus den Erwartungshaltungen, mit denen das Individuum konfrontiert ist, herausbilden. Rollen helfen das sensible Gleichgewicht in einer Familien- bzw. Gruppensituation aufrecht zu erhalten. Bestimmte Rollenmuster werden jedoch auch beibehalten, wenn die ursprüngliche Situation nicht mehr besteht. Z.B. können Kinder, die in einer Alkoholikerfamilie aufwachsen, besonders gute BeobachterInnen und OrganisatorInnen sein, weil sie diese Rolle schon von Kindheit auf eingeübt haben, es können aber auch problematische Rollenbilder bestehen bleiben. Hat das Kind gelernt spannungsreiche Situationen in der Familie durch aggressives, auffälliges Verhalten zu lösen, kann dieses Muster im späteren Leben zu massiven Problemen führen. 39 Allgemein können wir sagen, daß viele Menschen in ihrem Sozialverhalten Probleme haben, weil sie eine falsche Rolle im falschen Stück spielen.
Das klassische Psychodrama nach MORENO umfaßt drei Phasen: die Einstiegs- und Anwärmphase, die Handlungs- oder Spielphase und die Abschlußphase. Im Warming-Up stimmen sich die Mitglieder der Gruppe auf die Situation und die eigene Befindlichkeit ein. Szenen aus der persönlichen Lebensgeschichte werden in Erinnerung gerufen, ein Thema oder einE HauptdarstellerIn kristallisiert sich heraus. Zur Einstiegsphase zählt auch das Einrichten der Szene. Die/der HauptdarstellerIn wählt die MitspielerInnen für ihre/seine "Geschichte" aus. In der Handlungsphase werden die persönlichen Erlebnisse durchgespielt und wiederholt. Wie schon erwähnt kann es in dieser Phase zu einem gesteigerten (Wieder)Erleben von verdrängten oder abgespaltenen Gefühlen kommen, eine erlösende Katharsis ist beabsichtigt. In der Abschlußphase, der ein allgemeines Feedback vorangeht, wird das Erlebte reflektiert. In diesem Prozeß kann es ProtagonistInnen gelingen, zu ihren intensiven Erfahrungen Distanz zu gewinnen. Sie können durch die Unterstützung der Gruppe und von TherapeutInnen eine Außenperspektive einnehmen, die es ihnen ermöglicht ihren Gefühlen eine neue Bedeutung zu geben. Dieser Prozeß wird "Sharing" genannt. Am Ende der Besprechungsphase steht das "Processing". Hier wird gefragt: Warum wurde gerade diese Episode gespielt? Warum spielte wer welche Rolle? Was hat dieses Thema mit der Situation der Gruppe zu tun?
Die klassischen psychodramatischen Instrumente nach MORENO sind:
- die Bühne
- die/der ProtagonistIn, der seine Problematik darstellt
- die/der SpielleiterIn, die/der für die Leitung der in der Gruppe stattfindenden Prozesse verantwortlich ist, so etwa auch für das Warming-Up.
- die Hilfs-Ichs (AntagonistInnen), die sich als Übertragungsobjekte anbieten und beim Doppeln und Rollentausch die Rolle der/des ProtagonistIn übernehmen
- die Gruppe, sie ist der Resonanzkörper, der emotionale Hintergrund, vor dem die inneren Dramen aufgedeckt und dargestellt werden.
Die zentralen drei Psychodramatechniken sind das Doppeln, das Spiegeln und der Rollentausch. Beim Doppeln steht ein Hilfs-Ich hinter der/dem ProtagonistIn und versucht, die Gefühle, die innere Stimme auszudrücken. Beim Spiegeln stellt ein Hilfs-Ich die/den ProtagonistIn auf der Bühne dar, damit dieseR als ZuschauerIn sich selbst gegenübertreten kann. Beim Rollentausch gibt die/der ProtagonistIn ihre/seine Rolle ab, die von eineR MitspielerIn übernommen wird, die/der die Rolle mit ihrem/seinem eigenen Rollenverständnis darstellt. Die/der ProtagonistIn übernimmt dabei die Rolle der/des AntagonistIn. Der Unterschied zwischen Spiegeltechnik und Rollentausch besteht darin, daß beim Spiegeln das Gruppenmitglied die Aufgabe hat die Rolle der/des ProtagonistIn unverändert fortzuführen, während beim Rollentausch die/der MitspielerIn ihre/seine eigene Auffassung von der Rolle, quasi eine Alternative, vorführen kann. Außerdem ist es beim Rollentausch möglich, daß die/der HauptdarstellerIn in die Rolle ihres/seines "Gegners" schlüpfen kann. Es ist einleuchtend, daß diese Techniken ein Aufbrechen von verhärteten Positionen ermöglichen und eine Einsicht in vorher nicht wahrgenommene Zusammenhänge schafft.
Das Psychodrama hat sich weiterentwickelt. So wie das Psychodrama in andere Therapierichtungen integriert worden ist, wurden auch andere Therapieformen in das Psychodrama eingebaut. Gestaltarbeit, Musiktherapie, katathymes Bilderleben, Maskenarbeit, Malen, Bewegungs- und Familientherapie haben sich geradezu für eine Vereinigung mit dem Psychodrama angeboten, gleichfalls hat psychodramatisches Arbeiten auch Eingang in die Einzeltherapie gefunden. Das Rollenspiel ist überhaupt zu einem universellen Mittel in der Pädagogik geworden.
"Das Ziel der verschiedenen Methoden ist nicht, die Patienten in Schauspieler zu verwandeln, sondern sie dazu zu bringen, auf der Bühne das zu sein, was sie sind, nur tiefer und klarer, als sie im wirklichen Leben erscheinen." 40
Ich möchte in dieser Arbeit nicht auf alle Psychodramaschulen eingehen, sondern nur das "Therapeutische Theater" und das "Behaviordrama" anführen, weil ersteres für das Projekt PRO-95 wichtig ist, und weil STARK sich in seinem Werk auf Behaviortechniken bezieht. Empowerment stellt keine psychotherapeutische Schule dar.
3.1.1. Das Therapeutische Theater
Das therapeutische Theater wurde von V. N. ILJINE (1890-1974) parallel zu MORENOs Psychodrama entwickelt. Er maß dem Spiel, als anthropologische Grundlage des menschlichen Lebens, große Bedeutung zu.
"Das Spiel als eine Qualität der menschlichen Existenz, die aus der essentia humana hervorbricht, schafft einen zutiefst menschlichen Bereich, der heil, frei von Zwang und Deformation ist. Im Spiel ist es möglich, einem Menschen als Mensch zu begegnen, ohne fürchten zu müssen, ohne Bedrohung abzuwehren. Im Spiel kann man frei sein. Aus dem Zwang in das wahre Spiel einzutreten, bedeutet Befreiung, Freiheit, Überwindung, der Krankheit zur schöpferischen Selbstverwirklichung" 41
ILJINE, Biologe, Mediziner, Psychologe und Philosoph, war selbst während seiner Studienzeit schauspielerisch aktiv. Er stand unter dem Einfluß der Theaterexperimente von STANISLAWSKIJ und dessen SchülerInnen, von Spielformen aus dem russischen Alltagsleben und der aktiven Technik in der Psychoanalyse von S. FERENCZI, dessen Schüler er war.
Im therapeutischen Theater geht es darum einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen die "SpielerInnen" (ProtagonistInnen/AntagonistInnen) ihre Geschichten improvisieren können. Die Rahmenhandlung erstellt die/der TherapeutIn aufgrund der Anamnese und Konfliktkonstellationen. In der Arbeit mit Gruppen werden die Rahmenszenarien von der gesamten Gruppe erstellt und geschrieben, was das therapeutische Theater nach ILJINE grundsätzlich von den übrigen Psychodramatechniken unterscheidet. 42 Während der Improvisationen können die ProtagonistInnen alle möglichen Techniken des Psychodramas anwenden (z.B. Rollentausch, Doppeln, ...). Sobald ein neues Thema im Geschehen auftaucht, wird dieses in einem neuen Rahmenszenario verarbeitet. Diese Spielform des therapeutischen Theaters wird "Théatre permanent" genannt, weil das "Stück" demnach kaum zu einem "natürlichen" Ende kommt.
Das Théatre permanent folgt einer klaren Struktur:
1. Konstatationsschritt (Themenfindung)
2. Analyseschritt (Reflexion des Themas)
3. Transpositionsschritt (Erstellung des Rahmenstücks)
4. Realisationsschritt (Spiel des Rahmenstücks)
5. Reflexionsschritt (Durcharbeiten des Spiels)
Neben dieser Arbeitsform, die konfliktzentriert und erlebnisorientiert ist, wird im therapeutischen Theater mit Übungen aus der Wahrnehmungs-, Körper, Atem- und Stimmschulung der klassischen Schauspielausbildung gearbeitet. Hierdurch sollen "Defizite im Verhalten und Erleben der PatientInnen kompensiert werden." 43
Das therapeutische Theater zeichnet sich auch durch seine Vielfalt aus. Die Methode ist konfliktzentriert, biographisch-aufdeckend und verhaltensmodifizierend nebeneinander. Wobei die TherapeutInnen immer den Überblick über das Geschehen behalten und zu jeder Zeit in den Vorgang eingreifen können, um das Ziel - begründet durch die Anamnese - zu erreichen.
Die Methode ILJINES ist also ein Spiel, welches direkt aus den Lebensgeschichten und Persönlichkeiten der PatientInnen erwächst, wobei es nicht zur Bedingung wird die eigene Geschichte darzustellen. Allerdings bedingt der therapeutische Ansatz eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Gespielten in Form einer Reflexionsphase. "So verinnerlicht der Patient das Gespielte, lernt auch unbekannt geglaubte Situationen und Geschichten mit Bekanntem in Beziehung zu setzen und Handlungsansätze daraus zu ziehen". 44 Besonders der Reflexionsschritt unterscheidet die Phasen des therapeutischen Theaters von den Phasen PRO-95'. Reflektiert wurde nur in Form einer Feedback-Runde (1 Stunde) in Zwettl und schriftlich im Rahmen des Projektberichts. PRO-95 war kein Psychodrama. (vgl. Pkt. 6.1.6.)
3.1.2. Behaviordrama
Behaviordrama fußt im verhaltensmodifizierenden Rollenspiel, welches schon in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in den USA zum Einsatz kam. In die Psychodrama-Therapie fand diese Form erst in den siebziger Jahren breiten Einzug.
Erst H.G. PETZOLD kreierte ein umfassendes Konzept des Behaviordramas, welches verhaltenstherapeutische Ansätze im Psychodrama vereint und ausbaut. Angeleitet von TherapeutInnen, wird Verhalten geübt und somit erlernt. Mit Techniken wie Imitationslernen oder dem hierarchischen Aufbau von Situationsspielen, je nach Ziel, wird systematisch desensibilisiert oder es werden fortlaufend neue komplexe Verhaltensweisen erlernt (Assertive-Training, Spontaneity-Training,...). Erfolge werden zumeist sofort "belohnt" (z.B. mit Süßigkeiten, Obst oder durch verbales Lob durch die TherapeutInnen und die Gruppe,...), um den PatientInnen das Verinnerlichen des neuen Ansatzes bzw. der neuen Methode zu erleichtern.
Ein schönes Beispiel für eine behaviorale Übung ist folgende:
Die Gruppe befindet sich in der Rolle von Zugsinsassen. Der Zug ist bis auf den letzten Platz voll. Die/der ProtagonistIn hat einen Platz reserviert und bezahlt, auf dem sie/er nun eine andere Person vorfindet. Aufgabe ist es den so entstandenen Konflikt (Platzmangel, Reservierung) zu bearbeiten. Im Rollenspiel wenden ProtagonistIn und AntagonistInnen ihre alltäglichen Verhaltensweisen und Konfliktlösungsstrategien (Bitten, Fordern, Aggression, Abblocken, etc.) an. Die/der TherapeutIn beobachtet die Szene. Nach Beendigung und Lösung des Konflikts, wobei diese aus Flucht, Kampf, Delegation, Kompromiß oder Konsens bestehen kann, wird gemeinsam reflektiert und nach alternativen Verhaltensweisen (Behavior) gesucht. Diese werden in einer nochmaligen Aufnahme der Szene eingesetzt und geübt. Ziel ist es für die Handelnden neue Wege des Verhaltens in Konfliktsituationen aufzuzeigen und eine Internalisierung derselben einzuleiten. 45
Behaviordrama zielt auf die Formung des Menschen ab, wobei, trotz weitgehenden Zurücknehmens der Persönlichkeit der TherapeutInnen, Manipulation in eine von den TherapeutInnen bestimmte Richtung systemimmanent erscheint. Die Anwendung dieser Psychodramatechnik, die auf die gezielte Erarbeitung neuer Kompetenzen bei PatientInnen abzielt, erfordert strikte, sehr selbstkritische Reflexion seitens der TherapeutInnen.
STARK betont, daß Empowermentprozesse nichts mit behavioralen Methoden zu tun hätte. Empowerment zielt auf die Erweiterung des Copingpotentials ab, hält sich aber an keine Übungen, Methoden oder Techniken. Behaviordrama übt Verhaltensweisen mit Hilfe und Kontrolle der TherapeutInnen. Empowerment bietet den Rahmen für eigeninizierte (Neu)Entwicklungen von Verhaltensweisen und Bewältigungsstrategien, die SozialarbeiterInnen stehen unterstützend zur Seite.
3.1.3. Psychodrama empirisch gesehen
Es gibt kaum Studien die die Effizienz von Psychodramatherapie erforschen. Dies erscheint verwunderlich, wenn wir die Zahl der am Markt angebotenen Therapien in Betracht ziehen. Die hier zitierten Ergebnisse beziehen sich vor allem auf die Erforschung der Auswirkungen des kontinuierlichen Rollenspiels. 46
Die vorliegenden Studien von SCHÖNKE, MANN und PILKEY bezeichnen längerfristig eine positive Auswirkung der Therapie mittels darstellender Techniken auf die PatientInnen.
"Schönke (1975, 1976) konnte in seinen Untersuchungen bei Pädagogikstudenten feststellen, daß nach 12 Psychodramasitzungen bei den Teilnehmern der Versuchsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe Rigidität ab- und der Wunsch nach sozialem Verhalten zunimmt. Die Selbsteinschätzung verändert sich in Richtung Extraversion. Aggressivität nimmt ab. Die Untersuchungen von Mann und seinen Mitarbeitern (1956) konnten nachweisen, daß "emotional roleplaying" das Verhalten im Hinblick auf folgende Kriterien verändert:
1. Beliebtheit
2. Führungsinitiative
3. Verfolgung von Gruppenzielen
4. Kooperationsfähigkeit
5. Freundlichkeit
6. Begehrtheit als FreundIn
7. Anpassungsfähigkeit" 47
Bei retardierenden Jugendlichen wurde beobachtet, daß die Psychodramabehandlung positive Auswirkungen auf das Selbstkonzept und die Fähigkeit zur Empathie habe. 48
Die Studien belegen eine positive Wirkung des Theaters als Therapieform, auf die Verhaltensweisen der KlientInnen.
3.2. Theater der Unterdrückten nach A. BOAL
"Ich möchte die Techniken des Theaters der Unterdrückten anwenden in der Erziehung, im weitesten Sinne, in der Psychologie, dabei auch die Techniken weiterentwickeln, verfeinern, neue Techniken finden und erproben. Ich habe mich kürzlich mit einem italienischen Psychotherapeuten über einen exemplarischen Fall unterhalten. Er erzählte mir von einem Patienten, der krank wurde, weil er seinen Arbeitsplatz verloren hatte und keinen neuen finden konnte. Die Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen psychischen Probleme und Spannungen haben in ihm eine Neurose entstehen lassen. Er ließ sich behandeln und wurde von der Neurose geheilt. Das Problem der Arbeitslosigkeit war damit allerdings nicht gelöst. Was hatte der Psychotherapeut getan? Er hat ihn an seine neue Situation angepaßt. An diesem Punkt setzen wir an. Der Patient ist geheilt. Was kann er tun, um die Situation zu verändern, die ihn krank gemacht hat, die Arbeitslosigkeit. Wer oder was hat die Arbeitslosigkeit verursacht? Er? Ist er nicht an einer kranken Gesellschaft krank geworden? Ist er nicht gerade deshalb krank geworden, weil er gesund ist? Weil er der vielleicht eigentlich Gesunde ist?" 49
A. BOAL, Chemiker, Schauspieler, Regisseur, Autor und ambitionierter Gesellschaftskritiker, hat mit seinem Konzept des "Theaters der Unterdrückten" nicht nur die lateinamerikanische Realität der Gesellschaft beeinflußt. Die Techniken des "Theaters der Unterdrückten", das eine wesentliche Rolle in der Educación Popular spielt, basieren auf den Arbeiten des brasilianischen Pädagogen P. FREIRE und sollen eine Bewußtseinsbildung bei den AkteurInnen bewirken. Auf der künstlerischen Ebene wurde die Arbeit BOALs sehr stark von B. BRECHT beeinflußt.
Das "Theater der Unterdrückten" BOALs, die "Pädagogik der Unterdrückten" FREIREs, um nur zwei prägende Elemente der Educación Popular zu nennen, entspringen einer Lebensrealität von Armut, Hunger, Einschüchterung, Großgrundbesitzertum, Korruption. 40 % der Kinder im Nordosten Brasiliens starben noch im ersten Lebensjahr, 95 % der BrasilianerInnen litten an Infektionskrankheiten. N. CHAVES Untersuchung zur Lebensmittelversorgung in Brasilien ergab, daß die Anzahl an Kalorien, die ein Bauer täglich zu sich nahm, gerade genug war, um ihn bei strikter Bettruhe am Leben zu erhalten. 50
BOAL trat 1956 in das Teatro de Arena ein, wo bis zur gewaltsamen Schließung durch die Regierung kritische Stücke BRECHTs, DE VEGAs, MOLIEREs und eigene Produktionen aufgeführt wurden. Immer wieder spielte die Theatergruppe auch vor BergbauarbeiterInnen, Bäuerinnen/Bauern, SlumbewohnerInnen, ArbeiterInnen. Nach seinem Gang ins Exil, entwickelte BOAL sein Konzept weiter und BOALs Arbeit durchlief drei Formen konkreter Ansätze des Teatro Popular, die auch heute noch von politischen-, sozialpädagogischen- und Theatergruppen praktiziert werden: das politische Theater, das Soziodrama und das erweiterte Soziodrama der eigenen Realität.
a. Theatergruppen wollen mittels eines politischen Theaterstücks einen Beitrag zur Bewußtseinsbildung des Volkes leisten. Zumeist handelt es sich um politisch- aufklärerisches Theater. Viele erreichen neben dem politischen ein hohes künstlerisches Niveau. Ein großer Teil der Theatergruppen spezialisiert sich auf Propagandatheater, das das Publikum zum Nachdenken anregen will. Der Stoff der Stücke, die kritischen Inhalte, die Problemlösungen, die dabei gezeigt werden, bleiben aber immer vorgefertigte Inhalte der TheatermacherInnen. Die Provokation einer kritischen Auseinandersetzung mit den lebensweltlichen Zuständen leistet diese Form des Theaters allemal und seine wichtige Bedeutung für die Educación Popular ist unumstritten.
b. Das Soziodrama entsprang vor allem der Arbeit der politischen Basisgruppen in Lateinamerika, die sich mit den Inhalten ihrer Arbeit, den Problemen und Mißständen auf der szenischen Ebene auseinandersetzten und ihre Inhalte und Handlungsansätze auf diese Weise der Umwelt näherbrachten. Heute noch besticht diese Form des Volkstheaters durch seine Unmittelbarkeit, Kritikfähigkeit, Authentizität mit der es systematisch auf ein aktuelles Problem in der Gemeinschaft hinweist. Die Basisgruppen arbeiten weniger künstlerisch professionell und technisch entwickelt, als spontan reagierend. Oft ist ein Soziodrama die Initialzündung für Widerstand und politischen Kampf, weil es eine größere Anzahl von Personen miteinbezieht. Es ermöglicht ihnen an der Vorbereitung und Präsentation des Stückes mitzuarbeiten und leitet somit einen Empowermentprozeß bei den Beteiligten ein.
c. Die Perfektionierung des Soziodramas stellt die dritte wichtige Form des Teatro Popular dar. Sie ist auch jenes Stadium der Arbeit an der szenischen Umsetzung von Alltagsproblemen, in das der Großteil der Techniken BOALs einzuordnen ist.
"Die Gemeinschaft selbst, mit Hilfe ihrer eigenen Organisationen, ist es, die die Inhalte ihrer eigenen Realität entnimmt, zusätzliche Informationen erarbeitet, analysiert und schließlich die 'Botschaften' produziert, die sie dann, in die dramatische Form eines Stückes verpackt, mit dem Rest der Gemeinschaft konfrontiert. Die Schaffung des Stückes erfolgt kollektiv und die technische Qualität, obwohl sie nicht vernachlässigt werden darf, ist sekundär." 51
Das Soziodrama in dieser Form will ohne professionelle SchauspielerInnen auskommen. Im Kontext des Teatro Popular zieht BOAL selbst die DarstellerInnen aus dem Volk den ausgebildeten SchauspielerInnen vor. Sie sind es, die ihre Lebenswelt darstellen, durchblicken und verändern sollen. AkteurInnen sind die ArbeiterInnen einer Fabrik, die BäuerInnen eines Großgrundbesitzes, die BewohnerInnen eines Hauses, u.s.w.
Das Soziodrama und die Idealform desselben, von BOAL auch "Poesie der Unterdrückten" oder "Theater ohne Zuschauer" genannt, unterscheiden sich nur minimal von einander. Der Unterschied besteht lediglich im Grad der politischen Bildung, der Klarheit und der Fähigkeit der agierenden Gruppe strukturelle und allgemeine Zusammenhänge zu erkennen . 52
Die ZuschauerInnen werden zu aktiven TrägerInnen der Handlung des Stückes, delegieren ihre Handlungs- und Denkvorgänge nicht an SchauspielerInnen. Sie übernehmen oftmals den Part der ProtagonistInnen und bestimmen damit den Spielverlauf. Sie üben somit Handlungsfähigkeiten für die Realität ein. Hier weist das lateinamerikanische Volkstheater Parallelen zum Behaviordrama in der Psychotherapie auf.
3.2.1. Formen einer "Allgemeinbildung"
"Wir sehen den Patienten im gesellschaftlichen Zusammenhang. Wir wollen ihn nicht der Gesellschaft anpassen. Anpassen heißt kastrieren. Man kann psychische Probleme nicht von sozialen Problemen trennen. Sie sind beide eng miteinander verknüpft. Die Gesellschaft ist nichts Abstraktes. Man kann nicht eine Neurose behandeln und die Situation des Patienten belassen, wie sie ist. Auch die Situation muß 'behandelt' werden." 53
Das zentrale Thema des BOAL'schen Theaters ist Unterdrückung, wie sie tagtäglich überall auf der Welt passiert. Deshalb ist das "Theater der Unterdrückten" nicht nur in der 3. Welt, sondern auch in Europa zur wohlbekannten Technik in der politischen Arbeit geworden. Für BOAL selbst liegt der Unterschied in der Arbeit mit LateinamerikanerInnen und EuropäerInnen in der Thematik der Szenen. In Europa liegt der Schwerpunkt der Arbeitsgruppen sehr oft auf psychologischer Ebene. In Lateinamerika geht es nahezu immer um handfeste Problemlösungen für Wasserrechtsstreitigkeiten, Ausbeutung, Korruption, Niederdrückung von Aufständen durch PolitikerInnen oder Exekutivorgane, u.s.w.
BOAL ist davon überzeugt, daß jeder Mensch Theater machen, seine Situation der Unterdrückung szenisch darstellen und damit seine möglichen Wege zur Befreiung daraus entdecken kann. Er bezeichnet ZuschauerInnen als Beleidigung für das Theater. 54 Das Ziel seiner Techniken ist es, die ZuschauerInnen aus ihrer passiven Rolle im Theater und im Leben zu befreien und sie zu AkteurInnen, ProtagonistInnen, zu Handelnden in ihrer eigenen Realität zu machen. Allerdings beschränkt sich BOAL nicht auf diese Ebene der Arbeit, wie es z.B. das Behaviordrama tut, sondern will die AkteurInnen zum Weiterdenken veranlassen. Sie sollen aus ihrer eigenen Situation und der Erkenntnis, daß andere das selbe oder ähnliche Schicksale erleiden, größere gesellschaftliche und politische Zusammenhänge erkennen lernen und Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Während eines Streiks in Paris spielte BOAL mit seiner Seminargruppe eine Forumtheaterszene (vgl. Pkt. 3.2.2.) "In der Gewerkschaft aktiv, zu Hause passiv" durch. Die Szene handelte von einer Frau, die sich als Funktionärin in der Gewerkschaft durchsetzte, zuhause aber in die klassische Hausfrauenrolle verfiel.
"1. Knapp vor Dienstschluß. Hochbetrieb in der Bank. Dann Telefonate mit der Gewerkschaftsleitung, Besprechung mit Kolleginnen, die ihre Ideen und Vorschläge zur Ausführung des Streikplans begeistert aufnehmen.
2. Der Ehemann fährt vor. Er hupt. Sie zögert, hat es dann plötzlich sehr eilig, nach Hause zu kommen.
3. Zu Hause angelangt, bedient sie ihren Mann, der seinen Hobbys nachgeht, versorgt das Kleinkind, das dauernd quengelt, usw. Forum: Am Forum nahmen besonders viele Frauen teil, die die Protagonistin ersetzten und sich gegen die Unterdrückung auflehnten. Immer wieder mußte die Protagonistin erleben, daß die eigenen Kolleginnen auf sie Druck ausübten, indem sie ihr zur Nachgiebigkeit gegenüber ihrem Ehemann rieten, daß der Chef ihr die gewerkschaftliche Arbeit verbot. Eine Zuschauerin hatte den Einfall, den Mann im Auto warten zu lassen. Der 'Ehemann' gab auf, wurde sofort von anderen Zuschauern ersetzt, die andere Mittel der Unterdrückung anwandten: Anrufe, emotionale Erpressung, Lügen usw. In der Szene, die zu Hause spielte, kam es ebenfalls zu einer sehr interessanten Variante. Eine der Protagonistinnen ging so sehr in ihrer gewerkschaftlichen Arbeit auf, daß sie weder Mann noch Kind beachtete. Das Kind saß im Bad und schrie nach seiner Mutter. Als diese nicht reagierte, schrie es schließlich nach dem Vater, der sofort herbeikam. Das war für den Mann ein erster Schritt, einen Teil der Haushalts-Familienpflichten zu übernehmen." 55
Das Beispiel zeigt, welche Dynamik bei einer derartigen szenischen Diskussion von Situationen entsteht. Durch die gemeinsame Behandlung des Themas, das Vor- und Durchspielen, Einspringen, Auswechseln der Personen und Rollen, somit aufgrund des Einbringens der Gedanken und Fähigkeiten einer/eines jeden gewinnt die Szene an Komplexität und der Einzelne an Handlungsmöglichkeiten. Nur durch die gemeinschaftliche dramatische Arbeit kann eine Bewußtseinsbildung im Sinne FREIREs einsetzen.
Die "Allgemeinbildung" nach BOAL ist eine Bildung der Allgemeinheit der Unterdrückten, aber auch der UnterdrückerInnen. Durch das szenische Spiel mit den anderen AkteurInnen, erkennen wir nicht nur wo wir Opfer von Unterdrückung sind, sondern auch wo wir selbst zu UnterdrückerInnen werden. Zwar ist es nicht Ziel der Methode Handlungsoptionen für die UnterdrückerInnen zu erarbeiten, aber sie erfüllt auch in diesem Fall den Anspruch an eine allgemeine Bewußtseinsbildung.
3.2.2. Das Spiel mit der Bewußtseinsbildung - Methoden nach Boal
"Zwar benennt Boal eine besondere Technik 'Widerstand gegen Unterdrückung', die mit dem Selbstbehauptungstraining entfernt verwandt ist, Widerstand gegen Unterdrückung schließen jedoch alle seine Techniken ein: sowohl gegen die Unterdrückung, die man sich selbst zufügt, als auch gegen die Unterdrückung durch andere, Menschen und Institutionen, intellektuell, körperlich und emotional." 56
A. BOAL experimentierte lange mit den Möglichkeiten des klassischen aristotelischen Theaters. Seine Gruppe inszenierte BRECHT in der Sprache des Volkes, BOAL ließ SchauspielerInnen in der Umgangssprache der einzelnen brasilianischen Provinzen unterrichten, u.s.w. Trotzdem stießen sie sehr schnell an die Grenzen des aufklärerischen, politischen Theaters, das trotz arenenartiger Rundbühne und allgemein verständlicher Sprache immer nur ein "von der Bühne zum Publikum" sein kann. Dies schien BOAL nicht genug. Die Theatergruppe entwickelte Schritt für Schritt das "Theater der Unterdrückten". BOAL selbst nennt es "Die Übereignung des Theaters an den Zuschauer". 57 Die vier Formen des "Theaters der Unterdrückten", die im Laufe der Jahre von BOAL eingesetzt wurden, sind: Zeitungstheater, Statuentheater, Forumtheater und Unsichtbares Theater.
Ende der 60er Jahre beginnt die Truppe mit dem breiten Einsatz von Zeitungstheater, welches im Gegensatz zum Living Newspaper aus den USA durch gezieltes, pointiertes, akzentuiertes Lesen von Zeitungsmeldungen den MitleserInnen und ZuhörerInnen das "Lesen zwischen den Zeilen" lernen wollte. Hiezu gibt es verschiedenste Techniken, wie z.B. Einfaches lesen, Gekoppeltes Lesen, Vervollständigendes Lesen, Pantomimisches Lesen, u.s.w. 58
Das Statuentheater ähnelt dem sozialarbeiterischen Familiensculpting. Bestimmte Begriffe werden pantomimisch in einem "Festbild" von einem Gruppenmitglied gestellt. Wenn das Bild z.B. zum Thema "Imperialismus" fertig ist, dann bekommen die anderen Gruppenmitglieder die Möglichkeit Personen und Situationen zu verändern. Wichtig ist dabei zu einem gemeinsamen, kollektiven Endbild, das für alle die Realität spiegelt, zu gelangen. Danach wird der Begriff nochmals als Wunschbild dargestellt. Von diesen Bildern ausgehend sollen ein bis drei Übergangsbilder entstehen und die Veränderung vom Real- zum Idealbild darstellen.
"Eine junge Frau aus dem Dorf Otusco, sollte ihren Heimatort darstellen. Vor der Revolution war es in Otusco zu einem Bauernaufstand gekommen. Die Großgrundbesitzer nahmen den Anführer fest, ließen ihn auf den Dorfplatz bringen und öffentlich kastrieren. Die junge Frau aus Otusco stellte diese Szene dar. Einer kniete als Opfer auf dem Boden, ein anderer beugte sich über ihn, ein dritter hielt ihn fest. Vor den dreien kniete eine Frau mit gefalteten Händen. Dahinter fünf Gefangene, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Abseits, in mächtiger Pose, ein Großgrundbesitzer, neben ihm zwei Leibwächter, das Gewehr im Anschlag. Als Idealbild ihres Dorfes stellte die junge Frau sodann eine Gruppe arbeitender und einander umarmender Menschen zusammen." 59
Das Verbindungsbild dieses Beispiels ist ein mehrfaches, das heißt von der Dorfbevölkerung wurden verschiedene Möglichkeiten der Veränderung der Realität gefunden, wie z.B. die Revolte gegen den Großgrundbesitzer mit und ohne den Leibwächtern, die Kraft der weiblichen Bevölkerung beim Widerstand, u.s.w.
Die Weiterentwicklung des Statuentheaters bildet das Forumtheater, das sowohl pantomimisch als auch gesprochen funktioniert. Hierbei greifen die ZuschauerInnen aktiv in die Handlung ein, indem sie an einem ihnen entscheidend vorkommenden Punkt "Stop" sagen und die SchauspielerInnen, deren Part sie übernehmen wollen, ersetzen. Die SchauspielerInnen bleiben dabei als Hilfs-Ich im szenischen Geschehen. Im Forumtheater entwickelt sich eine dramaturgische Diskussion über Handlungsmöglichkeiten der ProtagonistInnen zwischen den ZuschauerInnen, ohne daß sie miteinander über den Ablauf des Stückes sprechen.
Die letzte und für Laien am schwierigsten umzusetzende Technik ist das "Unsichtbare Theater". BOAL selbst möchte auch dabei keine professionellen SchauspielerInnen einsetzen, gerade bei dieser Form des "Theaters der Unterdrückten" muß allerdings ein gewisser Grad an Professionalität von den SpielerInnen an den Tag gelegt werden. Das Unsichtbare Theater will wachrütteln, beschämen, schockieren, provozieren und schließendlich analysieren. Die Gruppe spielt dabei eine Theaterszene, ohne daß ihr Umfeld dies bemerkt, z.B.
"Auf einem Marktplatz am Stadtrand von Lima improvisierten zwei Schauspielerinnen eine Szene vor einem Gemüsestand. Die eine gab sich als Analphabetin aus und behauptete, der Händler betrüge sie, weil sie die Preise nicht lesen könne. Die andere rechnete nach und fand, es sei alles in Ordnung, riet ihr aber, an einem Alphabetisierungskurs der ALFIN teilzunehmen. Zwischen den Umstehenden, Händlern wie Kunden, entspann sich eine längere Diskussion darüber, in welchem Alter man am besten mit dem Lernen beginnen sollte und was, wie und wo man lernen solle. Dennoch behauptete die Schauspielerin nach wie vor, 'für so etwas zu alt' zu sein. Da schaltete sich ein altes Mütterchen entrüstet ein: 'Du redest dummes Zeug! Fürs Lernen und für die Liebe ist es niemals zu spät!' " 60
Die Wirkung einer derartigen Szene in der Öffentlichkeit ist, daß sich die Umstehenden Gedanken zum Thema machen, sich einbringen, ihre Meinung sagen und so auch vielleicht selbst - um beim Beispiel zu bleiben - einen Alphabetisierungskurs besuchen werden. Das Unsichtbare Theater ist Bewußtseinsbildung ohne formalen Rahmen, es wird dort gespielt, wo die Menschen sind, auf der Straße, im Restaurant, in der U-Bahn.
3.2.3. Die Ziele des "Theaters der Unterdrückten"
"Das Teatro Popular ist nichts anderes als der Prozeß, mittels dessen der Mensch, in seiner Rolle als Schöpfer, seine Realität wahrnimmt, sie reflektiert und sie, indem er sie durch seinen Gedanken in ein Kunstwerk verwandelt, reproduziert. Ein Prozeß, der durch die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung bedingt wird und damit auf das Engste mit der sozialen Praxis jedes Einzelnen verknüpft ist. - Nationaler Kongreß über Educación Popular, Lima, März 1980" 61
Ausgehend vom Kampf um die Menschen- und Bürgerrechte der Völker in den 3. Welt-Ländern unserer Zeit zielt das "Theater der Unterdrückten" kongenial auf die Auflösung der Ungerechtigkeit und Repression ab. Unterdrückung hat viele Gesichter, was für Menschen in der 3. Welt der Aufstand gegen einen diktatorischen Bürgermeister oder die Enteignung eines Großgrundbesitzers und die Eröffnung einer Kooperative sein kann, ist für uns EuropäerInnen oftmals der Widerstand gegen sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz, Ignoranz, Beziehungsprobleme. Mit den Techniken BOALs lassen sich alle Themen szenisch interpretieren, was die Probleme und Handlungsansätze aus der sprachlichen Ebene unserer Persönlichkeit holt. Ein anderer Umgang mit den Situationen sowie den Lösungsmöglichkeiten entsteht. So ist es mit einigen Methoden des "Theaters der Unterdrückten" möglich, vollkommen wortlos, eine klare Diskussion über ein Thema zu führen. Der Einsatz des ganzen Körpers in oft überspielter Darstellungsform unterstützt den kognitiven Prozeß, den die MitspielerInnen durchlaufen. Es ist erwiesen, daß wir szenisch bearbeitete Strategien, die wir selbst stellen und spielen, schneller und besser erlernen, als durch bloßes Vortragen oder Diskutieren. Das beweist auch der oftmalige Einsatz von Rollenspielen in der sozialarbeiterischen Ausbildung.
Das "Theater der Unterdrückten" ist weder Manipulationsmethode noch dient es einem "therapeutischen" Zweck im engeren Sinn. BOALs Theater unterstützt die Menschen ihre Realität kritisch zu reflektieren, sie zu verändern und die bewußtseinskontrollierenden, ansozialisierten Märchen, wie z.B. das von der Unveränderbarkeit der Welt, zu zerstören. Die einzelnen Techniken des "Teatro Popular" sind der Beginn, der Auslöser, eines Bewußtwerdungsprozesses. Sie stellen somit einen möglichen Teil eines Empowermentprozesses dar, der schon mit der Entscheidung zur Teilnahme an einem BOAL'schen Theaterworkshop - oder noch früher - beginnt.
So greifen die Ziele des Empowerments und jene des "Theaters der Unterdrückten" ineinander. Empowermentprozesse verändern den Menschen, der sie durchläuft, "Teatro Popular" verändert - aufgrund einer ersten Bewußtwerdung und daher Teilnahme - die Sicht auf die Umwelt und kann einen Umsturz in dieser bewirken. Dieser Umsturz durch den unterdrückten Menschen selbst herbeigeführt ist Empowerment im Sinne einer weiteren Persönlichkeitsentwicklung.
"Die letzte und wichtigste Grundregel, sie sei zum Abschluß noch einmal unterstrichen, ist die der Integration des Teatro Popular in den Prozeß des sozialen Wandels, der undenkbar ist ohne entsprechende Organisationsformen, die vom Volk ausgehen und von ihm getragen werden und wo das Teatro Popular einen Beitrag, vielleicht sogar einen wichtigen Beitrag leisten kann, aber eben nur einen Beitrag." 62
4. Versuch einer Charakterisierung von KlientInnen sozialtherapeutischer Obdachloseneinrichtungen am Beispiel des Vinzenzhauses der Caritas
Obdachlosigkeit ist ein komplexes Phänomen. Auf den ersten Blick erscheint es einfach, die KlientInnen von sozialtherapeutischen Obdachloseneinrichtungen mit den üblichen Defizitkategorien zu beschreiben, betrachten wir jedoch die Biographien von Betroffenen, so stellen sich die Unterschiede heraus. Um der Individualität der Lebensgeschichten, auf die ich mich beziehe, gerecht zu werden, möchte ich drei Lebensläufe von Klienten aus dem Vinzenzhaus hier kurz zusammenfassen.
Walter O., geboren 1962 in Niederösterreich als zweiter Sohn, wächst in durchaus bürgerlichen Verhältnissen auf. Nach der Übersiedlung nach Wien arbeitet der Vater als Operationsgehilfe, die Mutter als Hausbesorgerin. Walter O. absolviert vier Klassen Volks- und vier Klassen Hauptschule. In dieser Zeit lassen sich die Eltern von einander scheiden. Durch diese Krise lassen die Leistungen in der Schule nach, schon im Polytechnischen Lehrgang beginnt Walter zu trinken. Trotzdem schließt er die Lehre zum Herrenkleidermacher ab. Die Alkoholprobleme nehmen zu, er wird zum Asthmatiker. Es folgen zweieinhalb Jahre im Zustelldienst der Post, wodurch aber auch der Alkoholkonsum noch mehr zunimmt. Durch Vermittlung seines Vaters erhält Walter eine Stelle in der Wiener Gebietskrankenkasse, aber auch die verliert er aufgrund der Alkoholprobleme nach ca. eineinhalb Jahren. Walter lebt vom Arbeitslosenentgelt sowie von der Unterstützung seiner Mutter, die ihn aber nach einiger Zeit auf die Straße setzt. Aufgrund von Informationen aus der Obdachlosenszene nimmt er Kontakt zum Psychosozialen Dienst auf und geht das erste Mal auf Therapie nach Ybbs/Donau. Der Therapie folgt ein Umschulungskurs und während dessen ein Rückfall und die zweite Therapie. Walter beendet den Umschulungskurs zum Bürokaufmann mit Erfolg und kehrt nach Wien zu seiner Mutter zurück. Trotz großer Bemühungen findet er keine Arbeitsstelle, aber er kann eine kleine, für ihn leistbare Wohnung beziehen. Nach einem Jahr erfolgloser Arbeitssuche wird er wieder rückfällig und geht das dritte Mal in Therapie, nach der er vom Bahnhofssozialdienst in das Notquartier des Vinzenzhauses vermittelt und nach einiger Zeit dort auch fix aufgenommen wird. Mittlerweile ist Walter seit drei Jahren trocken und lebt in einer Prekariumswohnung der Caritas. Er wartet auf die Zuweisung einer eigenen Gemeindewohnung und hat nach der Verfassung von 240 Bewerbungs-schreiben leider noch immer keine Arbeitsstelle in seinem Ausbildungsbereich gefunden.
Norbert T. 63 wurde 1962 als drittes Kind seiner Familie in Wien geboren. Durch die Alkoholprobleme der Mutter und des Vaters kamen die Kinder nach 1973 in ein Caritas-Kinderheim. Nach vier Jahren Kinderheim folgen vier Jahre Lehrlingsheim, die Vulkaniseurlehre schließt Norbert nicht ab, daher muß er aus dem Gesellenheim ausziehen. In dieser Zeit setzen schon die eigenen Alkoholprobleme ein und er landet auf der Straße. Gemeinsam mit den ebenfalls obdachlos gewordenen Eltern schläft er in Abbruchhäusern oder im Prater. Es kommt zu kurzfristigen Gefängnisaufenthalten nach Alkoholdelikten (schwere Körperverletzungen). 1983 erleidet die Mutter einen Schlaganfall und stirbt kurz darauf, der Vater fällt betrunken die Treppe hinunter. Norbert zieht zu seinem Bruder. Der Alkoholkonsum ist bei durchschnittlich zwei Flaschen Wein und einer Kiste Bier täglich. Vom Bruder zieht er in das öffentliche Heim in der Meldemannstraße und von dort in das Heim der Magistratsabteilung 12 (MA 12 - Sozialamt) in der Gänsbachergasse und weiter in eine Volkshilfewohnung. Da sich die Alkoholprobleme jedoch verstärken, muß Norbert eine Alkoholtherapie im PKH Baumgartner Höhe absolvieren und gelangt über diesen Weg, nach Beendigung der Therapie, ins Vinzenzhaus der Caritas. Nach zwei Jahren Stabilisierung im Vinzenzhaus (Alkoholkontrolle, Schuldenregulierung, Langzeitarbeitslosenprojekt Baustadt) zieht Norbert in die Prekariumswohnung, wo er zur Zeit noch nachbetreut wird.
Richard L., 1966 in Baden bei Wien geboren, hat zwei Schwestern - eine jüngere und eine ältere. In seinem Lebenslauf beschreibt er seine Kindheit als "relativ glücklich", belastend wirken sich jedoch die Eheprobleme der Eltern aus. Der Vater neigt zu übermäßigem Alkoholkonsum und schlägt Mutter und Kinder. Durch die belastende Situation zuhause sinkt die Lernleistung des anfänglich guten Schülers im Gymnasium mehr und mehr, sodaß er nach der fünften Klasse abbricht und eine Lehre als Einzelhandelskaufmann beginnt. Er wechselt später ins Gastgewerbe und schließt die Koch- Kellnerausbildung ab. Es folgt ein mehrfacher Arbeitsstellenwechsel. Bei der ersten Gelegenheit flüchtet Richard aus dem Elternhaus nach Wien (mit 19 Jahren), um sich eine eigenständige Existenz aufzubauen. In dieser Zeit werden die psychischen Probleme (Depression, Kontaktschwierigkeiten, Aggressionsstau, Verfolgungsideen) immer stärker. Dadurch verliert er seine Arbeitsstelle wieder, kann die Miete für die Wohnung nicht mehr bezahlen und schläft einige Tage vor der Türe seiner Wohnung, aus der er ausziehen mußte. Nach einem Suizidversuch landet Richard über das PKH im Vinzenzhaus der Caritas. Nach eineinhalb Jahren, in denen der Betreuer eine Vertrauensbasis mit Richard schaffen konnte und sich aggressive und grenzpsychotische Verhaltensweisen manifestieren, gelingt es ihm Richard zu einer stationären Psychotherapie mit anschließender Medikationstherapie zu bewegen. Seit 1994 lebt er, bei dem eine schizoaffektive Psychose diagnostiziert wurde, unter Neuroleptikamedikation. Nach einem Jahr in der Prekariumswohnung übersiedelt er Ende 1995 in seine Gemeindewohnung, bezieht zur Zeit Invaliditätspension und möchte seine Schulausbildung fortsetzen (Abendhandelsschule). Richard besucht nach wie vor drei Mal in der Woche das Vinzenzhaus, dessen Bewohner und MitarbeiterInnen seinen wichtigsten sozialen Bezugsrahmen bilden.
Wie wir schon bei diesen drei, sehr kurz gehaltenen Lebensläufen erkennen, gibt es verschiedenste Blickwinkel auf die Lebenswelten der KlientInnen, die wir zur Erarbeitung von Gemeinsamkeiten in der Klientel, einnehmen können. Auf der psychodiagnostischen Ebene finden sich im Vinzenzhaus von "ganz normalen", angepaßten Persönlichkeiten bis hin zu Borderlinern und anderen neurotisch-psychotischen Devianzen, vor allem aber Suchtkranken (mit und ohne Therapie), alle möglichen Persönlichkeiten. Auf der sozialen Ebene finden sich Menschen, die aus sozial depravierten Umständen stammen (Heimvergangenheit, Waisenkinder, Alkoholikerfamilien, ...) neben Menschen aus "gut-bürgerlichem" Elternhaus, mit unter sogar Menschen mit guter Berufs- und Allgemeinbildung. Obdachlosigkeit wird durch viele Faktoren bewirkt und bedarf eines langen Prozesses. Selbstverständlich fallen hierbei die "Defizite" ins Auge: Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Bildungsdefizite, gescheiterte Beziehungen, Verlust der Heimat, psychische und somatische Krankheiten, destruktive Problembewältigungsmethoden, Vorstrafen, etc. Es liegt auf der Hand - insbesondere in der Empowermentsichtweise -, daß diese Auflistung der Defizite die individuelle Situation eines Obdachlosen nicht ausreichend erfaßt. Dennoch ergibt sich daraus, daß, und darauf baut das Konzept des Vinzenzhauses auf, eine komplexe Antwort auf die komplexe Problemsituation gegeben werden muß. Das heißt in Ansätzen auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Methoden in unterschiedlicher Intensität.
"Für uns ist Empowerment noch kein gängiger Begriff, daher ist es im Konzept nicht definiert. Wenn ich es bisher richtig verstanden habe, dann ist es genau die Grundhaltung, die sich bei uns im Laufe der Jahre in der Arbeit mit den Klienten entwickelt hat. Es hängt stark mit dem Begriff der Handlungsfähigkeit zusammen und hat sich als sinnhaftester Ansatz für uns herausgestellt." 64
Das Vinzenzhaus 65 besteht seit 1985 und ist eines von sechs Obdachlosenheimen der Caritas in Wien. Durch die Zusammenarbeit mit Therapiestellen hat sich das Vinzenzhaus als Nachbetreuungseinrichtung von Alkoholkranken nach einer abgeschlossenen Therapie herausgebildet. Abgesehen von der täglichen Alkoholkontrolle, den turnusmäßigen Alkoholismusseminaren, der gemeinsamen Nachbetreuung mit der Therapiestelle (gegebenenfalls Krisenintervention nach Rückfällen) ist die spezielle Ausrichtung der Betreuung auf die Suchtproblematik (Aufarbeitung von Rückfällen) wesentlicher Bestandteil des Betreuungsgefüges. Das Vinzenzhaus verfügt über ein Stufenprogramm, vom Erstkontakt bis zur Prekariums- und danach Gemeindewohnung, und ein mehrschwelliges Angebot. Das Betreuungsverhältnis ist zur Zeit 1:10. Neben vierzig Teestubengästen, die täglich versorgt werden, verfügt das Vinzenzhaus über 12 Notschlafplätze und 33 betreute Wohnplätze, wovon ca. 2/3 an Ex- Therapiepatienten vergeben werden. Von diesen hat jeder eineN fixeN BetreuerIn, mit der/dem regelmäßige Betreuungsgespräche abgehalten werden. Im Rahmen der Betreuung werden die sozialarbeiterischen Belange bearbeitet (Dokumentenbeschaffung, Schuldenregulierung, Arbeitssuche, ...) ebenso die Gesundheitsprobleme, aber vor allem liegt das Augenmerk auf der Aufarbeitung der Lebensgeschichte. Wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Einbindung des Klienten in die Hausgemeinschaft, die auch durch die Mitarbeit in den Hausarbeitsbereichen geschaffen wird (dies ist ein Feld ständiger Auseinandersetzung für alle Beteiligten). Die Freizeitgestaltung ist besonders für die Suchtkranken eine wichtige Stütze in der Bewältigung ihrer destruktiven Lebensgestaltung. Es ist dies auch ein Bereich, der von den MitarbeiterInnen und der Heimleitung besonders gefördert wird (z.B. Mitfinanzierung von Sportaktivitäten: Darts-, Tischtennis, Fußballturniere, Kegeln, Radausflüge, Wandertage, Schlittschuhlaufen, etc.; Kulturprogramm: Kabarettbesuche, etc.). Im Rahmen dieser Bemühungen hat auch die Entwicklung der Kreativprojekte einen festen Platz. (vgl. Pkt. 6.1.2).
Das pädagogische Grundprinzip der Betreuungsarbeit im Vinzenzhaus läßt sich mit den bereits vorgestellten Überlegungen zum Empowerment vergleichen. Insgesamt geht es darum, eine lebensbejahende Atmosphäre zu schaffen, in der es den Betreuten und BetreuerInnen gelingt, zu neuen Lebenskonzepten zu finden. Dabei gilt es, Ohnmachtspositionen (externe Attribution) zu überwinden und ein Gefühl der Selbstgestaltungsfähigkeit aufzubauen. Jeder Hausbewohner soll die Möglichkeit erhalten den Lebensraum, in dem er sich befindet, verändern zu können. Dies gilt schon für seine eigene psychische und soziale Situation, aber auch für die konkreten Belange des alltäglichen Zusammenlebens. Das Prinzip der Mitgestaltung wird auf vielfältige Art und Weise umgesetzt (hier sind die BetreuerInnen in ihrer Kreativität gefordert): z.B. Putzdienste, Portiersdienste, Küchendienste, Waschküche (und die begleitenden Besprechungen, Reflexionen, Kritik); die Gestaltung der Zimmer, der gemeinsamen Aufenthaltsräume (Ausmalen, Bilder, Pflanzen, Aquarium); die Betreuung von Kapelle und Werkstatt; Einbeziehung in die Gestaltung von Freizeitaktivitäten (mit dem Versuch dem Menschen genügend Eigenaktivität zu belassen, Delegieren); Mitarbeit bei den Rundbriefen, der Kirchenzeitung (Artikel, Gedichte, Zeichnungen); Saftbeisldienst (Organisation, Einkauf, Kontrolle, Dienstplan); Messe und Kirchenmitarbeit (Gestaltung der Liturgie, Agape, Ministranten, etc.), Hausversammlungen (das gemeinschaftliche Mitreden) ... Die MitarbeiterInnen sind angehalten, sich in ihren Arbeitsbereichen um die konkrete Umsetzung dieses Prinzips zu bemühen, das heißt auch möglichst die Hausbewohner einzubeziehen, Verantwortung zu delegieren und auch durch entsprechendes Feedback zu motivieren. Die Überwindung der Angst vor Veränderung und vor Überforderung wird hier in überschaubaren Bereichen geleistet. Der Klient bekommt die Möglichkeit, durch selbstverantwortliche Bewältigung einer Aufgabe, z.B. Verantwortung für die Pflanzen im Haus oder das Aquarium, Vertrauen in sich selbst zu erhalten. Dies hilft ihm bei der Überwindung von anderen Ängsten. Auf dieser Ebene leuchtet auch ein, daß Freizeitaktivitäten oder Kreativprojekte zur Überwindung eines Angstpotentials beitragen können.
"Es ist keine neue Erkenntnis, wenn ich sage, daß wir nicht motivieren können, sondern daß es prinzipiell nur möglich ist nachzusehen was die demotivierenden Faktoren sind. So erkennen wir dann meistens ihre Schwächen und Stigmatas, die sie mit sich herumtragen. Die Lust zur Arbeit, zur Kreativität, "etwas weiterzubringen" fehlt. Das ist ein großes Problem. Wenn mehrere solcher Klienten im Haus sind, dann fehlt auch noch die Gruppendynamik und somit sitzen alle vor dem TV-Gerät statt sich anders zu betätigen." 66
Wir können uns bei den eingangs erwähnten Biographien die Frage stellen, inwiefern sie das Empowermentangebot des Hauses für ihre Rehabilitationsprozesse genützt haben. Walter O. ist es bisher gelungen, seine frustrierende Langzeitarbeitslosigkeit ohne Alkoholrückfall zu bewältigen, indem er auch noch während seiner Zeit in der Prekariumswohnung Portiersdienste im Vinzenzhaus übernimmt, aber auch an anderen Aktivitäten des Hauses teilnimmt. Dies gilt auch für Norbert T., der sowohl in der Saftbeislorganisation, als Putzdienst und als Ministrant aktiv ist. Auch er ist seit Jahren rückfallsfrei. Richard L. besucht zur Zeit die Abendhandelsschule und ist Mitglied der Caritasmeßgemeinde. Er nimmt gelegentlich an Aktivitäten des Hauses teil. Alle drei befinden sich bereits in einer eigenständigen, nachbetreuten Wohnform und sind psychisch stabil. In den persönlichen Gesprächen äußern sie immer wieder, daß das Angebot des Hauses bei der Aufrechterhaltung ihrer Eigenständigkeit hilfreich ist. Für unsere Thematik im Fordergrund stehend, ist jedoch, daß es allen drei möglich ist ihre Bedürfnisse zu erkennen und diesen in der ihnen angemessenen Form nachzukommen. Die eigenen Wünsche, Ziele und Grenzen kennenzulernen (und in der Folge zu kennen), auch das ist Empowerment.
5. Theater als Methode zum Empowerment
Durch die Kritik B. BRECHTs am klassischen aristotelischen Theater ist ein Hinweis gegeben, daß Theaterarbeit mehr ist als bloße Darstellung von Situationen oder Gegebenheiten. Theater hat, wie jede Kunst, den Willen den sozialen und ästhetischen Kontext, in dem sie geschieht, mitzugestalten, oder zumindest zu reflektieren. Dabei ist zu bedenken, daß es eine unüberbrückbare Differenz zwischen dem Anliegen der Kunst und der Erreichung ihrer Ziele gibt. Dennoch erhält die Kunst Werte am Leben, die für den Fortschritt und für die Gestaltung einer lebenswerten Umwelt unerläßlich sind. Kunst glaubt an das Leben. 67
BRECHT, der sein episches Theater dem aristotelischen Theater entgegenstellt, versteht das "Theatermachen" als eine von verschiedenen Formen der öffentlichen Äußerung. Er will "spielen, was hinter den Vorgängen vorgeht". 68 Die epische Form des Theaters bewirkt im Zuschauer Distanz zum Betrachteten und fordert ihn intensiver auf "über die Vorgänge nachzudenken". Seine Aktivität soll geweckt werden, es soll mit Argumenten statt mit Suggestionen gearbeitet werden.
"Der Zuschauer des dramatischen Theaters sagt: Ja, das habe ich auch schon gefühlt. - So bin ich. - Das Leid dieses Menschen erschüttert mich, weil es keinen Ausweg für ihn gibt. - Das ist große Kunst: Da ist alles selbstverständlich. - Ich weine mit den Weinenden, ich lache mit den Lachenden.
Der Zuschauer des epischen Theaters sagt: Das hätte ich nicht gedacht. - So darf man es nicht machen. - Das ist höchst auffällig, fast nicht zu glauben. - Das muß aufhören. - Das Leid dieses Menschen erschüttert mich, weil es doch einen Ausweg für ihn gäbe. - Das ist große Kunst: Da ist nichts selbstverständlich. - Ich lache über den Weinenden, ich weine über den Lachenden." 69
5.1. Ziele
Die Ziele von Theaterarbeit lassen sich nach zwei Gesichtspunkten einteilen:
a. der Blick von der Bühne ins Publikum und
b. der Blick vom Publikum auf die AkteurInnen.
a. für die Akteure Die Beteiligten sollen
- sich mit der eigenen Rolle auseinandersetzen lernen, das heißt mit den Kompetenzen und Defiziten
- im Spiel und in der Organisation Selbstgestaltungspotential entdecken
- Gemeinschaft mit allen dazugehörigen Problemen, wie z.B. Konkurrenz, Nähe, Distanz, Intimität, Abgrenzung, etc., erleben
- die Möglichkeit erhalten ihr "Produkt" zu präsentieren. Die Präsentation des Erarbeiteten spielt eine bedeutende Rolle im Empowerment- oder therapeutischen Prozeß . Persönliches wird objektiviert, aus der Hand gegeben, der Kritik ausgesetzt und kann, wie im Kontext des Psychodramas gezeigt, zur Integration von abgespaltenen Per- sönlichkeitsanteilen beitragen.
b. für das Publikum
Die ZuschauerInnen sollen
- mit den Anliegen der AkteurInnen konfrontiert werden, diese Anliegen können entweder die Gruppe selbst betreffen (z.B. Obdachlosigkeit, Sucht, Behindertenproblematik,...), diese Anliegen können aber auch allgemein gesellschaftspolitischer oder ästhetischer Natur sein.
- die Möglichkeit erhalten mit den AkteurInnen auch direkt in Kontakt zu treten (entweder durch die Einbeziehung ins dramatische Geschehen selbst oder durch Gespräche, Feedbacks nach der Aufführung, u.s.w.)
- durch Anwesenheit, Feedback, Anteilnahme und finanzielle Unterstützung den Empowermentprozeß der AkteurInnen unterstützen und zum Weiter- machen motivieren
- als Lobby für die Anliegen der AkteurInnen gewonnen werden
Die Ziele des Empowerments und der Theaterarbeit, wie ich sie hier dargestellt habe, decken sich weitgehend. Empowerment ist jener Prozeß, der dazu führen soll, daß das persönliche Potential entdeckt und verwirklicht wird. Das Individuum soll in der Gemeinschaft seine Grenzen und Stärken erfahren und zunehmend Verantwortung für seine Lebensgestaltung aber auch für die Gestaltung des gemeinsamen Lebensraumes übernehmen. Autodestruktion und Angst sollen dabei überwunden werden. Die externe Attribution soll zugunsten der internen aufgegeben werden. Das Theaterspiel, mit seinen ganzen psychodramatischen Möglichkeiten, kann den hier dargelegten Empowermentprozessen dienen. Gemeinsam mit anderen können wir durch das Spiel von Rollen die Grenzen unserer Persönlichkeit, unserer ureigensten Rolle erfahren. Die damit in Verbindung stehenden Prozesse der Selbstreflexion, des Zulassens von Gefühlen, des Einteilens von Energie, der Koordination von Innen und Außen, Nähe und Distanz, u.s.w. können eine Neuorganisation der Persönlichkeit begünstigen.
"Was hast Du dazugelernt? - Daß man irgendwie durchhält, auch wenn es einem gerade nicht gefällt. Ausdauer, daß man nicht aufgibt, und daß es auch andere Menschen gibt, die dir dabei helfen. Aber man muß auch selber etwas dazu beitragen." 70
"Was hat das Projekt für Dich gebracht? - Sehr viel. Ich glaube, ich bin nicht der Mensch, der so aus sich herausgeht. Ich bin bei dem Stück aufgetaut. Ich bin viel freier geworden." 71
"Während der Proben fiel mir auf, daß ich keinen Alkoholiker spielen kann und wollte. Aus Überzeugung nicht. (...) So entschloß ich mich, nach langem Überlegen, die Rolle zurückzulegen. Ich habe es am Mittwoch beim Feedback der Gruppe mit mulmigem Gefühl mitgeteilt. Und es war gut so." 72
"Im Laufe der Woche in Zwettl hast Du einmal gesagt, daß diese Rolle für Dich wie eine Therapie ist (...)? - Ja, weil ich den Frust, den ich die ganzen Jahre hindurch aufgestaut habe, richtig loswerden habe können. Da hab ich es richtig rausschreien können. Welchen Frust? - Durch meine verpatzte Ehe halt. Und dadurch, daß ich immer geschluckt und geschluckt habe, ist es mir auf einmal zu viel geworden und da habe ich das endlich richtig rausschreien können. Ist es Dir gut gegangen beim Spielen? - Ja. Es war irgendwie eine Erleichterung, ein Freimachen von innen heraus (...)." 73
Kongenial spielen Empowerment und Theaterarbeit hinsichtlich ihrer Offenheit in der Methodik zusammen. So wie es im Empowerment keine spezifische Methode gibt, ist Theaterarbeit für alle Methoden offen. Alle, die teilnehmen wollen, können sich mit ihren Begabungen und mit der ihnen entsprechenden Intensität und Abgrenzung einbringen. Darüber hinaus haben Theaterarbeit und Empowerment eine soziale, ja mit unter sozialpolitische, Ausrichtung. Das kreative Geschehen erschöpft sich nicht in der quasi psychotherapeutischen Selbstspiegelung, sondern zielt nach außen, hin zur Einbeziehung des sozialen Kontexts. Nicht nur das Individuum soll und kann sich verändern, auch die unmittelbare Umwelt wird von den kreativen Prozessen erfaßt und verändert. Die Kontaktaufnahme mit dem Publikum ist dabei nur die am besten erkennbare Form, aber vielleicht nicht einmal die effizienteste. Die Veränderung der Umwelt durch derartige Theater-Empowerment-Projekte vollzieht sich durch die Interaktion der Beteiligten mit ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld. Sie spielt sich in den Betreuungsgesprächen, den Freundschaften, Partnerschaften, der positiven Einstellung zum Umfeld und letztlich zum eigenen Leben ab. Es sind genau diese "Synergieeffekte", die kaum meßbar sind, die aber das Empowerment eigentlich ausmachen. Die Messung der Zuschauerreaktion auf ein bestimmtes, oft begrenztes Produkt, oder die Messung der subjektiven Aussagen der AkteurInnen greift hier zu kurz. Das wesentliche geschieht im zwischenmenschlichen Bereich, in der Einstellung zum Leben als Ganzem.
"Ich kann mich erinnern, daß ich bei der Uraufführung die Menschen im Publikum beobachtet habe und mir dachte, daß das jetzt doch einige sehr betroffen machen müßte. Ich hatte das Gefühl, daß viele im Publikum lebendiger geworden sind und plötzlich bemerkten "Jessas, das bin ja ich!" und das geht immer in irgendeiner Form tief. Das heißt sie waren teilweise mit sich selbst konfrontiert. Vielleicht konnten sie sich das erste Mal selbst sehen und sich ihre Situation so bewußtmachen. Ich weiß sehr gut, wie schwierig eine Selbstreflexion ist und das überhaupt zu tun bedeutet schon einen sehr großen Schritt. Es ist auch wirklich das größte Problem für unsere Männer, daher ist es natürlich viel anschaulicher, wenn man es ihnen auf einer Bühne zeigt. Also ich bin davon überzeugt, daß Aufführungen, wie "So ein Theater" etwas bewirken, bei denen, die schon so weit sind... Meßbar ist es natürlich nicht, nur spürbar." 74
5.2. Kreativität und Entwicklung
"Kreativität ist eine Bezeichnung für die Fähigkeit etwas Neues oder Originelles (und gleichzeitig etwas Sinnvolles) zu erfinden oder zu produzieren. Kreative Personen zeichnen sich allgemeiner Auffassung zur Folge aus durch Eigenschaften wie: Flexibilität, Originalität, Individualität, Sensibilität, Nonkonformismus und Einfallsreichtum. Die Denkprozesse des Kreativen verlaufen eher divergierend als konvergierend, das heißt, sie führen zu vielen unüblichen Ideen und Lösungvorschlägen zu einem Thema oder Problem, statt sich auf das Auffinden einer "richtigen" Idee oder Lösung zu konzentrieren." 75
Der Begriff Kreativität, der seit dem berühmten Vortrag "Creativity" von G.P. GUILFORD im Jahr 1950 eine ganze Forschergeneration beschäftigt, läßt sich weder scharf noch objektiv definieren. Die Kreativitätsforschung 76 bezieht sich vor allem auf das Problemlösungsverhalten von Menschen, das heißt auf Aspekte der Intelligenz. 77 Kreativität spielt sich nicht nur im Hirn ab. Sie betrifft den ganzen Menschen, sein Verhalten und sein Gefühlsleben. Der ganze Mensch ist kreativ, ja nur als Kreativer ist er Mensch.
Der Mensch entwirft sich selbst. Er paßt sich nicht nur an Situationen an, er paßt die Situationen auch an seine Bedürfnisse an und er kann seine Bedürfnisse an die Situationen anpassen. Der Mensch hat kein vorgegebenes Bild von sich selbst und er muß auch keine vorgegebenen Ziele erfüllen. Er ist, wie M. SCHELER und A. GEHLEN feststellen, das offene, nicht festgestellte Lebewesen in biologischer, wie in psychologischer Hinsicht. Der Mensch kann sich zu seinen Defiziten und Kompetenzen verhalten. Er kann sich und die Situation, in der er sich befindet auslegen und sich gemäß seiner Auslegung verhalten. Durch die Interpretation seiner Zu- und Umstände gibt er sich selbst die Möglichkeit, sein Leben im Ganzen und seine Lebenskrisen sinnvoll zu erleben. Der Mensch ist zwar das anpassungsfähigste Lebewesen, aber er erschöpft sich nicht in der Anpassung. Selbst die Anpassungsfähigkeit kann der Mensch noch gestalten. Das heißt Kreativität ist mehr als eine psychische Leistung. Diese Tatsache wird nicht nur in der Kunst offenbar und ist dort überzeugend nachvollziehbar, sondern auch in der Therapie. Da Kreativität alle Bereiche des Menschseins umfaßt und bestimmt, kann sie heilend sein. Psychotherapie besteht nicht zuletzt darin, daß der Mensch in einem kreativen Prozeß lernt, sich aus einer neuen Perspektive zu sehen, seine Lebenszusammenhänge einerseits zu erkennen, sie andererseits neu zu bewerten. Das Finden eines neuen Lebensgefühls ist immer auch ein kreativer Prozeß. Vor diesem Hintergrund ist Kreativität auch in der Sozialarbeit immer leitend. Empowerment will den Menschen zu seiner ureigenen Kreativität hinlenken und ihm Möglichkeiten eröffnen, wie er sein kreatives Potential nutzen kann. Wie in der Therapie kann es nicht alleine um eine Anpassungsleistung gehen, unter Umständen ist die Gestaltung der Umwelt vonnöten.
Es war die Psychoanalyse, die durch ihre Untersuchungen über die Psyche von KünstlerInnen zu einem erweiterten Kreativitätsbegriff gefunden hat. 78 D. WINNICOTT nennt Kreativität als Merkmal für psychische Gesundheit, wohingegen "Übergefügigkeit eine krankhafte Basis des Lebens darstellt". 79 Kreativität wurzelt in der Fähigkeit des Menschen, die Realität zu verarbeiten, das heißt z.B. die äußere Welt innerlich abzubilden, Objektrepräsentanzen aufzubauen, sie gehört zum Lebendigsein.
Im psychoanalytischen Kontext ist klar herausgestellt, daß das kreative Verhalten auf die Erfahrungen in der frühen Kindheit (in den ersten sechs Lebensjahren) zurückgeht.
"Es erscheint mir von größter Wichtigkeit, daß fast alle kreativen, gestaltenden Therapieformen an Aktivitäten anknüpfen, die in der frühen Kindheit im günstigsten Falle lustbetont, unbehindert oder entsprechend gefördert vorkommen. Dies ist vom intensiven und emotional getönten Erleben, beim Anspüren von Gegenständen, in der konzentrativen Bewegungstherapie, über das Zeichnen und Malen, (...), das Probieren verschiedener Ausdrucksbewegungen in Pantomime und Psychogymnastik, bis zum Spiel ganzer Szenen im Psychodrama der Fall." 80
Wie viele KreativitätsforscherInnen 81 beschreibt auch V. KAST, die Schweizer Lehranalytikerin, den kreativen Prozeß als ein geordnetes Fortschreiten in Phasen. Sie wendet das Wissen um die Phasen auf die Erkenntnisse im Bezug auf Kriseninterventionen an. Die Bewältigung von Krisen wird zu einem Sonderfall eines schöpferischen Prozesses:
a. Die Vorbereitungsphase: In dieser Phase kommt dem Individuum zu Bewußtsein, daß es über keine bekannten Mittel verfügt, mit denen es ein Problem lösen kann. Es beginnt Ideen, Vermutungen zu sammeln. Diese Phase ist von emotionalen Spannungen begleitet.
b. Die Inkubationsphase: In dieser Phase wird das Problem vom Unbewußten bearbeitet. Die Spannungen können sich bis zur Frustration und Unruhe steigern. Problemlösungen tauchen auf und werden wieder verworfen. Selbstwertkrisen können einsetzen. Kreativität kann sich auch krisenhaft vollziehen. Das Aushalten von Spannungen und Verwirrung erweist sich in diesem Kontext als wesentliche Bedingung für die Lösung der Aufgabe.
c. Die Phase der Einsicht: In dieser Phase taucht eine realistische Lösungsmöglichkeit auf. Das Chaos ordnet sich, der Ansatz muß jedoch noch überprüft werden, ob er für die Lösung der Krise geeignet ist. Dies geschieht in der ...
d. Die Phase der Verifikation: Die in der dritten Phase erlangte Einsicht wird geprüft, getestet und konzipiert. Die Spannung nimmt ab, eine Stärkung des Ichs findet statt. 82
Zwei Faktoren im Bezug auf das Phänomen der Kreativität sollen an dieser Stelle herausgestrichen werden. Erstens die Anpassung ist nur ein mögliches Ziel der Neuorientierung des Menschen, z.B. in der Therapie. Der Mensch verfügt auch über die Möglichkeit sein Umfeld zu verändern. BOAL hat darauf hingewiesen, daß sich Therapie oft an der Erreichung einer Anpassungsleistung erschöpft. Sein Konzept des "Theaters der Unterdrückten" zielt auf Veränderung des gesellschaftlichen Zusammenhangs ab. Empowerment hat diese Perspektive der Veränderung gesellschaftlicher Bedingungen nicht aus den Augen zu verlieren. Zweitens ist Kreativität ein Prozeß, der verschiedene Phasen durchläuft, die auch krisenhaft, konfliktgetragen, aber nicht in jedem Fall harmonisch sind. Dabei bleibt offen, wie das Veränderungsprodukt nach Abschluß des Prozesses gestaltet sein wird: ist es die Veränderung des Individuums oder der gesellschaftlichen Umstände, oder beides? Möglich ist alles. Empowerment weist uns darauf hin, sich alle Möglichkeiten der Veränderung offen zu halten.
Die Theaterarbeit ermöglicht die Konzentration und Organisation aller Kreativitätsmethoden, genauso wie sie die Veränderung der unmittelbaren Umwelt (siehe BOAL) einschließt. Die dramatische Arbeit ist prinzipiell offen, weder im Hinblick auf Methodik, Stoff noch auf Intensität sind Grenzen vorgegeben. Der Bogen an Möglichkeiten reicht vom aristotelischen Abbildungstheater bis hin zum Psychodrama, von der Pantomime bis zum Ballett, vom Gestalten des Bühnenbilds (Modellieren, Malen, Zeichnen, Nähen,... ) bis zum Musizieren, vom Rollen schaffen bis zum Rollen darstellen, u.s.w. Die kreativen Tätigkeiten umfassen Aktivitäten auf der einfachsten handwerklichen Ebene bis hin zu komplexen, übergreifenden, künstlerischen Gestaltungsprozessen. Durch diese Vielfalt an Techniken und kreativen Formen ist die Theaterarbeit eine so offene und vielschichtige Methode, daß es möglich ist, in ein und demselben Prozeß und Produkt die Bedürfnisse und Möglichkeiten von sehr verschiedenen TeilnehmerInnengruppen zu einem gemeinsamen Ganzen zu vereinigen. Aus der Reihe der Projekte, die PRO-95 vorausgegangen sind, weiß ich, daß es möglich ist, auch mit sozial stark desintegrierten, psychotischen, körperbehinderten, süchtigen bis hin zu angepaßten, integrierten Persönlichkeiten sowie Kindern am selben Produkt zu arbeiten. Es ist dies kein Arbeiten, wie es im Psychodrama skizziert ist, da es eklatante Unterschiede hinsichtlich des Reflexionsniveaus gibt. Im Empowerment geht es primär nicht um Reflexion, sondern um die kreative Nutzung des je eigenen Selbstgestaltungspotentials, das heißt um ein gemeinschaftliches Agieren in der Praxis. Die Reflexion erfolgt nur soweit dies überhaupt notwendig ist.
"Aus den vorangegangenen Projekten ist klar geworden, daß Theaterspiel jene Form ist, in der man jede Art von kreativer Tätigkeit optimal einbringen kann: Musik machen, Bewegung, Sprache, Texte schreiben, Malen, Formen, Basteln, Kostüme nähen, u.s.w. Vor allem aber die Koordination aller Tätigkeiten hat uns besonders gereizt. D.h. Zeitmanagement, Krisenmanagement, die Gruppendynamik u.s.w. Ich würde sagen, daß die eigentliche Kreativität von PRO-95 sogar auf dieser Ebene zu finden ist. Nämlich darin, wie wir miteinander umgegangen sind, wie wir mit den eigenen Grenzen und denen der anderen umgegangen sind, wie wir gemeinsam Krisen bewältigen konnten." 83
5.3. Bedingungen für Empowerment mittels Theater
Im folgenden Teil sollen die Bedingungen für Empowermentprozesse im Kontext des Theaterspiels, ausgehend von den Erfahrungen von PRO-95, namhaft gemacht werden. Im Hinblick auf die Erkenntnisse der Kreativitätsforschung gehe ich davon aus, daß es kreativitätsfördernde und hemmende Bedingungen gibt. Verschiedene Forschungsergebnisse zusammenfassend benennt PREISER vier kreativitätsfördernde Faktoren: 84
a. Aktivierung (eine anregende abwechslungsreiche Umgebung, Warm-Up, Selbständigkeit akzeptieren, Frustrationen konstruktiv bewältigen, u.s.w.)
b. Enthemmung (Selbstbewußtsein und Sicherheit fördern, unterdrückte Triebe und Gefühle akzeptieren, Regression unter Kontrolle des Bewußtseins fördern, Leistungsdruck minimieren, Angst abbauen, Streß reduzieren, überkritische Haltung vermeiden, entspannende Atmosphäre erzeugen, u.s.w.)
c. Zielgerichtet motivierende Bedingungen (externe Kontrolle abbauen - interne Attribution aufbauen, Selbstbewertung fördern, experimentieren zulassen, Spannung erzeugen, Feedback geben, strukturieren, an vorhandene Interessen anknüpfen, u.s.w.)
d. Förderung der Unabhängigkeit (Disziplinierungsmaßnahmen möglichst beschränken, Diskriminierung abweichenden Verhaltens vermeiden, Fixierung auf bestimmte Rollen vermeiden, Orientierung an Gleichaltrigen reduzieren, Arbeits- und Interessengruppen bilden, Respekt vor ungewöhnlichen Ideen, demokratisch, kooperative Haltung zeigen, u.s.w.)
PREISER analysiert folgende hemmende und fördernde Gruppeneinflüsse.
"Hemmende Gruppeneinflüsse:
1. Gruppendruck, Konformitätszwang, Normierungstendenz;
2. Hemmungen durch soziale Hierarchien;
3. Aggression, Destruktion, soziale Konflikte (energieabsorbierend);
4. Konzentrationsstörungen durch Ablenkungen; Fördernde Gruppeneinflüsse:
5. gegenseitige Verstärkungen;
6. Stimulierungen und Aktivierungen;
7. vielseitige Personenzusammensetzung;
8. Assoziationsförderung durch gegenseitige Anregungen;
9. Aktivierung durch aufgabenorientierten Wettbewerb zwischen Gruppen;
10. großes Informationsreservoir (Hintergrundspeicher);
11. emotionale Sicherheit, Identifikationsmöglichkeit, Abbau von Hemmungen, Verständnis bei der Bewältigung individueller Probleme;
12. Möglichkeit sozialer Erfahrungen (wichtig für soziale Kreativität, durch Analogiebildung jedoch auch für andersartige Probleme)" 85
5.3.1. Die Institution
a. Fördernde Einstellung Jede Institution manifestiert in ihren Strukturen ein ihr zugrundeliegendes Menschen- bzw. Leitbild. Damit Empowermentprozesse ablaufen können, bedarf es vor allem der Einstellung des Zutrauens in das Potential der KlientInnen und MitarbeiterInnen (aller Beteiligten). Es ist wahrscheinlich schon die Atmosphäre in einer Einrichtung von maßgeblicher Bedeutung, damit Empowermentprozesse und - projekte überhaupt entstehen. Wird ein Projekt grundsätzlich bejaht, so gilt es für alle Beteiligten innerhalb der Institution auch Krisen auszuhalten und bei Engpässen mit Flexibilität zu reagieren.
b. Die Bereitstellung von Ressourcen Infrastruktur, Personal und Materialien sind schon in der Vorbereitungsphase vonnöten. Es muß frühzeitig geklärt werden, in welchem Ausmaß die Mittel (vor allem die finanziellen Mittel) in Anspruch genommen werden können. Die möglichst klare Festsetzung von Grenzen und Erwartungen ist für alle Beteiligten unerläßlich, damit später Frustrationen und Konflikte vermieden werden können. Es empfiehlt sich darüber hinaus, daß alle TrägerInnen des Projekts sich von Zeit zu Zeit zu einem Reflexionsgespräch zusammenfinden, um Störungen oder Abweichungen von der Ausgangssituation klären zu können, das heißt Sorge um den gemeinsamen Informationsfluß.
c. Die Motivation Empowerment zielt auf die Einbeziehung und gegebenenfalls auch auf die Veränderung von sozialen Bedingungen ab. Überzeugungsarbeit nach außen und nach innen ist gleichermaßen zu leisten. Es muß von vornherein klar sein, inwiefern die Institution für das Projekt auch Öffentlichkeitsarbeit mitträgt. Weiters ist Motivationsarbeit im Bezug auf nicht teilnehmende MitarbeiterInnen sowie auf die eigentliche Zielgruppe (KlientInnen) zu organisieren und durchzuführen (Public Relation). Die Motivationsarbeit ist hier so zu verstehen, daß sie Impulse für einen Prozeß setzt, der langfristig zu einem Empowermentprozeß werden soll, der er in dieser ersten Phase aber noch nicht ist.
5.3.2. Das Projektteam
a. Die Einstellung gegenüber den Menschen
Das Menschenbild der Empowermentphilosophie, darauf habe ich eingangs schon hingewiesen, deckt sich in vielen Belangen mit dem Menschenbild der humanistischen Psychologie (ROGERS). Der Mensch ist ein Wesen mit einem nahezu unbegrenzten psychischen und geistigen Potential, an dieses zu glauben ist oberstes Gebot. Die Defizitorientierung muß zugunsten einer Kompetenzorientierung überwunden werden. Die KlientInnen sollen die Möglichkeit bekommen, ihr Abhängigkeitsverhältnis von HelferInnenorganisationen abzubauen.
b. Einstellung gegenüber dem Prozeß
Die MitarbeiterInnen sollten im Auge behalten, daß sie sich in einem erfolgreichen Empowermentprozeß zurückziehen müssen. Das heißt, daß sie einerseits Kontrolle aufgeben und andererseits Kompetenzen delegieren müssen. Sie müssen Vertrauen in den Prozeß aufbringen, der, worauf ich hingewiesen habe, auch von Spannungen und Krisen begleitet sein kann. Besonders in diesen instabilen Prozeßphasen sollten die ProzeßbegleiterInnen Stabilität gewährleisten. Langfristig werden die MitarbeiterInnen, die am Beginn als ImpulsgeberInnen eine wichtige Starthilfe für KlientInnen darstellten, zu einer Beratungsinstanz, die im besten Fall für das Weiterbestehen des Prozesses nicht mehr von Bedeutung ist.
c. Die kritische Haltung gegenüber der eigenen Rolle
Um Empowermentprozesse zu gewährleisten, ist das Festhalten an vorgegebenen, womöglich autoritären Rollenbildern (z.B. LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, Elternteile, etc.) nicht von Vorteil. Im Empowermentprozeß können sich neue Rollenwertigkeiten herausbilden. Auch wenn die SozialarbeiterInnen etwa für den Ablauf und die Organisation eines Projekts wesentliche Verantwortung tragen, so können sie doch auf einer partnerschaftlichen Ebene mit den KlientInnen operieren. Die Relativierung der eigenen Rolle ermöglicht es den SozialarbeiterInnen die Kompetenzen der KlientInnen besser anzuerkennen und ihre durch die Ausbildung bedingte Defizitorientierung besser zu hinterfragen. Es besteht die Gefahr, daß sich das MitarbeiterInnenteam von der Gruppe der TeilnehmerInnen zu sehr abgrenzt. Dies ist nicht im Sinne des Empowermentprozesses. Die Einbeziehung der KlientInnen, die Delegierung von Kompetenzen, Verantwortung, Aufgaben, etc., die Durchlässigkeit innerhalb der Gruppeninstanzen sollte grundsätzlich gegeben sein.
d. Die Bereitschaft
Die MitarbeiterInnen sollen bereit sein, ihre eigene Kreativität einzubringen, sich auf den Prozeß in der Gemeinschaft der Gruppe einzulassen, Grenzen zu überschreiten. Da Prozesse ihre Eigendynamik entwickeln, bedarf es auch einer entsprechenden Flexibilität von seiten der UnterstützerInnen. Dies betrifft z.B. die Zeit- und Energieökonomie der SozialarbeiterInnen. In der Anfangsphase oder in Krisenzeiten muß mehr Energie und Zeit investiert werden als zu anderen Zeitpunkten. Das Festhalten an einem rigiden Stundenplan ist nicht im Sinne eines eigendynamischen Empowermentprozesses.
e. Die Reflexion
In einem komplexen Prozeß, in dem wir persönlich stark gefordert sind, bedarf es einer ständigen Bemühung um Klarheit hinsichtlich der eigenen Rolle, des Zustandes der Gesamtgruppe, der Zielsetzungen des Projekts. Im Bezug auf die eigene Rolle gilt es z.B. zu klären, wieviel Nähe und Distanz in den Beziehungen zu KlientInnen für alle Beteiligten hilfreich und vertretbar ist. Wo ist Abgrenzung angebracht, wo ist sie fehl am Platz? Auf derlei Fragen gibt es keine eindeutigen Antworten - außer dogmatische - sie müssen in jeder Prozeßphase neu gestellt und neu beantwortet werden. Insbesondere von Bedeutung ist im Empowermentprozeß das Bemühen um Klarheit über das Ausmaß der Stützung, das heißt der Interventionsdichte. Diese Frage taucht vor allem im Zusammenhang mit Krisen, Rückfällen, etc. auf. Soll das Projektteam Krisen von Einzelpersonen auffangen oder sollen sie in die Gruppe getragen werden? In diesem Kontext ist auch zu überlegen, inwiefern jede Interventionskette den Empowermentprozeß stützt oder hemmt (siehe PREISER "stützende und hemmende Faktoren")
"Das heißt, Dein Wunsch an ein kommendes Projekt wäre, soweit als möglich die Gruppe entscheiden zu lassen? - Die Gruppe entscheiden zu lassen - soweit es geht - ich meine, man kennt ja die Gruppe. Man weiß aus welchen Verhältnissen und welchem Umfeld die Leute stammen, wieviele Alkoholiker, Junkies oder Behinderte ... da sind. Alles in der Gruppe diskutieren. Und wenn es nicht geht, dann setzt man sich zusammen und sagt o.k., das stört die Gruppe, das ist für ihn nicht gut, etc. Aber wenn irgendein Problem auftaucht, dann sollte man versuchen, das in der Gruppe zu regeln." 86
f. Der Informationsfluß
Das Projektteam ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung des Informationsflusses. Einerseits müssen die MitarbeiterInnen untereinander am Laufenden sein, andererseits gilt es alle am Prozeß beteiligten Personen mit Informationen zu versorgen, bzw. sicher zu stellen, daß die Informationsweitergabe befriedigend von statten geht.
g. Die Grundqualifikationen
Es steht außer Zweifel, daß bestimmte Grundqualifikationen im Team, wie z.B. Administration, Organisation, Außenkontakte, Präsentationstechniken, Gruppenerfahrung, Verhandlungsführung, Buchhaltung, ..., sicherlich nicht von Nachteil sind. Die wichtigste Qualifikation ist und bleibt aber die Bereitschaft zum Lernen.
"Meine Aufgabe in Zwettl sah ich dann auch mehr im 'Betreuen', was ich wahrscheinlich schon mein Leben lang mache, mit mehr oder weniger Erfolg. Aus so einer Rolle kommt man (leider) nur schlecht raus. Außerdem empfand ich es auch als meine Aufgabe und Pflicht. 'Zwettl ist kein Urlaub' und schon gar nicht für uns als Team, hab ich mir gedacht. (...) So sind viele Dinge offen geblieben, die wirklich erst nach Zwettl geklärt werden konnten." 87
5.3.3. Die Gruppe
a. Die Bereitschaft zur Teilnahme an einem Prozeß
In der Gruppe muß Übereinstimmung darüber bestehen, daß gemeinschaftlich an der Formulierung und Erreichung von Zielen gearbeitet werden soll (Gruppenkohärenz). Dies schließt die Mitgestaltung, die Reflexion des Prozesses und die Krisenbewältigung mit ein.
b. Die Bereitschaft zur Schaffung eines "geschützten Rahmens"
Ein positives, lebensbejahendes Gruppenklima sollte allen Beteiligten ein Anliegen sein. Nur in einem entspannten Umfeld kann Kreativität wirklich stattfinden, nur in einer geeigneten Umwelt können wir aus uns herausgehen und in neuen Rollen experimentieren.
c. Die Bereitschaft sich als Gruppe nach außen zu präsentieren
Jedes Gruppenmitglied sollte ansatzweise im Stande sein, Einzelbedürfnisse zugunsten des Gruppenideals zurückzustellen. Es sollte z.B. nicht der Fall sein, daß einzelne DarstellerInnen andere 'an die Wand spielen'.
d. Die Bereitschaft zur Akzeptanz von gewachsenen Strukturen
Im Falle von PRO-95 war das Projektteam aus den vorhergegangenen Aktivitäten entstanden und hatte die Verantwortung für die Organisation übernommen. Diese gewachsene Struktur mußte von den TeilnehmerInnen akzeptiert werden. Grundsätzlich ist aber anzumerken, daß in offenen Empowermentprozessen auch die vorgegebenen Strukturen veränderbar sind.
e. Die Bereitschaft zur Akzeptanz
Optimal verläuft ein kreativer Prozeß dann, wenn Freund-Feind-Gegensätze vermieden werden. Die Gruppe sollte einen vernünftigen Modus finden, einerseits KritikerInnen (von außen oder von innen) in die Projektarbeit zu integrieren und andererseits mit Außenseitern in der Gruppe respektvoll umzugehen. Auf diese Weise wird das Potential aller am Prozeß Interessierten und Anteilnehmenden genutzt.
5.3.4. Das Individuum
a. Die Bereitschaft sich in die Gruppe zu integrieren
Die Einzelnen sollten fähig sein, die Gruppe als Wert anzuerkennen und ihre Kreativität, je nach ihren Fähigkeiten, Zeit, Energien, etc. bereitzustellen. Zur Erreichung der Gruppenkohärenz und der für den Kreativitätsprozeß erforderlichen positiven Atmosphäre, ist ein Minimum an Beziehungs-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit unerläßlich.
b. Die Offenheit für den Prozeß
Ein Minimum an Frustrationstoleranz und Fähigkeit unerwartete Begebenheiten auszuhalten sollte dem Individuum eigen sein.
c. Die Bereitschaft mit Zeit, Geld und Energie (Interesse) am Prozeß zu partizipieren
6. Praxisteil
6.1. Was war PRO-95?
Eine Beschreibung von PRO-95 ist, ohne einen Rückblick in die Geschichte der Projekte des Vinzenzhauses der Caritas zu machen, nicht möglich. PRO-95 ist ein sehr wichtiges Glied in einer Kette von Kreativprojekten mit den Klienten und "Umfeldpersonen" 88 des Vinzenzhauses. Die Projekte des Kreativteams sind mit den Personen, die das Team bilden, und deren KlientInnen gewachsen, sowohl in der Themenstellung, dem Aufbau, der Komplexität, den Anforderungen an die Gruppe und das Team und dem Ziel. Nachstehend gebe ich einen kurzen, zeitlichen Abriß der Stufen unserer Entwicklung, die auch für einen stetigen Empowermentprozeß des Teams stehen:
|
Einkehrwochenende im Stift Zwettl 10. - 12. 4. 1992 |
| Tanznachmittag 28.5.1992 |
| Kreativwochenende im Bildungshaus Frauenberg 28. - 30. 8. 1992 (Motto: "Das Leben ist ein Lied - Der verlorene Sohn") |
| Meditative Tänze im Advent 8. 12. 1992 |
| Kreativtage Schottwien 29. 4. - 2. 5. 1993 (Motto: Vom Menschwerden und Menschsein) |
| Workshop 11. 12. 1993 |
| Kreativtage Oberleis 6. 1. - 9. 1. 1994 (mit dramatischem Schwerpunkt) |
| "Einfach so" 12. 2. 1994 (Clownerien nach Oberleis, aufgeführt beim Faschingsfest im Vinzenzhaus) |
| PRO-95 4.-13.8.1995 Kreativtage Stift Zwettl |
| "So ein Theater" 19.8.1995 und 20.10.96 (Theateraufführung im Vinzenzhaus im Rahmen von PRO-95) |
Diese Liste zeigt eine Entwicklung vom religiösen Thema der Einkehr hin zum Alltagstheater mit Themenschwerpunkt Alkohol, Obdachlosigkeit, Sozialarbeit, Gesellschaftsmechanismen und Märchen- Singspiel auf. Das derzeitige Kreativteam formierte sich anläßlich des Wochenendes in Frauenberg (vgl. Pkt. 6.1.2.).
PRO-95 sollte einen Rahmen schaffen für Begegnungen - außerhalb des Alltags im Übergangswohnheim -, Beziehungen, Grenzen erkennen und akzeptieren, die eigenen Grenzen zu überwinden und neue Verhaltensmuster zu erarbeiten, Kreativität zu fördern, gemeinsames Arbeiten, Organisationstraining, Kommunikation, Konfliktbewältigung und diente klar der Erreichung eines Ziels. PRO-95 war somit produktorientiert, ließ aber die Prozesse des Individuums und der Gruppe nicht außer acht.
"Das Leben hat halt Grenzen und mit diesen Grenzen kreativ fertig zu werden - oder viel mehr einander zuzutrauen mit Grenzen fertig zu werden, daß ist charakteristisch für Empowermentprozesse. Der Prozeß von PRO-95 hat auch - in Zwettl - den Punkt erreicht, wo uns allen klar war, daß wir es schaffen würden. Am Mittwoch war einfach allen klar, daß "So ein Theater" fertig werden würde, egal was noch passieren würde. Ich würde sagen, daß die Produktorientierung die Prozesse geradezu konzentriert hat, d.h. daß sie ein wesentliches Element des Empowermentprozesses war." 89
Die organisatorische Vorbereitungsarbeit für die Projektwoche, die im Bildungshaus Stift Zwettl abgehalten wurde, nahm über ein Jahr in Anspruch. Schwerpunkt in dieser Zeit war die Bereitstellung der nötigen Finanzmittel und in späterer Folge TeilnehmerInnenwerbung, Administration, Zeitraster, Transportfragen und die Koordination mit den Gruppenmitgliedern.
Die Aufgabestellung von PRO-95 war, innerhalb von neun Projekttagen, ohne Vorgaben, eine Theaterproduktion zu erarbeiten. Dies beinhaltete das Kennenlernen der einzelnen Gruppenmitglieder, die Themenfindung, den Aufbau einer Rahmenhandlung, die szenische Ausarbeitung mit den DarstellerInnen - was auch die Rollenfindung für die/den Einzelnen beinhaltete -, das Nähen von Kostümen, die Bühnengestaltung, die Erarbeitung der musikalischen Begleitung, die Ton- und Lichttechnik, u.s.w.
Eine Woche nach der Rückkehr aus Zwettl fand die Uraufführung im Speisesaal des Vinzenzhauses, "vor ausverkauftem Haus" statt. Aufgrund der großen Motivation der Gruppe sowie der Aufforderung einer interessierten Pfarrgemeinde wurde "So ein Theater" am 20.1.1996 (ca. ein halbes Jahr nach der Uraufführung) am Kordon (Wien 14) ein weiteres Mal aufgeführt.
Die Anforderungen an die KlientInnen waren hoch. Pünktlichkeit, Akzeptanz, Wertschätzung, Konsequenz, Konsensbereitschaft, Kritikfähigkeit, Kontinuität und Pflichtbewußtsein begleitet von der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit (ein großer Teil der Klienten des Vinzenzhauses sind Alkoholiker) stellten für einige eine nicht unbeträchtliche Hürde dar, die vorerst alle bewältigten. Für die zweite Aufführung des Stückes mußten einige Umbesetzungen unternommen werden, die "So ein Theater" zu einem neuerlichen kleinen Projekt machten und eine weitere Anforderung für die ursprünglichen TeilnehmerInnen darstellte. Das heißt, daß in der Folge nicht nur Flexibilität innerhalb der Dialoge notwendig war, sondern auch in kurzer Zeit (zwei Abendproben) der Umgang mit neuen DarstellerInnen und veränderten Szenen bewältigt werden mußte. Das Team stand beratend zur Seite, achtete auf die Einhaltung der Rahmenbedingungen (Essenszeiten, Arbeitsbesprechung, Reflexionsrunde, Alkoholregelung, ...), stellte die notwendigen Materialien zur Verfügung, beriet bei technischen Schwierigkeiten (z.B. die Handhabung einer Nähmaschine), stand für Einzelgespräche zur Verfügung und hatte die Aufgabe die Reflexionsrunden klar von den Arbeitsbesprechungen zu trennen. Das heißt, daß organisatorische, inhaltliche, technische Schwierigkeiten und das weitere Vorgehen am Produkt in der morgendlichen Besprechung der Großgruppe geklärt wurden und Konflikte, Schwierigkeiten, Niederlagen, aber auch individuelle und gemeinsame Erfolge und Fortschritte genügend Platz in den Reflexionseinheiten am Abend hatten. Mit dem fortschreitenden Arbeitsprozeß oblag es dem Team auch auf den gesunden Umgang mit der "Arbeit" zu achten und einzelne TeilnehmerInnen dazu zu animieren Pausen einzulegen, zu trinken, u.s.w.
6.1.1. Die Grundlagen
Die Grundlagen für PRO-95 waren unsere gemeinsame Geschichte als Team (vgl. Pkt. 6.1.2.), die Unterstützung des Vinzenzhauses und der Caritas Wien, der Wunsch der KlientInnen, wieder aktiv zu werden und ein weiteres Kreativprojekt zu machen und die Unterstützung der Pfarre Ober St. Veit, die uns immer wieder unter die Arme griff.
Weiters ist PRO-95 der logische Schluß einer langen Reihe von Projekten im Rahmen des Vinzenzhauses, den wir allerdings nicht leichten Herzens gesetzt haben, wie man vielleicht aufgrund der fröhlichen Projektbeschreibung annehmen könnte.
Ein weiterer Grundpfeiler des Projekts war mein Eintritt in die Akademie für Sozialarbeit und mein damit zusammenhängendes verstärktes Interesse an Sozialprojekten bzw. meinen geänderten Blickwinkel auf unser Tun. Ich drängte demnach sehr darauf PRO-95 durchzuführen.
Die Beschäftigung unsererseits mit Themen wie dem "Theater der Unterdrückten" von A. BOAL oder dem Alkoholismus bzw. der Sucht als solches, sowie ansatzweise mit dem Psychodrama ließ uns die theoretische Grundlage für PRO-95 finden und - zusammen mit unseren Erfahrungen - zu einem gemeinsamen "Neuen" verarbeiten.
6.1.2. Die Geschichte eines Teams
PRO-95 war nicht das erste Theaterprojekt im Vinzenzhaus der Caritas. Wie schon von C. COLLOREDO-MANNSFELD beschrieben, wurde in diesem Übergangswohnheim für obdachlose Männer im Jahr 1991 eine Produktion mit dem Titel "Jeder für sich selbst" von den Heimbewohnern gemacht. Auch damals handelte es sich um ein selbst geschriebenes Stück, welches aber fixe Dialoge und eine strikte Struktur, gleich einem professionellen Theaterspiel, aufwies. Die Hauptinitiatoren und ein Betreuer bildeten den Grundstock des noch heute bestehenden Kreativteams.
Wie schon früher angeführt (vgl. Pkt. 6.1.), folgten diesem Theaterstück viele Projekte, und das Team erweiterte sich innerhalb eines Jahres um eine Sozialpädagogin, mich selbst sowie KlientInnen, die punktuell pro Phase mitarbeiteten, je nach Eigeninteresse.
Jedes der Kreativprojekte war ein großer Entwicklungsschritt für uns als Team. Frauenberg, bei dem ich vorerst als Chauffeuse dazustieß, barg die ersten szenischen Aufarbeitungen ohne Theaterkonzept. Wir erarbeiteten in Kleingruppen und in Szenen geteilt die Geschichte des verlorenen Sohnes. Dialoge gab es damals noch keine, die Arbeit war in ein durchstrukturiertes Programm von Gruppenspielen, Tanz, Malen, etc. eingebettet. Die Thematik des Projekts war noch klar religiös orientiert.
Im Gegensatz dazu stand sicherlich das Wochenende in Schottwien, wo wir einen sehr engen Fahrplan für die Einheiten mit philosophischem Grundthema erarbeiteten. Für mich persönlich war Schottwien das körperlich und psychisch anstrengendste Projekt unseres Teams. Wir waren mit einer Gruppe von 30 Erwachsenen (inkl. uns) und zwei Kleinkindern konfrontiert. Die tägliche Küchenorganisation tat das ihrige dazu, die vier Tage zum Kraftakt werden zu lassen - wir waren SelbstversorgerInnen und Küchendienst zu haben ist im Vinzenzhaus etwas Besonderes, was auch Einfluß auf die Hoheitsverhältnisse im Projekt hatte. Nicht nur die organisatorischen Schwierigkeiten - wir hatten überdies höchst aktive Alkoholiker in der Gruppe - machten Schottwien zum Meilenstein in unserer gemeinsamen Geschichte. In der Vorbereitungsphase lernten wir die gute Kooperation im Team und die Gewißheit sich aufeinander uneingeschränkt verlassen zu können. "Vom Mensch werden zum Mensch sein" beinhaltete unser erstes Experiment mit der "freien Kreativität". Das heißt, wir bildeten Zweiergruppen mittels eines Spiels und stellten die Aufgabe, daß jedes Paar drei Stunden Zeit hätte, um "etwas zu machen", das nach dem Abendessen vor der Großgruppe zu präsentieren wäre. Ungeahnte Talente kamen an diesem Nachmittag ans Licht: T-Shirts wurden bemalt, Lieder komponiert und getextet, Lieder interpretiert, Bilder gemalt, Gedichte geschrieben, ein Spiel erfunden, eine Pantomime zu Musik gemacht und ein Kabarett erarbeitet. Das gab uns die Gewißheit, daß Freiraum, innerhalb eines vorgegebenen Rahmens, die Kreativität unserer KlientInnen fördert und sie motiviert.
Aus der Analyse von Schottwien entstand unser nächstes Projekt in Oberleis. Wiederum waren wir SelbstversorgerInnen, wiederum hatten wir damit die größten Organisations- und Kompetenzschwierigkeiten. Die Großgruppe (nicht mehr als 25) teilte sich schon am ersten Abend in zwei kleinere. Aufgabe war es diesmal eine Musikvorgabe (drei Musikstücke standen zur Auswahl) innerhalb von drei Tagen szenisch umzusetzen. Eine Gruppe brachte einen Bauernschwank von ca. 20 Minuten zur Aufführung, die zweite Gruppe begann an einer pantomimischen Szenenabfolge zu arbeiten, scheiterte aber vorerst an den unterschiedlichen Meinungen, wie dies zu geschehen hätte. Die Szenen wurden nach Oberleis für das Faschingsfest im Vinzenzhaus weiterbearbeitet und in Wien aufgeführt.
Nach diesem wichtigen Schritt in unserer gemeinsamen, zugegebenermaßen sehr experimentell ausgerichteten Entwicklung, stellte sich für uns die Frage, ob wir weitermachen wollten. Wir waren unsicher, was nach Oberleis noch kommen könnte. Noch im Frühjahr definierten wir den nächsten Schritt, der nur eine große, richtige Produktion sein konnte. Wir hielten das für den logischen Schlußpunkt unserer gemeinsamen Geschichte. Nur im Theaterstück konnte die Entwicklung enden. Wir waren uns lange Zeit nicht sicher, daß wir diesen Schritt setzen wollten. Erst im August 1994 - kurz vor meinem Eintritt in die Akademie für Sozialarbeit - organisierten wir ein Teamwochenende in Haselbach, wo wir entschieden, daß wir diesen Weg gemeinsam gehen wollten. Unsere Ängste waren groß, schien PRO-95 doch ein Megaprojekt zu werden, dessen Dimensionen wir nicht einschätzen konnten. Wir wußten allerdings, daß es für uns von großer Bedeutung sein würde.
Im September 1994 begannen die vorerst monatlichen Teamsitzungen, wo wir detailliert das Konzept und die Geldansuchen ausarbeiteten. Wir organisierten im Laufe der Zeit zwei Benefizkonzerte in der Pfarre Ober St. Veit, welche Flugzettelverteilaktionen und nächtliches Plakatieren notwendig machten, und unser Hauptamtlicher (Caritasmitarbeiter) übernahm in mehreren dem Vinzenzhaus nahestehenden Pfarren Predigten für die Pfarrer. Wir erhielten die Kollekte oder durften am Ende des Gottesdienstes sammeln. Bei allen Aktionen wurden KlientInnen bereits eingebunden, die großen Spaß daran hatten.
Bevor wir nach Zwettl fuhren, hielten wir noch im Juni 1995 eine TeilnehmerInnensitzung im Vinzenzhaus ab, um alle organisatorischen Punkte, wie z.B. wer mit wem und wann mitfährt, wer die Tonanlage, etc. mitnehmen kann, u.s.w. abzuklären. Für PRO-95 war von Anfang an klar, daß wir ausschließlich Vollpension ins Auge fassen würden. Wir hatten gelernt, daß die Variante "SelbstversorgerInnen" nicht billiger ist als manches Bildungshaus mit Verpflegung und daß wir uns andererseits eine Menge Energien für andere Dinge aufsparen konnten, die wir sonst in die Konfliktregelung mit den Küchenchefs gesteckt hatten.
PRO-95 war im organisatorischen Rahmen klar strukturiert und strikt durchgeplant, inhaltliche und arbeitstechnische Vorgaben gab es andererseits keine.
Ein zentrales Thema in der Vorbereitungsphase war immer unsere Unsicherheit und Nervosität, die besonders beim Thema Finanzen auftrat. Primär war uns klar, daß dieses Projekt all unser Wissen, unsere Fähigkeiten, unsere gegenseitige Stützungsfähigkeit und unsere Risikobereitschaft erfordern würde. Es war für uns immer mit einem sehr hohen Berg vergleichbar, der uns Angst machte, uns aber gleichzeitig immer wieder anspornte, den Gipfel zu erreichen. Die Motivation, aus PRO-95 unser "Lebensprojekt" entstehen zu lassen, war im Team und bei den KlientInnen hoch. Gleichzeitig war uns damals klar, daß nach diesem Vorhaben kein anderes mehr folgen könnte. Mit etwas Wehmut betrachteten wir daher das Gedeihen unserer Bemühungen.
Unser Hauptamtlicher war am Ende des Projekts sicher, daß er bald in den LehrerInnenstand wechseln würde, so sahen wir dem Ende unseres Teams entgegen. Nach gut eineinhalb Jahren PRO-95 und zwei Aufführungen von "So ein Theater" waren wir müde, ausgelaugt und einige schienen ihrer Wege zu gehen. So stand ich am Projektende kurz vor meiner Abreise nach Spanien, um dort mein Langzeitpraktikum zu absolvieren, Christian wollte kündigen und meinte, daß ein weiteres Projekt für ihn nicht mehr in Frage käme, Wolfgang hatte seine Gemeindewohnung bekommen und war dem Team abhanden gekommen und Claudia und Alfons hatten schwere Zeiten mit ihrem Sohn zu durchleben. Birgit wollte zumindest mit uns gemeinsam Wochenendurlaube machen und Franz war der einzig wirklich weiterhin Motivierte.
Birgit setzte sich sehr leicht mit ihrem Wunsch auf ein gemeinsames Sommerwochenende durch. Als ich von Spanien zurückkehrte, fuhren wir mit einigen KlientInnen nach Salzburg auf eine Alm, wo klar wurde, daß wir auch weiterhin ein Team bleiben würden. Christian ist mittlerweile Pastoralassistent für die Obdachlosenhäuser der Caritas und betreut noch Klienten im Vinzenzhaus, Claudia und Alfons führen ihren Sohn Markus schon in die Gruppengepflogenheiten ein, Birgit und ihre Tochter Sarah sind glücklich über den Zusammenhalt und die weiteren, stressigen aber schönen Aktivitäten, Franz hat nichts von seiner Motivation verloren und auch ich freue mich bereits auf den Start unseres neuen Langzeitprojekts "K.a.W.".
"K.a.W." wird noch dieses Frühjahr als Verein zur kreativen Empowermentarbeit mit Randgruppen gegründet werden. Wir planen vorerst monatliche Kreativnachmittage zu veranstalten, die in jede erdenkliche Richtung kreativer Arbeit gehen können.
Das Team komplettieren mittlerweile zwei Klienten des Vinzenzhauses. Empowermentprozesse erfordern auch hier Geduld und Verständnis von seiten der restlichen Gruppe. Oft verzetteln wir uns in lange Diskussionen aufgrund von unterschiedlicher Terminologie oder vorerst zu komplexer Zusammenhänge, die wir zwar aufgrund unserer langjährigen gemeinsamen Arbeit problemlos verstehen, die wir unseren beiden neuen Teammitgliedern allerdings erklären sollten. Wir befinden uns auch hier in einem Empowermentprozeß, weil wir lernen müssen uns einfach auszudrücken und jede Einzelheit zu erklären. Wir werden es sicherlich schaffen, auch damit umgehen zu lernen.
Einen Grundsatz haben wir als "Rumpfteam" (PRO-95) in diesen vielen Jahren erstellt: Wir würden solche Projekte niemals ohne einander machen!
6.1.3. Das Konzept
Heute erscheint das Konzept von PRO-95 einfach. Wir haben es hinter uns gebracht und es hat funktioniert.
Die Zielsetzung des Projekts war - wie bereits mehrfach erwähnt - vordergründig das Produkt "So ein Theater". Für uns als Team - und für jedeN die/der es sonst noch lesen wollte, haben wir weitere sozial- pädagogische Parameter definiert. PRO-95 war auf folgende Lerninhalte ausgerichtet:
- Gruppenarbeit
- Kooperation im täglichen Arbeitsprozeß
- Pünktlichkeit
- Verläßlichkeit
- Verantwortung übernehmen
- Entscheidungsfindung in der Gruppe und individuell für sich
- Grenzen erkennen
- neue oder bereits verschüttet geglaubte Kompetenzen erlernen bzw. einsetzen
- Stärkung des Selbstvertrauens durch das Erkennen und Erleben der eigenen Fähigkeiten
- Umgang mit Rückschlägen
- Umgang mit der eigenen Rolle und die der anderen
- Copingstrategien entwickeln durch das Spiel einer Rolle und die Stütze der Gruppe
- Spaß haben gemeinsam und auch alleine
- Training des Durchhaltevermögens - Beziehungsarbeit
- Abwechslung vom Alltag
- Erkennen der eigenen Wichtigkeit in einem Prozeß und zum Gelingen eines Produktes
Wir wollten den Rahmen für all diese Dinge schaffen und den KlientInnen Raum für Experimente bieten. Ich bin der Meinung, daß wir unser Ziel erreicht haben, was die Rückmeldungen der KlientInnen, die wir noch immer bekommen, bestätigen.
6.1.4. Die Finanzierung
Ausgehend von den Erfahrungen der vergangenen Projekte kalkulierten wir für PRO-95 ein notwendiges Budget von öS 94.000,-- für 25 TeilnehmerInnen. Obwohl wir zum damaligen Zeitpunkt keinerlei Erfahrung in der Vorbudgetierung von Projekten hatten, stellte sich diese Summe als äußerst realistisch heraus.
Von der Heimleitung des Vinzenzhauses war uns schon bei den ersten Vorgesprächen zu einem möglichen weiteren Projekt die Bereitschaft zur Übernahme eines Teiles der Kosten signalisiert worden. Die Budgetverhandlung diente zur Fixierung des Betrages.
Wir gingen ursprünglich von einer annähernden Kostendrittelung aus. Das heißt ein Drittel sollten die TeilnehmerInnen selbst übernehmen, ein Drittel das Haus und ein Drittel wollten wir über andere GeldgeberInnen finanzieren. Das Haus erklärte sich bereit öS 1.000,-- pro Person zu übernehmen. Der Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen für neun Tage Unterbringung, Vollpension und Fahrtkosten sollte ebenfalls öS 1.000,-betragen. Ausgehend von einer TeilnehmerInnenanzahl von 25 Personen hatten wir öS 50.000,-- gedeckt.
Der frei zu finanzierende Anteil (schließendlich rund die Hälfte der angesetzten Kosten) von öS 44.000,-- stellte also das Ziel unserer Vorarbeiten zur Projektwoche dar. Unsere wirtschaftliche Kreativität trug nach und nach Früchte. Folgende Aktionen wurden von uns zur Spendensammlung gesetzt:
a. Benefizkonzert
Der Pfarrsaal bzw. die Kapelle der Pfarre Ober St. Veit stellte für uns einen guten und kostenfreien Rahmen für unsere Benefizkonzerte dar. Ursprünglich wollten wir nur ein Konzert veranstalten, das eine befreundete und begnadete Pianistin, Brigitta Neidl, für uns spielte. Wir waren bis auf den letzten Platz besetzt, das Buffet wurde gut angenommen und das Spendenaufkommen überstieg öS 6.550,-- für diesen Abend.
Danach meldete sich ein Duo, Gitarre und Querflöte, bei uns. Der Gitarrist war ehrenamtlicher Helfer im Vinzenzhaus und stand vor einer Auftrittsreihe. Sie wollten ihr Programm im "Feld" erproben. Das Konzert war weniger gut besucht, trotzdem erzielten wir öS 2.430,-- an Spenden.
Zwischen der ersten und der zweiten Aufführung von "So ein Theater" organisierten wir auf Anfrage von Brigitta Neidl ein weiteres Konzert, diesmal Klavier, Klarinette und Cello. Die Einnahmen beliefen sich auf rd. öS 5.000,-- und kamen der Ausstattung der zweiten Aufführung zugute.
b. Predigten
Aus dem Wissen heraus, daß Pfarrer manches Mal froh darüber sind, wenn die Predigt für sie übernommen wird, haben wir befreundete Pfarren kontaktiert. Am Kordon und in Baden kamen zwei Predigten zustande. Am Kordon erhielten wir die sonntägliche Kollekte und in Baden sammelten wir nach Ende der Messe an den Ausgängen. Gesamt kamen wir auch hier auf ca. öS 13.500,--.
c. Förderungen
Diese Form ist wohl die offiziellste und üblichste, um ein Projekt zu finanzieren. Gemeinsam mit unserem Konzept stellten wir an mehrere Stellen Geldansuchen. Die Stadt Wien förderte uns letztendlich mit öS 10.000,-- und aus dem Jugendprojektfond der Gewerkschaft der Privatangestellten erhielten wir ebenfalls öS 10.000,--.
Weiters erhielten wir in Summe öS 7.000,-- von der Studienrichtungsvertretung der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, dem Kloster Baumgartenberg und einer befreundeten Theatergruppe.
Nachstehend füge ich die genaue Kostenaufstellung aus dem Projektbericht PRO-95 ein:
AUSGABEN
| Aufenthaltskosten |
53.320,-- |
| Postgebühren |
604,-- |
| Transportkosten |
2.431,-- |
| Dekorationsmaterial(Papier, etc.) |
5.128,-- |
| Stoffe (Kostüme, Kulissen) |
2.916,-- |
| Filmmaterial (Foto, Video) |
3.115,10 |
| Getränke |
1.933,-- |
| Lichtanlage |
700,-- |
| Bankspesen |
288,-- |
| SUMME der Ausgaben bis 30.9.1995 |
70.525,10 |
| Voraussichtliche Ausgaben Enddokumentation |
4.000,-- |
| Voraussichtliche Endsumme der AUSGABEN |
74.525,10 |
6.1.5. Die TeilnehmerInnen
Statt 25 Personen fuhren letztendlich nur 20 - inklusive des Teams - mit nach Zwettl. Die Gründe dafür sind vielfältig: Der Termin lag mitten in der Ferienzeit, was für einige InteressentInnen ein Urlaubsproblem im Betrieb darstellte. Theaterspielen stellte für einige eine unüberwindliche Hürde dar, sie wollten sich dem Publikum nicht aussetzen. Vereinzelt kam es vor der Abfahrt nach Zwettl zu Alkoholrückfällen, familiären Problemen, u.s.w.
Die Gruppe der TeilnehmerInnen an der Projektwoche im Stift Zwettl setzte sich wie folgt zusammen:
15 TeilnehmerInnen
davon
2 Frauen :
1 StudentIn des Propädeutikums,
1 MeßvorbereitungsteilnehmerIn (= erweitererter KlientInnenkreis des Vinzenzhauses)
12 Männer:
3 Hausbewohner,
5 Meßvorbereitungsteilnehmer,
3 Prekariumswohnungsklienten,
1 Körperbehinderter Klient der Lebenshilfe Baden
1 Kind
5 Teammitglieder
davon
2 Frauen:
1 Sozialpädagogin,
1 Praktikantin d. Sozialarbeit
3 Männer:
1 hauptamtlicher Betreuer,
1 ehemaliger Klient,
1 Klient (Prekariumswohnung)
Die Probleme, die während der Projektwoche auftraten, waren vor allem der Alkoholkonsum und die zwischenmenschlichen Konflikte. Auch die extreme Intensität der Projektwoche machte einigen zu schaffen, das betraf auch Teammitglieder.
Die meisten Konflikte konnten wir im Laufe der Woche in den Reflexionsrunden oder in Einzelgesprächen bereinigen. Den latenten Alkoholkonsum Ossis konnten wir vorerst nicht unterbinden, weil wir zwar einerseits die Alkoholregelung des Vinzenzhauses (AlkoholikerInnen = 0,0 Promille) immer auf unsere Projekte "mitnehmen", andererseits eine restriktive Lösung des Problems, wie z.B. das Heimschicken, für uns keine tatsächliche Möglichkeit darstellte. Weder Ossi noch wir hätten uns bei der Wahl dieser Lösung mit dem Grundproblem auseinandergesetzt, sondern es nur einfach aus unserer "kleinen Welt des Projekts" geschafft.
Besonders Ossis Alkoholkonsum stellte für einige andere Alkoholiker ein großes Problem dar. Sie waren permanent mit einem alkoholisierten Menschen und dessen Ausdünstungen konfrontiert, was bei Wolfgang S. sofort zu einem Rückfall führte. Wolfgang erholte sich nach einem Tag von seinem Tief und integrierte sich daraufhin vorbildlich in die Gruppe. Mit dem Malen der Dekoration hatte er seine Aufgabe gefunden, die ihn voll in Anspruch nahm. Die Gruppe konnte ihn auch noch für die Übernahme einer kleineren Rolle gewinnen, was ihm zwar körperliche Schwierigkeiten bereitete (das Malen auf dem Boden übrigens auch), mit der ihm aber ein Glanzstück gelang.
Ossi mußten wir allerdings ins Team rufen und mit ihm über seine Rolle in der Gruppe sprechen. Nachdem wir nicht annahmen, daß er daraufhin mit dem Trinken aufhören würde, gaben wir ihm eine Packung Kaugummi und die Auflage sich täglich zu duschen.
Nachdem Ludwig beim Proben der Hauptrolle an seine Grenzen gestoßen war und am Mittwoch die Gruppe zu einer mittäglichen Sondersitzung zusammenrief, standen wir vor dem Problem, einen neuen Hauptdarsteller suchen zu müssen. Ludwig war die Entscheidung zurückzutreten nicht leicht gefallen, weil er sich der Gruppe und dem Vertrauen, das diese in ihn gesetzt hatte, verpflichtet fühlte.
"Ich habe mich ganz einfach gehen lassen, bin auch (...) an einigen Sachen gescheitert, das war ein Kampf. (...) Ich habe dann vor der Theatergruppe deklarieren müssen, daß ich diese Hauptrolle nicht spielen kann. Warum, das weiß ich bis heute eigentlich nicht ganz. Ich habe viel darüber nachgedacht und habe auch mit vielen Leuten darüber geredet, und es war für mich wirklich schwer die Hauptrolle abzugeben." 91
In der Gruppendiskussion entschieden wir, daß Ossi ein guter Hauptdarsteller wäre. Dies stellte sich als vorzügliche Lösung für das "Alkoholproblem Ossi" dar. Aufgrund der Auslastung, die die Probenarbeit für ihn mit sich brachte, verschwand er kaum mehr ins angrenzende Wirtshaus, sondern investierte alle Energien in die Aufgabe. Ossi wurde zum viel gefeierten Hauptdarsteller, der dem Stück wirklich Herz verlieh.
Pauline fand sich bereit die Rolle der Sozialarbeitersgattin zu übernehmen, was sie vollauf auslastete. Allerdings war sie auch die einzige Schneiderin in diesem Projekt und fühlte sich dazu verpflichtet nebenbei die Kostüme zu nähen. Das hatte zur Folge, daß wir laufend darauf achten mußten, daß sie genügend aß, trank und Pausen machte. Manchmal mußten wir sie zum Ausspannen - sanft aber doch - zwingen.
Sylvia brachte besondere Spannung in die Gruppe. Sie hatte hohe dramaturgische Ansprüche, die - wie man sich denken kann - nicht leicht zu befriedigen waren. Ihre Position brachte nicht nur Konflikte in die Arbeitsgruppe, sondern wirkte sich auch auf die Großgruppe und das Team aus. Wir mußten lernen zu akzeptieren, was für manche von uns ein schwerer Lernprozeß war, so auch für mich.
"Da war Aufregung über den Wahnwitz PRO-95, Freude über die Finanzentwicklung, Lust an der Öffentlichkeitsarbeit, Euphorie über die Besucherzahlen, Stolz auf das Geschaffene, aber auch Verärgerung über unbeantwortete Schreiben, Erschöpfung aufgrund von nächtelangen Arbeitsaktionen, Neid auf die Unbeschwertheit der TeilnehmerInnen, Angst vor unbewältigbaren Krisen, Frust nahe am temporären Burn-Out und Kampf mit der eigenen Rolle. (...) Ich habe gelernt, meinen produktbezogenen Dickschädel zu zähmen und mich in der Rolle der Teamerin zurechtzufinden. Ich habe gelernt, daß ich nicht perfekt sein muß, um akzeptiert zu werden, ganz im Gegenteil, daß persönlicher Perfektionismus eine sehr subjektive Angelegenheit ist, die in einer Gruppe nur bedingt erfolgreich ist." 92
Reinhards Körperbehinderung wiederum sorgte teilweise für ein fürsorgliches Klima unter den TeilnehmerInnen. Bis auf Birgit, die Reinhard auch in der Lebenshilfe betreute, hatten alle Mitglieder der Gruppe Angst falsch auf Reinhard und seine Geh-, Sprech- und leichte geistige Behinderung zu reagieren. Allen schlechten Vorahnungen zum Trotz integrierte er sich gut in die Gruppe und spielte die Rolle des königlichen Beraters gut, nachdem wir uns alle gemeinsam ein System ausgedacht hatten, wie Reinhard seine Schummelzettel für den Text auf der Bühne behalten könnte.
Als charismatischer Regisseur entpuppte sich Ernst, der den Taktstock schwingend vom erhöhten Platz auf dem Sekretär des Probenraumes lautstark seine Regieanweisungen verkündete. Trotz kleineren Meinungsverschiedenheiten ordneten sich alle SchauspielerInnen seiner Führung unter. Auch Wolfgang - unser Ton-Mann - widersprach Ernst kaum, was einen starken Eindruck bei uns als Team hinterließ. Wolfgang war bisher bei jedem Wochenende dabei und hielt sich durchwegs an das Motto "Laut, falsch und mit Begeisterung", was sehr oft zur nächtlichen Ruhestörung der restlichen TeilnehmerInnen führte.
Robert, Herbert und Hans arbeiteten mit Fleiß und Ausdauer an ihren Rollen. Bis tief in die Nacht saßen Herbert und Hans zusammen, um an ihren Dialogen zu feilen, die alle feinsäuberlich notiert wurden. Robert wiederum entwickelte immer wieder neue Rollen und deren Charaktere, die er chamäleongleich im Viertelstundentakt auf die Bühne brachte.
Giselher, der pensionierte Deutschprofessor der Runde, glänzte mit Bravour. Seine Monologe bleiben unerreicht, verstanden haben wir sie selten wirklich (das philosophische Niveau war zu hoch), aber sie hinterließen uns jedes Mal erstaunt und beeindruckt.
Peter, auch schon ein Kreativprojekterfahrener, stand als zweiter Kandidat für die Hauptrolle im Gespräch, als Ludwig seinen Rücktritt kundtat. Peter hätte die Rolle sehr gerne gespielt, verzichtete aber Ossi zuliebe darauf. Stattdessen übernahm er einige kleinere Rollen und die Bühnenarbeit.
Grundsätzlich war die Gruppe relativ homogen, weil nicht nur Reinhard mit einer Körperbehinderung zu kämpfen hat, sondern auch Wolfgang S. Der niedrige Frauenanteil ist für unsere Arbeit normal und war bisher noch kein Problem. Weiters kannten sich nahezu alle Gruppenmitglieder schon längere Zeit, was von Vorteil war.
Wir selbst hielten uns großteils im Hintergrund der dramaturgischen Arbeit und sprangen nur dort ein, wo Not am Mann oder der Frau war. So machten Wolfgang, Birgit und ich die Musik, Christian übernahm die Publikumsbegrüßung und Franz leitete die Probenarbeiten, bis Ernst diese Rolle übernahm.
6.1.6. Die Phasen
Der Arbeitsprozeß des Projektes PRO-95 teilt sich im Wesentlichen in vier Phasen:
- Vorbereitungsphase
- Arbeitsphase
- Präsentationsphase
- Nachbearbeitungsphase
Die Vor- und Nachbearbeitungsphase beinhaltet jeweils die finanztechnischen Belange, die Konzepterstellung, das Schreiben des Projektberichts, etc. Als Arbeitsphase bezeichnen wir die Projektwoche in Zwettl. Die konkreten Probenarbeiten mit Kostümen und Bühne sowie die beiden Aufführungen benennen wir mit Präsentationsphase. Die Nachbearbeitungsphase umfaßt die Fertigstellung der diversen Berichte (Videodokumentation und Abschlußbericht), die Endabrechnung mit SubventionsgeberInnen, Dankschreiben und vor allem für die KlientInnen, das Verfassen der schriftlichen Reflexionen für den Bericht. Im Kontext des Empowerments waren die beiden mittleren Phasen (Arbeit und Präsentation) die wesentlichen für unsere KlientInnen, wobei einzelne von ihnen auch bei der Vor- und Nacharbeit dabei waren und dort Erfahrungen sammeln konnten.
Die Theaterarbeit an sich läßt sich in fünf Phasen einteilen, die den Schritten des therapeutischen Theaters sehr ähnlich sind (vgl. Pkt. 3.1.1.), nämlich
1. Das Brainstorming zur Themenfindung
2. Die Formulierung eines gemeinsamen Themas und Inhalts
3. Die Erarbeitung des Rahmenstücks mit allen dazugehörenden Tätigkeiten
4. Die Aufführung
5. Der Projektabschlußbericht mit Reflexionstexten
Der wesentliche Unterschied zwischen dem therapeutischen Theater und PRO-95 besteht einerseits in der Absicht - PRO-95 sollte soziale Kompetenzen fördern, das therapeutische Theater hat seinen Schwerpunkt in der Psychotherapie - andererseits in der Intensität des Reflexionsschrittes. Im therapeutischen Theater folgt auf das Spiel des Rahmenstückes eine ausführliche Gruppenreflexionsphase, die es bei "So ein Theater" in dieser Form nicht gab. Wir reflektierten einerseits mündlich in der Gruppe am Ende der Projektwoche in Zwettl und andererseits schriftlich mittels kleiner Beiträge im Projektbericht, die dazu dienten auch die LeserInnen mit den Personen, die hinter den Theaterrollen standen, zu konfrontieren. Wir versuchten damit nicht nur unsere persönliche Rolle während der Arbeitsphase im zeitlichen Abstand von zwei Monaten zu durchleuchten, sondern auch Außenstehende an unserem gemeinsamen Prozeß teilhaben zu lassen. Wir wollten damit auch die Qualität unseres Produktes "So ein Theater" hervorheben.
6.1.7. "So ein Theater" - Prozeß, Produkt und das Leben danach
PRO-95 war klar produktorientiert, der Prozeß hatte sich dem Ziel unterzuordnen. Diese Grundaussage unseres Konzepts wurde lange und kontroversiell im Team diskutiert. Alle vorangegangenen Projekte waren prozeßorientiert gewesen, was der Sozialarbeit sicherlich näher steht als das wirtschaftliche Produkt. Schlußendlich mußten wir erfahren, daß unsere KlientInnen der Produktorientierung aufgeschlossener gegenüberstanden als wir es ursprünglich taten und daß der Prozeß in weiten Bereichen von der Produktausrichtung profitiert. Allerdings ist anzumerken, daß keine längeren Gruppenkonflikte auftraten und wir nicht gezwungen waren von der Produktorientierung Abstand zu nehmen.
In diesem Kontext wird klar, was hinter PRO-95 stand und selten direkt angesprochen wurde. Das Projekt stellt eine kreative Alltagssimulation dar. Das heißt, frei von den Zwängen des Lebens in unserem tatsächlichen Alltag, haben wir eine reale Arbeitssituation (das Theaterstück) geschaffen, wo es um Verläßlichkeit, Pünktlichkeit, Konsensbereitschaft, u.s.w. ging. Die am Arbeitsprozeß beteiligten Menschen wurden somit in den selben Bereichen wie am Arbeitsplatz gefordert, der Rahmen war allerdings ein anderer. Auch das ist sicherlich ein Grund dafür, daß keine schwerwiegenden Gruppenkonflikte aufgebrochen sind, weil auch im Alltag die Arbeit vorrangig ist.
"So ein Theater" war ursprünglich eine Ansammlung von Ideen verschiedenster Kleingruppen, die wir aus Zeitmangel mittels Abstimmung auswählen mußten. Zwei der Ideen "gewannen" (Sozialarbeit und Ritterspiel), worauf neue Arbeitsgruppen gebildet wurden, die jeweils ein Rahmenstück aus diesen Themen schnitzen sollten. Diese wurden der Großgruppe präsentiert und per Diskussion entschieden wir uns für ein Stück. Der Prozeß dauerte lange (2 Tage) und viele der TeilnehmerInnen wurden ungeduldig. Als dann endlich die Proben begannen, war die in dieser "Wartezeit" aufgestaute Spannung schnell verflogen und jedeR war begierig zu arbeiten. Der erste Schritt hieß also "warten können", Frustration aushalten, Gesprächskultur aufbauen, u.s.w. Besonders lautstark wurde die Langeweile von Robert und Ludwig reklamiert. Für Ludwig ist "Geduld" auch heute noch ein zentrales Thema, als manisch- depressiver Alkoholiker fällt ihm "Sich an das Tempo der anderen" anpassen besonders schwer.
"Du sagtest in unserem letzten Gespräch, daß Du jetzt geduldiger bist, hat das etwas mit PRO-95 zu tun? - Das ist möglich, ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Ich glaube, die Geduld habe ich mir durch Kreativität, Lesen (...) geholt. Ich glaube von da habe ich sehr viel Geduld her - beim Theaterstück habe ich sie eigentlich noch nicht gehabt. Ich kann mich noch an die Aufführungen erinnern, da habe ich immer darauf gewartet, daß ich an die Reihe komme. Ich habe das Stück ja gekannt, ich habe zwar geschaut wie die Leute spielen, weil ja sehr viel Stegreif war, aber ich habe immer darauf gewartet bis mein Auftritt kommt. Da war ich schon ungeduldig. Wenn wir jetzt Theater spielen oder etwas Ähnliches machen werden, dann wird es hoffentlich von mir aus gesehen besser gehen." 93
Während Ludwig und Robert nervös reagierten, ergaben sich Ossi und Wolfgang S. dem Alkohol. Die restliche Gruppe war mit Eifer am Diskussionsprozeß beteiligt. Trotzdem waren alle froh darüber, als das Ziel feststand und zur "konkreten" Arbeit übergegangen werden konnte. 94
Im Laufe der Arbeiten wurden die persönlichen Probleme hintangestellt, die Leute wirkten aufgekratzt, ganz mit dem Produkt beschäftigt. Ihre "privaten" Sorgen trugen sie entweder in die Reflexionsrunde oder in ein Einzelgespräch mit einem Teammitglied. Wir haben alle - ausnahmslos - gelernt. Ich selbst hatte Schwierigkeiten mich aus der TeilnehmerInnenrolle zu schälen und ganz Teamerin zu sein. Das bedeutet auch, daß ich verzichten mußte. Soweit als möglich durfte ich mich in den Verlauf des Stückes nicht einmischen. Ich durfte Anmerkungen machen, mußte ansonsten aber auf Anfragen der TeilnehmerInnen warten. Ich war in erster Linie Beraterin und Beobachterin und erst in zweiter Linie Springerin im Stück. Es war nicht leicht zu akzeptieren, daß "So ein Theater" nicht von meinen Ideen leben, nicht meinen "Stempel" tragen würde. Es kostete mich nahezu fünf Tage um mit meiner neuen Rolle umgehen zu lernen.
Ähnliches mußten auch andere Gruppenmitglieder erfahren. JedeR mußte ihren/seinen Platz im Gefüge finden und wie ich aus nachfolgenden Gesprächen weiß, hat PRO-95 bei einigen tiefgreifende Änderungen des Blickwinkels auf sich selbst verursacht.
Z.B. kam in Zwettl Sylvias therapeutische Rolle (Propädeutikum) immer wieder als Thema in der Teamsitzung. Einerseits stellte sie den "weiblichen Zündstoff" in der Gruppe dar, das heißt, sie konnte sich in ihrer Weiblichkeit nicht genug von den männlichen Teilnehmern abgrenzen, was bei längeren Projekten durchaus zu schwerwiegenden Konflikten in der Gruppe führen kann, und andererseits versuchte sie sich in der therapeutischen Abgrenzung, was in einer ambivalenten Haltung gegenüber dem Rest der Gruppe endete. Im Team sorgte dieses Thema täglich für Gespräche. In einem Reflexionsgespräch ca. ein Monat nach Beendigung des Projekts, bearbeiteten wir diese beiden Punkte (Rolle als TherapeutIn/SozialarbeiterIn, Weiblichkeit) noch einmal auf.
Pauline blühte auf der Bühne auf. Die sonst so schüchterne, weinerliche Frau wurde zur großartig dargestellten Ehefrau und Alkoholikerin. Sie lernte und perfektionierte für die zweite Aufführung das lautstarke Rülpsen. Es mag nun lustig oder widerlich erscheinen, aber Pauline war am ersten Abend noch nicht so weit, sie schämte sich fast auf die Bühne zu gehen. Doch als sie begonnen hatte, da war sie brillant und kaum zu bremsen. Besonders bei ihr merken wir immer wieder, welche Kraft und welches Selbstvertrauen sie durch die Teilnahme an "So ein Theater" geschöpft hat. Sie hat sich auf der Bühne von ihrer gescheiterten Ehe freigespielt.
Manche, so wie Hans, Ludwig, Robert, Peter, Günther oder Reinhard fragen immer wieder nach einem neuen Projekt und entwickeln eigene Ideen und Vorschläge, was wir als nächstes produzieren könnten. Andere, so wie unsere drei Wolfgangs oder Ernst haben nur mehr spärlichen oder gar keinen Kontakt zu uns, weil sie ihr eigenständiges Leben aufgebaut haben und auf die Sozialkontakte im Umfeld des Vinzenzhauses nicht mehr angewiesen sind. Sie haben Arbeit, eine eigene Wohnung, eine Beziehung. Sylvia hat kurz nach dem Projekt den Kontakt abgebrochen. Ossi hat vor kurzem, nach einem weiteren Rückfall, die Arbeitsstelle und die Prekariumswohnung verloren. Nach einer Krisenintervention in Ybbs ging er zu seinem Bruder nach Linz, um dort Fuß zu fassen. Giselher, Herbert oder Pauline halten nach wie vor den Kontakt, weil das Vinzenzhaus ein Hobby und eine Familie für sie ist.
JedeR von uns verbindet Erinnerungen an viel Arbeit, schwere Stunden und wunderschöne Gemeinschaftserlebnisse sowie an den unumstößlichen Erfolg unseres Stückes "So ein Theater" mit PRO-95.
"Der Schwierigkeit, ein dermaßen komplexes Ereignis in einen mehr als gedrängten Bericht zu zwingen, waren wir nicht gewachsen. Nicht zuletzt behindert uns die Liebe zu unserem erwachsen gewordenen Kind. Wir sind weder objektiv noch genau. Wir schreiben aber dennoch, damit unsere Erinnerungen sich in späteren Zeiten an den wenigen Worten festhalten können. Im Schreiben haben wir bemerkt, daß das eine oder andere noch offen ist. So ist das, und es ist gut so. - Wem die Kürze und Zweidimensionalität des Berichtes nicht genügen mag, der sei an den parallel zu diesem Bericht entstandenen Dokumentarfilm zum Projekt verwiesen. - PRO-95 ist ein Stück unseres Lebens und unserer Liebe." 95
Diesem Auszug aus dem Abschlußbericht zu PRO-95 kann ich mich nur anschließen. Eine umfassende Darstellung des komplexen Projekts und eine detaillierte Beschreibung des Stückes "So ein Theater" kann ich in dieser Arbeit nicht geben. Im Anhang werde ich größere Auszüge aus dem Projektbericht einfügen, um dort die Handlung des Stückes und den detaillierten Ablauf von PRO-95 vorzustellen. (vgl. Pkt. 8. Anhang)
6.2. Theater und Empowerment - Interviews
Die nachstehenden vier Interviews wurden von mir im Jänner und Februar 1997, ein Jahr nach der zweiten Aufführung von "So ein Theater" und eineinhalb Jahre nach der Projektwoche in Zwettl, gemacht. Sie sind einerseits der Versuch zu ergründen, welchen Stellenwert kreative Theaterprojekte, wie PRO-95 eines war, und Empowerment im täglichen professionellen Handeln der einzelnen Personen haben, andererseits versuchen sie sich an einer Evaluierung des Projekts.
6.2.1. Die Institution Dr. Jutta Gutmann, Leiterin des Vinzenzhauses der Caritas
1. Empowerment hat einen hohen Stellenwert im Vinzenzhaus. Stellt es einen festgeschriebenen Punkt des sozialarbeiterischen Konzepts dar oder ist es eine unausgesprochene Grundhaltung des Teams?
Für uns ist Empowerment noch kein gängiger Begriff, daher ist es im Konzept nicht definiert. Wenn ich es bisher richtig verstanden habe, dann ist es genau die Grundhaltung, die sich bei uns im Laufe der Jahre in der Arbeit mit den Klienten entwickelt hat. Es hängt stark mit dem Begriff der Handlungsfähigkeit zusammen und hat sich als sinnhaftester Ansatz für uns herausgestellt.
2. In welchen Bereichen haben die Klienten die meisten Schwierigkeiten selbständig zu sein?
Ich sehe prinzipiell die Schwierigkeit im Tagesablauf, in der Struktur, was ihnen völlig fremd ist. Schon junge Menschen haben damit Probleme und im Vinzenzhaus befinden sich Männer ab dem 30. Lebensjahr ... sie lassen sich prinzipiell in kein Korsett stecken. Sie aus dieser Haltung herauszukriegen und sie dazu zu bringen z.B. Hausarbeit eigenverantwortlich zu übernehmen, das scheitert sehr oft an der Motivation. Es ist keine neue Erkenntnis, wenn ich sage, daß wir nicht motivieren können, sondern daß es prinzipiell nur möglich ist nachzusehen was die demotivierenden Faktoren sind. So erkennen wir dann meistens ihre Schwächen und Stigmatas, die sie mit sich herumtragen. Die Lust zur Arbeit, zur Kreativität, "etwas weiterzubringen" fehlt. Das ist ein großes Problem. Wenn mehrere solcher Klienten im Haus sind, dann fehlt auch noch die Gruppendynamik und somit sitzen alle vor dem TV-Gerät statt sich anders zu betätigen.
3. Ein zentraler Punkt des Empowerments ist die Ausrichtung auf die Kompetenzen der KlientInnen. Wie erkennt ihr diese Kompetenzen in der Betreuung?
Das dauert oft sehr lange und es kommt immer wieder zu Enttäuschungen für beide Seiten. Die Kompetenzen werden nicht leichtfertig hergezeigt. Die Männer kommen in einem sehr schlechten Zustand zu uns und anhand kreativer Ansätze der MitarbeiterInnen können wir mit der Zeit sehen, welches Potential beim jeweiligen Klienten tatsächlich vorhanden ist. Wenn wir erkennen, was gerne gemacht wird und wo die Klienten auch die Bereitschaft haben Verantwortung zu übernehmen, dann ist vieles möglich, z.B. malen, zeichnen, musizieren, kochen, Blumen pflegen, das Aquarium, etc.
4. Sie haben die Kreativität angesprochen. Welchen Stellenwert schreiben Sie Freizeit- und Kreativprojekten zu?
Schon unter meinem Vorgänger gab es immer wieder Kreativprojekte, Bastelworkshops, etc. Für mich begann es, als ich das Haus übernahm. Ich wollte, daß das Haus anders aussieht, daß es gemütlicher wird. Wir haben viel in die Renovierung der Gemeinschaftsräume investiert, die Männer haben mitgearbeitet und -entschieden. Ein Effekt dieser Renovierung war, daß sie begonnen haben auch ihre Zimmer zu verschönern. Und es ist noch heute so, daß sie die Zimmer nach ihrem Geschmack gestalten dürfen (ausmalen, Bilder aufhängen, etc.). Besonders in diesem Zusammenhang sind sie alle unerhört kreativ geworden. Und ich glaube, damit haben wir ihnen auch sehr viel ermöglicht. Bewegung ist der zweite Schwerpunkt. Ich weiß von mir selbst, daß Bewegung meinem Körper, meiner Psyche und meiner Kreativität gut tut. Gott sei Dank habe ich jetzt MitarbeiterInnen, die mit den Männern sportliche Aktivitäten setzen. Es ist für mich faszinierend, was alles möglich ist: Badminton, Kegeln, Wandern, Radfahren, Tischtennis, Darts und vieles mehr. Sie entwickeln Ehrgeiz, sie kommen teilweise an die frische Luft, sie haben Struktur, Dinge auf die sie sich freuen können, und diese Aktivitäten sind für die Gruppe gut und sie erleben, daß es ihnen körperlich gut geht.
5. PRO-95 war ein großes Projekt. Gibt es noch Nachwirkungen?
Für die, die daran beteiligt waren, war PRO-95 ein ganz massiver Einschnitt in ihrem Leben. Es ist eine Erfahrung, die sie sicherlich nie vorher gehabt haben, sie haben so etwas nie zuvor erlebt. Sie waren den ganzen Tag mit dem Projekt beschäftigt und haben ständig daran gearbeitet. Auch das Nachleben ihrer Problematik war wichtig. Es ist mir aufgefallen, daß es ihr Selbstwertgefühl sehr gehoben hat, sie waren plötzlich interessanter und wichtiger, sie sind ernst genommen worden und sie waren einmal für eine Zeit lang etwas Besonderes. Für die anderen, die nicht daran teilgenommen haben, war die Wirkung sicherlich nicht so lange da, aber für die TeilnehmerInnen war PRO-95 sicher etwas ganz Einmaliges. Eine Chance an so etwas mitzuarbeiten bekommt man nicht so oft im Leben ...
7. Denkt das Publikum über ein Theaterstück wie "So ein Theater" nach?
Ich kann mich erinnern, daß ich bei der Uraufführung die Menschen im Publikum beobachtet habe und mir dachte, daß das jetzt doch einige sehr betroffen machen müßte. Ich hatte das Gefühl, daß viele im Publikum lebendiger geworden sind und plötzlich bemerkten "Jessas, das bin ja ich!" und das geht immer in irgendeiner Form tief. Das heißt sie waren teilweise mit sich selbst konfrontiert. Vielleicht konnten sie sich das erste Mal selbst sehen und sich ihre Situation so bewußtmachen. Ich weiß sehr gut, wie schwierig eine Selbstreflexion ist und das überhaupt zu tun bedeutet schon einen sehr großen Schritt. Es ist auch wirklich das größte Problem für unsere Männer, daher ist es natürlich viel anschaulicher, wenn man es ihnen auf einer Bühne zeigt. Also ich bin davon überzeugt, daß Aufführungen, wie "So ein Theater" etwas bewirken, bei denen, die schon so weit sind... Meßbar ist es natürlich nicht, nur spürbar.
8. Qualitätssicherung und Meßbarkeit von Sozialarbeit sind zur Zeit viel diskutierte Schlagworte. GeldgeberInnen verlangen vermehrt meß-bare Ergebnisse von Sozialarbeit. Wird die Finanzierung von Projekten wie PRO-95 nicht immer schwieriger?
Das ist ein Thema, das mich auch in meiner täglichen Arbeit unablässig beschäftigt. Ich kämpfe mit den selben Anforderungen an mich als Heimleiterin. Obwohl ich ständig darauf bedacht bin das Haus mit hoher Qualität und möglichst geringem Kostenaufwand zu führen - und das auch tue, so ist es beinahe unmöglich den Wert von Arbeit, der nicht gemessen werden kann, zu vermitteln. Ich habe mich in den letzten Jahren wirklich unheimlich angestrengt und ich kann auch niemandem böse sein - sie wissen nicht, was es heißt, wenn ein völlig handlungsunfähiger Mensch bei uns herein kommt und plötzlich ist er verantwortlich für das Gedeihen der Blumen. Und es funktioniert perfekt mit einer Tagesstruktur - das ist leider nicht meßbar. Das heißt für mich, daß man den Professionellen einfach glauben schenken müßte. Im jetzigen sozialen Klima wird die Situation immer schwieriger - deutlich schwieriger sogar. Wir spüren es ganz stark in den Forderungen die Männer schneller durch das Programm zu schleusen. Daß es für viele noch zu früh für einen Einstieg in den Arbeitsmarkt ist, das sieht man nicht. Es kommt zum Scheitern, zur Enttäuschung und in der Folge zu Mehrkosten. Aber das will man derzeit nicht sehen.
6.2.2. Das Projektteam Mag. Christian Wetschka, Mitarbeiter des Vinzenzhauses d. Caritas und Pastoralassistent der Caritas Obdachlosenhäuser
1. Sie waren Mitglied im Team PRO-95, würden Sie noch einmal ein derartiges Projekt mitorganisieren?
Grundsätzlich ja. Wobei ich sagen muß, daß mein Denken über derartige Projekte sich verändert hat. Heute geht es mir eher darum nicht ein einmaliges Projekt ins Leben zu rufen, sondern etwas zu organisieren, was einen permanenten Prozeß möglich macht, d.h. eine laufende Gruppe. Und dabei sind wir ja gerade. Wir werden noch heuer einen Verein gründen, um unsere punktuellen Erfahrungen mit PRO-95 in eine langfristige Form umzusetzen. Als KurzstreckenläuferInnen haben wir uns schon bewährt, jetzt müssen wir LangstreckenläuferInnen werden.
2. Die Grundüberlegung von PRO-95 war die Basis zu schaffen, daß Menschen ihre eigenen Grenzen erfahren und diese überschreiten können. Ist das schon genug, um sagen zu können, daß ein Empowermentprozeß ausgelöst wurde?
Empowermentprozesse sind schwer zu messen. Es braucht schon Tiefeninterviews bei jedem einzelnen Teilnehmer um festzustellen, was von PRO-95 bei jedem einzelnen heute noch weiterlebt. Auf jeden Fall ist für mich feststellbar, daß PRO-95 für die meisten TeilnehmerInnen ein so intensives Erlebnis war, daß es in den Gesprächen immer wieder auftaucht und somit identitätsstiftend wirkt. Es wird immer wieder nachgefragt, wann solche "Aktionen" wieder durchgeführt werden. Und die Bereitschaft sich auf so viel Abenteuer einzulassen ist jetzt bei den Leuten viel größer, als sie es vorher war. Das heißt für mich auch, daß die Erfahrung, daß wir gemeinsam etwas Ganzes zustande bringen, nicht verloren gegangen ist. Das betrifft die "Nur-TeilnehmerInnen" genauso wie das Team, und am stärksten erlebe ich es im Team weil hier der Impuls gemeinsam weiterzumachen sehr stark vorhanden ist. Trotzdem PRO-95 für alle auch eine große Belastung war ...
3. Können Sie in Ihrer täglichen Praxis als Betreuer im Vinzenzhaus einen Nutzen für das Alltagsleben der TeilnehmerInnen an PRO-95 sehen?
Was ist der Nutzen in der Sozialarbeit? Heißt das, daß PRO-95 geholfen hat, daß Leute mehr Schulden zurückzahlen, oder rascher wieder in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden können? Solche Zusammenhänge könnte man nur konstruieren. Der Wert von PRO-95 liegt auf der Beziehungsebene. Hier haben sich Menschen in Grenzsituationen kennengelernt und für eine gewisse Zeit eine gemeinsame Identität gefunden. Und ich bin sicher, daß für einige TeilnehmerInnen dieser Prozeß ein Baustein in einem längeren Heilungsprozeß war. Bei manchen KlientInnen ist es für mich auch sichtbarer als bei anderen. Wenn man grundsätzlich daran glaubt, daß Menschen sich weiterentwickeln, sich verändern können, und insbesondere bei unserer Klientel, daß sich diese Menschen in einem Orientierungsprozeß befinden, dann kann man auch nicht umhin anzuerkennen, daß ein Angebot wie PRO-95 die positiven Prozesse verstärkt.
4. Warum haben Sie gerade Theater als adäquate Form für Empowerment-prozesse gewählt?
Das liegt auf der Hand. Aus den vorangegangenen Projekten ist klar geworden, daß Theaterspiel jene Form ist, in der man jede Art von kreativer Tätigkeit optimal einbringen kann: Musik machen, Bewegung, Sprache, Texte schreiben, Malen, Formen, Basteln, Kostüme nähen, u.s.w. Vor allem aber die Koordination aller Tätigkeiten hat uns besonders gereizt. Das heißt Zeitmanagement, Krisenmanagement, die Gruppendynamik u.s.w. Ich würde sagen, daß die eigentliche Kreativität von PRO-95 sogar auf dieser Ebene zu finden ist. Nämlich darin, wie wir miteinander umgegangen sind, wie wir mit den eigenen Grenzen und denen der anderen umgegangen sind, wie wir gemeinsam Krisen bewältigen konnten.
5. PRO-95 war klar produktorientiert, steht das nicht im Widerspruch zum Konzept des Empowerment?
Das Leben hat halt Grenzen und mit diesen Grenzen kreativ fertig zu werden - oder viel mehr einander zuzutrauen mit Grenzen fertig zu werden, daß ist charakteristisch für Empowermentprozesse. Der Prozeß von PRO-95 hat auch - in Zwettl - den Punkt erreicht, wo uns allen klar war, daß wir es schaffen würden. Am Mittwoch war einfach allen klar, daß "So ein Theater" fertig werden würde, egal was noch passieren würde. Ich würde sagen, daß die Produktorientierung die Prozesse geradezu konzentriert hat, das heißt, daß sie ein wesentliches Element des Empowermentprozesses war. Konkrete Ziele vor Augen zu haben ist kein Widerspruch zu Empowerment eher sogar im Gegenteil: Wenn einem die Ziele die man erreichen will und auch erreichen kann immer klarer vor Augen stehen, dann ist es geradezu ein Indiz für einen effizienten Empowermentprozeß. Wachsende Identität, wachsende Klarheit und wachsende Motivation sind ein Anzeichen dafür, daß wirklich ein Prozeß stattfindet. Und das war in Zwettl der Fall, aber auch schon davor.
6. PRO-95 wurde vom Vinzenzhaus - somit von der Caritas - unterstützt. Wie schätzen Sie die Rolle der beiden - also des Heims als Teilbereich und der Überbauorganisation - ein, bzw. wie stehen Sie zum Konzept des Empowerments?
Ich würde meinen, daß der Begriff "Empowerment" als Fachterminus innerhalb der Caritas noch kaum verbreitet ist. Andererseits ist klar, daß Hilfeleistungen Menschen nicht in Abhängigkeit führen soll, sondern nach Möglichkeit zur Entfaltung eigener Ressourcen beitragen soll. Das heißt Empowerment gibt es in Ansätzen, aber nicht als Philosophie. Die Caritas ist gerade dabei die seit den 70er Jahren gängigen Thesen der Sozialarbeit zu verarbeiten und diesbezüglich eine Identität zu entwickeln. Einerseits möchte ich festhalten, daß das Christentum in mancher Hinsicht geradezu einen Nährboden für Anti-Empowerment bildet. Die Caritas hat hier sogar eine Vorreiterrolle innerhalb der katholischen Kirche in Österreich, sie ist ihrem kirchlichen Umfeld zeitlich weit voraus. Innerhalb der Kirche gibt es noch immer sehr abhängigmachende Strukturen, wie Autoritätsgläubigkeit, Diskriminierung von Frauen und Laien, u.s.w. - also Verleugnen von Realitäten. Aber es gibt auch den guten Willen engagierter Menschen und das ist die andere Seite. Dazu gehört auch ein kritisches Potential für diese Gesellschaft.
Für das Vinzenzhaus möchte ich geltendmachen, daß hier aufgrund der 10jährigen Erfahrungen in der Obdachlosenarbeit Empowermentprozesse immer gefördert wurden, weil das Letztziel war immer die Eigenständigkeit der Klienten. Es war auch immer klar, daß die Förderung der Eigenständigkeit auf verschiedenen Ebenen stattfinden muß, auf der Beziehungsebene genauso wie auf der sozialarbeiterisch-sachlichen Ebene, wo es um Geld geht, um Schuldenregulierung, etc. Sehr viel gelernt haben wir aus der Arbeit mit Suchtkranken. Wer es wirklich geschafft hat aus der Sucht auszusteigen, der hat einen psychischen Paradigmenwechsel hinter sich gebracht. Und da haben wir sehr viel über Empowermentprozesse erfahren. Das kreative Arbeiten und die Freizeitgestaltung war immer auch ein wichtiges Element. Noch mehr aber wurde das kreative Arbeiten des Teams ermöglicht.
7. Das Projekt war finanziell gedeckt, durch Spenden, durch Subventionen der Stadt Wien und der Gewerkschaft, den Aufbringungen der TeilnehmerInnen und die Förderung des Vinzenzhauses. Waren alle vom Konzept überzeugt?
Nein. Das kann es wahrscheinlich nirgendwo geben, daß alle von einer unkonventionellen Idee überzeugt sind. Vielleicht ist das auch ein gutes Argument dafür, daß wirklich ein Empowermentprozeß stattgefunden hat, daß dieses Projekt trotz kritischer Stimmen durchgeführt werden konnte. Die Kreativität hat sich durchgesetzt.
6.2.3. Die KlientInnen Ludwig Zeissner, Teilnehmer an PRO-95 und Klient des Vinzenzhauses, Ludwig ist manisch-depressiv, Alkoholiker und lebt seit ca. drei Monaten in einer Prekariumswohnung.
1. Ludwig, Du hast Dir den Projektbericht noch einmal durchgelesen. Was hast Du heute, nach mehr als einem Jahr, noch in Erinnerung von PRO-95?
Ich habe in Erinnerung, daß es im Großen und Ganzen eine Gemeinschaft war, wir haben miteinander gearbeitet, für mich teilweise zu wenig, die Leute waren teilweise sehr unpünktlich, das hat mich gestört. Ich habe auch lange daran geglaubt, daß da nichts daraus wird. Ich hab' das auch im Bericht geschrieben. Ich bin einigen Menschen näher gekommen und habe das erste Mal in meinem Leben mit Körperbehinderten zu tun gehabt. Vor PRO-95 habe ich davor immer Angst gehabt, aber es ist nicht so schlimm, es geht. Naja, das Wetter hat gepaßt, das Essen war gut, es war günstig für mich, ich habe dort eine schöne Zeit verlebt. Was mich ein bißerl gestört hat, mein Zimmerkollege Ossi hat Alkohol getrunken, ich war damals ganz clean, ich hab' nichts getrunken und das hat mich schon gestört. Aber ich habe damit leben können.
2. Hast Du Dich durch PRO-95 weiterentwickelt?
Also ich glaube ich habe Sachen gemacht ... ich hab' in meiner Jugend auch Theater gespielt - Volksschule, Hauptschule, Hort - und ich hab' mich dort eigentlich nie getraut. Und ich hab' einige Sachen gemacht, die ich mich früher nie getraut hätte. Ich hab' mich ganz einfach manchmal gehen lassen, bin auch - wie man weiß - an einigen Sachen gescheitert, das war ein Kampf, der dann auch ... vor der Theatergruppe hab' ich deklarieren müssen, daß ich diese Hauptrolle nicht spielen kann. Warum, das ist mir bis heute eigentlich nicht ganz bewußt. Ich hab' viel darüber nachgedacht und hab' auch mit vielen (betroffenen) Leuten darüber geredet, und es war für mich wirklich schwer die Hauptrolle abzugeben.
3. Welche Vorteile ziehst Du aus Deinem damaligen Lernen heute?
Ich glaube, was ich daraus lernen konnte ist, daß ich mich gewisse Sachen schon eher trau' ... nein, nicht ganz - das ist eine schwere Arbeit für mich -... das ist verschieden, das kommt auf meine Stimmung an ... manche Amtswege erledige ich zwar, aber ich schiebe sie oft sehr lange auf. Dann denke ich mir immer - ich meine ich denke schon sehr viel an das Theater und bin auch sehr froh, daß wieder etwas in Gang kommt und man muß auch sehen, daß man an Sachen scheitert, weil es einem ganz einfach nicht liegt, oder es liegt einem und man muß es lernen und probieren.
4. Ist Theater eine gute Methode zum Empowerment?
Oja, das glaub' ich sehrwohl. Entweder Theater oder andere kreative Aktivitäten. Ich hab' auch immer die 'Meßvorbereitungen' im Vinzenzhaus 96 für etwas Gutes gehalten und bin immer noch traurig, daß es zuende ist. Ich glaube wenn Menschen gemeinsam an einem Projekt arbeiten und den Leuten etwas daran liegt, dann versuchen sie das, auch wenn Schwierigkeiten auftreten, zu bewältigen. Man hat gesehen, manche Sachen haben nicht nach Plan funktioniert. Z.B. Wolfgang ist ausgefallen und ganz einfach in den Wald gegangen oder hat getrunken, aber doch, bis zur Aufführung hat es funktioniert. Ich hab' manchmal daran gezweifelt, wenn ich gesehen habe, daß wir schon vier Tage in Zwettl waren und nichts ist passiert. Aber dann ist es doch langsam gegangen und man soll nichts überstürzen ... langsam ... kleine Schritte.
5. Du sagtest, daß Du ruhiger geworden bist. Hängt diese Veränderung mit PRO-95 zusammen?
Das ist möglich, ich hab' darüber noch nicht nachgedacht. Ich glaube, die Geduld hab' ich mir durch Kreativität, Lesen - lesen schnell geht nicht, zumindest nicht wenn die Sachen halbwegs anspruchsvoll sind - ... geholt. Ich glaub' von da hab' ich sehr viel Geduld her - beim Theaterstück hab' ich sie eigentlich noch nicht gehabt. Ich kann mich noch an die Aufführungen erinnern, da hab' ich immer darauf gewartet, daß ich an die Reihe komme. Ich hab' das Stück ja gekannt, ich hab' zwar geschaut wie die Leute spielen, weil ja sehr viel Stegreif war, aber ich hab' immer darauf gewartet bis mein Auftritt kommt. Da war ich schon ungeduldig. Wenn wir jetzt Theater spielen oder etwas Ähnliches machen werden, dann wird es hoffentlich von mir aus gesehen besser gehen.
6. Die Finanzierung von PRO-95 ist Dir bekannt. Warum unterstützen Menschen und Institutionen ein derartiges Projekt?
Möglichkeiten gibt es viele Geld zu beschaffen, wie Flohmärkte, Benefizkonzerte, Spenden - warum spenden Leute? Aus Mitleid, aus Interesse, weil sie vielleicht sehen wollen, wie verschiedenste Randgruppen - Alkoholkranke, Drogenabhängige, psychisch Kranke, Körperbehinderte - miteinander ... nein, ich glaub' es ist sehr viel Mitleid ... aber einfach auch aus anderen Gründen, die mir im Moment nicht einfallen.
7. Worauf muß das Projektteam besonders achten?
Man sollte Leute nicht zu irgend etwas drängen, was nicht ihnen entspricht, was sie nicht können oder nicht wollen. Ich glaube, daß Menschen, die so ein kreatives Projekt leiten, sehr sensibel sein müssen und wissen müssen, was man von einem Teilnehmer fordern kann. Z.B. ist es nicht gut jemanden zum Fahnen nähen zu zwingen, wenn er vorher noch nie eine Nadel in der Hand gehabt hat. Wenn er das Nähen lernen will, dann ist das möglich und o.k., wenn er aber lieber auf die Trommel hauen will, dann soll er halt auf die Trommel hauen.
8. Müssen ProjektleiterInnen selbst Empowermentprozesse durchlaufen haben, um ein Projekt wie PRO-95 anbieten zu können?
Naja, das würde vorerst heißen, daß es nur Alkoholiker als Therapeuten gäbe oder Junkies, die therapieren. Ich glaube, daß Menschen, die das machen sowieso gewisse Qualitäten mitbringen müssen, wie z.B. Verständnis, etc.. Und die Erfahrungen ... ich glaub', daß Menschen, die noch nie selbst so ein Projekt gemacht haben, die sich nie in diese Richtung entwickelt haben, daß die auch nie solche Dinge machen würden. Sie würden sich einfach nicht trauen, weil sie's nicht kennen. Und wenn sie sich drüber trauen, dann werden sie stolpern.
9. Das Team hatte während des Projektablaufs persönliche Krisen. Übertrug sich das auf die Gruppe?
Ja. Besonders die "Krankheit" von Sylvia hat sich besonders ausgewirkt, da sind alle zu ihr gerannt, um sie zu bemuttern. Christian hat eine Krise gehabt, da war ich stolz, daß er doch noch mit mir geredet hat. Wolfgang hatte einen Rückfall, der sich aufgelöst hat. Es haben eigentlich einige Krisen gehabt. Ich glaube, wenn wir so etwas noch einmal machen, ... wenn Menschen Krisen haben, dann muß die Gruppe selbst das auffangen können.
10. Irritierte Dich die Produktbezogenheit des Projekts PRO-95?
Nein. Ich hätte es noch viel stärker gewollt. Wir haben ganz lange diskutiert, in der Großgruppe, in der Kleingruppe, wieder in der Großgruppe, und so weiter. Für uns in der Kleingruppe war sehr schnell klar, was passieren soll, aber die Interessen der Großgruppe unter einen Hut zu bringen hat mir zu lange gedauert. Ich muß jetzt schon sagen, daß hab' ich mir schon lange gedacht, daß das vorprogrammiert war. Es ist dann nämlich so plötzlich gegangen. Ich bin da in der Wiese auf einem Baumstumpf gesessen und da hat es geheißen: "Ludwig, Du spielst die Hauptrolle." Das war ein ziemlicher Schlag. Zuerst sagte ich, daß ich das nicht will und nicht kann. Nach ein paar Minuten hab' ich dann aber doch ja gesagt. Ich hätt' es gemacht, aber es ist dann halt nicht gegangen.
11. War zu wenig Platz für die persönlichen Krisen der Leute?
Nein, das glaub' ich nicht, wir hatten die täglichen Feedbackrunden. Vielleicht hätte man sie noch anders gestalten können, aber wenn einer seine Probleme in so einer Runde nicht bringt, dann kann er das nicht oder will er das nicht. Für mich persönlich war es o.k. ich hab' über meine Probleme geredet, außer über Ossi's Alkoholproblem, weil ich ja wußte, daß das Team sowieso weiß, das er trinkt und ich wollte ihn nicht verpetzten. Ich würde das an seiner Stelle auch nicht wollen.
12. Nun haben gerade im Umfeld des Vinzenzhauses viele Menschen Alkoholprobleme, das bedeutet, daß auch während der Kreativprojekte Alkoholverbot gilt. Gibt es Alternativen dazu?
Naja, man könnte, wenn man jemanden erwischt, den nach Hause schicken. Das wäre natürlich sehr hart. Man muß das von Fall zu Fall entscheiden. Das bringt natürlich Krisen. Man kann aber auch nicht sagen, wir fahren wo hin, grillen, singen, und ihr sauft's jetzt was ihr wollt. Dazwischen einen Weg zu finden ist sehr schwer. Die ganze Gruppe sollte darüber diskutieren, wenn der Alkoholkonsum die Gruppe stört.
13. Gibt es die selben Möglichkeiten für Empowerment auch, wenn ein fertiges Stück zur Aufführung gebracht wird anstatt eines selbsterarbeiteten?
Ja, darüber hab' ich schon nachgedacht. Ich könnte mir durchaus vorstellen ein bestehendes Theaterstück zu verändern, z.B. ein Kabarett daraus zu machen. Möglichkeiten gibt es genug, die sind unausschöpflich. Aber mir hat die Idee gut gefallen, "mit nichts fortfahren und mit einem Stück heimkommen." Ich hab' zum ersten Mal erlebt ... es wär' natürlich schon gut immer was Neues zu machen - dieser Reiz des Neuen, das Kribbeln ... nur, wie ich gehört habe, ist an dem Projekt PRO-95 schon viel länger gearbeitet worden, als ich mitbeteiligt war und ich war nur dabei wie das Stück entstanden ist. Das "Dazugehören", ein Teil dieses Projekts zu sein, das hat mir eine Zeit lang sehr geholfen und freut mich noch immer.
14. Sind Menschen, die in einem Haus, wie dem Vinzenzhaus wohnen, daran interessiert bei solchen Empowerment- und Kreativprojekten mitzumachen?
Wie man gesehen hat, sind es nicht immer so viele, aber wie ich die Leute kenne sind sie sehr wohl daran interessiert. Manche machen es aus Interesse und aus dem Willen sich selbst zu entfalten, ... und manche aus Ehrgeiz. Letzteres find' ich schlecht. Weil die wollen dann die anderen "an die Wand spielen" und es ist doch keiner besser als der andere.
Einschub: Aber eine gute Gruppe sollte doch auch diesen Konflikt mittragen können ...?
Tja, schon, aber... der kann doch nicht - nur weil er vielleicht ein bißerl mehr Ahnung - oder auch nicht - davon hat als ein anderer - alle Fäden ziehen ...
Einschub: ... also doch Kontrolle durch das Team...?
Ja, schon Kontrolle, aber nicht Zurückziehen täglich in eine abendliche Teamsitzung. Die Probleme müssen in der Gruppe entschieden werden. Wenn die Susi sich mit Pulver zumacht, dann muß die Gruppe Strategien entwickeln, und dann wird die Susi das nach den gemeinsam mit der Gruppe erarbeiteten Strategien lösen. Aber nicht zu viert oder zu sechst in einer Teambesprechung...
15. Das heißt, Dein Wunsch an ein kommendes Projekt wäre, soweit als möglich die Gruppe entscheiden zu lassen.
Die Gruppe entscheiden zu lassen - soweit es geht - ich meine, man kennt ja die Gruppe. Man weiß aus welchen Verhältnissen und welchem Umfeld die Leute stammen, wieviele Alkoholiker, Junkies oder Behinderte ... da sind. Alles in der Gruppe diskutieren. Und wenn es nicht geht, dann setzt man sich zusammen und sagt o.k., das stört die Gruppe, das ist für ihn nicht gut, etc. Aber wenn irgendein Problem auftaucht, dann sollte man versuchen, das in der Gruppe zu regeln.
6.2.4. Die Politik Petra Bayr, Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei zum Wiener Gemeinderat
1. Welche Bedeutung hat Empowerment für Sie persönlich?
Empowerment ist für mich vor allem eine Methode in der Jugendarbeit, weil ich es von dort kenne, um Jugendlichen dazu zu verhelfen, daß sie Fähigkeiten und Selbstbewußtsein entwickeln, um ihre Probleme selbst zu überblicken, einzuschätzen und in den Griff zu kriegen.
2. Welche Bedeutung messen Sie dem Empowerment als unterstützungs-würdiges Anliegen für die Gemeinde Wien zu? Das heißt, finanziert die Stadt Wien Empowermentprojekte oder fördert sie diese in ihren eigenen Einrichtungen?
Ich messe Empowerment als Ansatz eine große Bedeutung zu. Ich glaube nur, daß auch in der SA so etwas wie Trends, Moden und neue Strömungen gibt, die auch ausprobiert werden wollen, aber da muß Empowerment auf jeden Fall einen Platz haben. Über die Stadt Wien laufen im Bereich der Jugendarbeit einige wenige Projekte mit Empowermentansätzen, wie z.B. das Flex
3. Wo liegt Ihrer Meinung nach die finanzielle Grenze für die Stadt Wien? Wann werden also Entscheidungen ein Projekt wie PRO-95 zu fördern politisch schwierig?
Man kann sagen, daß es, wenn es nach mir als Privatperson ginge, die Ansätze für soziale, jugendpflegerische, krisenmanagende Arbeit höher sein sollten.
4. Welchen Einfluß hat die Zuordnung einer sozialen Institution zu einem politischen Lager auf die Entscheidungen der Gemeinde?
Prinzipiell darf es nicht darauf ankommen welchem politischen Lager eine Einrichtung zuzuordnen ist, sondern auf die Konzepte, auf die Innovationskraft und auf die Auswirkungen.
5. Sie als Soziologin, welchen Stellenwert hat Empowerment in der Soziologie für Sie?
Als SoziologInnen haben wir nur die Instrumentarien gesellschaftliche Prozesse und deren Auswirkungen zu erklären und maximal große Lösungsansätze anzubieten. Wir haben aber nicht das Instrumentarium diese Lösungsansätze auch umzusetzen. Was gleichzeitig auch ein Dilemma der Soziologie ist.
6. Sie kennen das Projekt PRO-95. Stellt Theater eine adäquate Methode zur Förderung von Empowermentprozessen dar?
Ja, auf jeden Fall.
7. Glauben Sie, daß Unbeteiligte, dazu zähle ich in diesem Fall PolitikerInnen, bzw. NichtexpertInnen bei Kreativprojekten wie PRO-95 - im Zusammenhang mit einer schwer benachteiligten Randgruppe wie obdachlosen Alkoholikern - nicht mehr den Freizeitwert und den Spaß als die Arbeit und den Prozeß in der Persönlichkeitsentwicklung der KlientInnen sieht?
Nein, ich denke mir, daß zu einem gesamtheitlichen Leben nicht nur der Produktions- sondern auch der Reproduktionsprozeß gehört. Es ist sicher genauso legitim und wichtig im Reproduktionsbereich anzusetzen und zu versuchen dort wichtige Arbeit zu machen, wie in der Abdeckung der Nachfrage nach Wohnung, Kleidung, etc. Kommunikation, soziale Bindungen und Geborgenheit sind genauso wichtige Primärbedürfnisse und über Arbeit im Freizeitbereich zu fördern.
7. Zusammenfassung
Wenn wir Ziele, Funktionen, Inhalte der Theaterarbeit mit jenen der Empowermenthaltung vergleichen, so liegt die Idee, die beiden zu kombinieren und die eine von den Vorzügen der anderen profitieren zu lassen, nahe. Beide stellen den Menschen und seine besonderen Fähigkeiten in den Mittelpunkt, sowie die Gemeinschaft, die Beziehung, die Erreichung der Öffentlichkeit, u.s.w. Beide sind Wechselspiele der Aktion und der Reaktion, der Bewältigung von Situationen mittels kreativer Ideen.
"Im inbrünstigen Ernstnehmen des Spiels, in der spielenden Überwindung des Ernstes, in dem steten Wissen, daß alles ein Spiel ist, leuchtet alle Herrlichkeit der Menschen." - Max Reinhardt 97
Empowerment braucht kreative Methoden. Theater ist ein gutes Mittel um innerhalb eines geregelten, vorerst unpolitischen Rahmens, Eigeninitiative, Kreativität, Teilhabe, gegenseitige Unterstützung, u.s.w. zu üben und gemeinsam Inhalte zu erarbeiten. Diese Inhalte sind großteils von den Interessen der einzelnen TeilnehmerInnen geprägt und können zur Aufarbeitung von persönlichen Rollenkonflikten dienen. Durch die Einübung von Rollen, die Übernahme anderer Charaktere als den eigenen, können neue Erkenntnisse über sich selbst und die eigenen Fähigkeiten erlangt werden. Die Menschen wachsen also über sich selbst hinaus, überschreiten bisher unüberwindlich geglaubte persönliche Grenzen und erleben die eigene Veränderungskraft. Unpolitisches kann zu Politischem werden, so wie Unpersönliches plötzlich Wärme und Ausdruckskraft erhält. Die Gruppe kann tragen, Gemeinschaft wird aufgebaut, Beziehungen müssen schon zwangsläufig geknüpft werden. Trotzdem bleibt auch Platz für die Individualität jeder/jedes Einzelnen und Luft, um die eigenen Ressourcen wieder aufzufüllen.
Letztlich kann die Entstehung eines Theaterstücks (eines Produkts) der Ausdruck eines von der Gruppe durchlaufenen Empowermentprozesses sein. Das Ergebnis spiegelt oftmals die Anliegen der Gruppe wieder und hat meistens mit den persönlichen Schicksalen und Vorlieben der einzelnen Gruppenmitglieder zu tun. So trägt Theater auch zur Öffentlichkeitsarbeit jeder Institution bei, die kreative Empowermentprojekte in ihrem Rahmen zuläßt.
"Es ist die Funktion des Theaters, daß es die Menschen zu einer vertieften Lebensauffassung hinführt, sie erkennen läßt, was Menschsein heißt und von jedem einzelnen fordert, sie aufruft für die große Idee einer sozialen Ordnung, die auf wirklichem Gemeinschaftsgefühl und wahrer Achtung vor dem Wert und der Würde des Menschen beruht. Dies glauben, dies wissen heißt aber: Nun auch tatkräftig mitarbeiten am weiteren Ausbau unserer Theaterkultur. Was hier geschieht, ist wahrlich nicht umsonst. Es dient im besten Sinne des Wortes der Fortentwicklung der Menschheit." 98
8. Anhang
Die nachstehenden Seiten sind Auszüge aus dem Abschlußbericht des im Pkt. 6 angesprochenen Kreativprojekts PRO-95 und sollen zur näheren Beschreibung des Arbeitsprozesses und des Endproduktes dienen.
8.1. Kalendarium zu PRO-95
8.8.1994
Die Pianistin Brigitte Neidl besucht mit Sabine und Christian den Pfarrsaal Ober-Sankt- Veit, um das Pianoforte für ein mögliches Benefizkonzert zu begutachten.
12.8. - 15.8.1994
Erste konsequente und aufreibende Gespräche zur Planung von PRO-95 in Haselbach. Die Idee, einen "Verein" zur Organisation des Projekts zu gründen, kann sich nicht durchsetzen. Intensives und kontroverses Nachdenken über die Frage, wie man mit eventuellen Konflikten umgehen soll. Besprechung in der Gruppe oder Einzelgespräche? Franz und Christian werden sich nicht einig. Dennoch wird ein Modell für die Arbeitsstruktur gefunden: morgens Arbeitsgespräche in der Großgruppe, abends Feedbackrunden. Die Idee der "Spendenpredigt" ist längst geboren.
10.9.1994
Treffen des gesamten Teams bei Sabine. Erstellung der Projektbeschreibung, Entwurf der möglichen Bittbriefe.
14.9.1994
Treffen des Teams mit Harti (ehem. Heimleiter) in der Gfrornergasse. Vorstellung von PRO-95. Harti stimmt der Durchführung von PRO-95 (incl. der Spendenfinanzierung) zu. Ein "PRO-95"-Emblem wird ausgesucht.
30.9.1994
Treffen des Teams zur Vorbereitung des Benefizkonzerts, Fertigstellung der Projektbeschreibung.
Oktober 1994
Franz und Walter gestalten in mehreren Treffen Plakatwände, auf denen das Vinzenzhaus und PRO-95 dargestellt werden. Plakate für das Benefizkonzert werden verschickt oder direkt aufgehängt. Handzettel werden verteilt. Sabine, Alfons und Wolfgang K. verteilen u.a. vor dem Konzerthaus und vor dem Musikverein Handzettel. Michael und Walter hängen Plakate in den Geschäften rund um den Wolfrathplatz auf. Das Benefizkonzert wird u.a. in den LAMDA-Nachrichten angekündigt.
10.10.1994
Die GPA teilt uns mit, daß sie unser Projekt mit 10.000,- sponsern will. Dieses Werk geht auf Sabines Konto!
16.10.1994
Christian und Birgit besuchen die Pfarre von Pfarrer Michael Scharf. Von einer möglichen Spendenpredigt im kommenden Jahr wird gesprochen. Der Pfarrer wird im Pfarrgemeinderat nachfragen. Eine mögliche Theateraufführung des Endprodukts wird erwogen.
19.10.1994
Christian hält in der Gfrornergasse (unterstützt von Walter) einen Vortrag zum Thema: Droge Alkohol. Die hiebei eingenommenen 500,- werden für die Plakatwände verwendet.
23.10.1994
Der Kaplan von St. Stephan in Baden besucht mit Birgit die Gfrornergasse. Im Zuge einer Hausführung wird auch der Termin für die Spendenpredigt in Baden festgelegt: der dritte Fastensonntag 1995 (19. März 1995, 9 Uhr). Wir dürfen dann im Pfarrkaffee die Plakatwände aufstellen und Geld sammeln.
30.10.1994
Aktionstag für das Benefizkonzert. Das Team versammelt sich vor 9 Uhr vor der Kirche am Wolfrathplatz. Die Besucher der 9 Uhr- und 10 Uhr 30-Messen können sich die Plakatwände anschauen und erhalten Handzettel für das Benefizkonzert. Christian lädt die Pfarrgemeinde direkt "von der Kanzel" ein. Franz, Birgit, Sabine und Christian machen nachts eine Runde durch Hietzing. An erlaubten Stellen werden Plakate aufgehängt.
3.11.1994
Mehrere Telefonate mit Agnes wegen des Klavierstimmers. Noch ist nicht ganz klar, ob er wirklich rechtzeitig kommen wird. Am frühen Nachmittag Entwarnung: der Klavierstimmer kommt morgen zumittag.
4.11.1994 19 Uhr 30:
Der Saal ist voll. Zusätzliche Stühle müssen aufgestellt werden. Rund 80 bis 90 Gäste sind gekommen. Christian hält eine kleine Ansprache, die zum Spenden anregen soll. Anschließend geht das Benefizkonzert klaglos über die Bühne. Am Ende erhält Frau Neidl auch eine von Alfons kreierte Torte "in rot" als Danke vom PRO-95- Team. Sogar eine Zugabe mußte gespielt werden. Rund 8.500,- wurden an diesem Abend gespendet. Wir sind zufrieden.
24.2.1995
Erstes Arbeitsgespräch im neuen Jahr bei Christian. Walter ist nicht dabei, weil er einen therapeutischen Aufenthalt in Ybbs absolviert. Dafür ist Ludwig bei diesem Gespräch dabei, der jetzt in der Gfrornergasse wohnt und das Projekt tatkräftig mitunterstützen will. Bei diesem Arbeitsgespräch legen wir fest, daß wir am 6.5. ein weiteres Benefizkonzert abhalten werden. Der Gitarrist Andi Forster hat sich für dieses Projekt angeboten. Vorgehen und Organisation wird sich an das erste Benefizkonzert anlehnen. Leider müssen wir auch erfahren, daß weder Alfons noch Claudia nach Zwettl mitfahren können, weil Claudia zu diesem Zeitpunkt im 7. Monat schwanger sein wird. Alfons bekommt zu diesem Zeitpunkt keinen Urlaub. Auch sind einige Leute, die sich schon lange für PRO-95 angemeldet hatten, wie es bis dato aussieht, ausgefallen. Mayerhofer ist verschollen, Rothmund bleibt für das nächste Jahr im Therapiezentrum Ybbs. Dennoch stehen bis jetzt 17 Leute auf der Liste... Auf der Spendenseite sieht es gut aus. Durch die Subventionen der Gewerkschaft und der Gemeinde Wien sieht es zur Zeit so aus, als würden wir unser Ideal- und Plansoll von 44.000,- erreichen.
12.3.1995
Fastenpredigt in der Pfarre Am Kordon im 14. Bezirk. Christian predigt über die "Beziehungsarbeit" im Vinzenzhaus. Im Pfarr-Cafe informieren wir die Interessierten über PRO-95. Das PRO-95-Team bekommt die Sonntagskollekte: ca. 6.000,-.
19.3.1995
Fastenpredigt in der Pfarre St. Stephan in Baden bei Wien. Christian predigt über die christliche Auslegung des Wortes "Vielleicht". Die Pfarrgemeinde spendet über 6.000,- nach dem Gottesdienst. Auch bei diesem Termin ist das PRO-95-Team anwesend - außer Wolfgang K., der krank darniederliegt und Walter, der zuletzt auf Krisenintervention in Ybbs war, geht es psychisch weiterhin sehr schlecht. Zur Zeit ist unklar, ob er sich bis zum Sommer noch einmal erholen wird.
2.4.1995
Das PRO-95-Team, verstärkt durch Peter P., Pauline, Ludwig versammelt sich im Gruppenraum in der Gfrornergasse zu einem weiteren Arbeitsgespräch. Auch Walter ist wieder auf dem Damm. Zwei Punkte auf der Tagesordnung: die Organisation des Benefizkonzerts ("Konzert in der Kirche") und der Einstieg in Zwettl. Was den ersten Punkt anlangt sind wir auf Grund unserer Erfahrungen vom Klavierabend Profis. Die Aufgaben sind rasch verteilt. Der zweite Punkt, ein erster Lösungsvorschlag wird von Franz vorgestellt, wird kontroversiell debattiert: soll es bei sehr verschiedenen Vorschlägen zum Inhalt unseres Stückes zu einem Mehrheitsentscheid (Abstimmung) kommen oder soll man mehr Zeit in die Findung eines Konsens investieren? Soviel ist wahrscheinlich deutlich geworden: der Konsens wäre uns allen schon wichtig.
22.4.1995
Handzettel-Austeil-Aktion vor dem Musikverein (Ludwig , Sabine und Wolfgang K.)
23.4.1995
Handzettel-Austeil-Aktion vor dem Konzerthaus
30.4.1995
Aktionstag für das Benefizkonzert am 6. Mai. Wie schon beim ersten Benefizkonzert im November teilen wir am Vormittag vor der Pfarrkirche Ober-St. Veit Konzerteinladungen aus. Christian lädt "von der Kanzel" aus ein. Am Abend wird noch einmal in der Gfrornergasse eingeladen. In der Nacht (bis 2 Uhr früh) plakatieren wir in zwei Gruppen in ganz Hietzing. Auch ein kurzer und sehr überraschender Polizeikontakt bringt uns nicht wirklich aus der Ruhe. In der Zwischenzeit sind Konzertankündigungen im PROFIL- GUIDE, im Pfarrblatt Ober-St. Veit und in der dieswöchigen Kirchenzeitung erschienen. Eines beschäftigt uns in diesen Tagen ebenfalls intensiv: Christian hat - auf Grund eines Vorfalls mit dem Heimleiter - seine Kündigung per Ende Juni 1995 bei der Caritas deponiert. Momentan ist alles offen. Niemand weiß, wie es im Haus überhaupt weitergehen soll. Das ganze Mitarbeiterteam des Vinzenzhauses ist zerrissen. Wir glauben aber weiterhin an PRO-95.
6.5.1995
BENEFIZKONZERT in Ober St. Veit. Andi Forster und Alexandra Pölzlberger spielen ein gemischtes Programm für Flöte und Gitarre und finden großen Anklang. Die neugebaute Kapelle in der Pfarrkirche wird beinahe voll. Das Konzert geht an diesem lauen Frühlingsabend stimmungsvoll vonstatten. Abgesehen davon, daß uns vor dem Konzert bereits der Buffettisch in Brüche geht, gibt es keine Irritationen. Einnahmen: ca. 3.000,- Spenden. 16.5.1995 Wochenlange Auseinandersetzungen im Team des Vinzenzhauses haben dazu geführt, daß Harti Oberkofler beschlossen hat, seinen Heimleiterposten abzugeben. Jutta wird neue Heimleiterin. Christian bleibt noch bis nächstes Frühjahr. Auch PRO-95 ist gerettet.
9.7.1995
Vorbesprechung für alle TeilnehmerInnen in der Gfrornergasse. Einige TeilnehmerInnen haben sich von dieser Besprechung abgemeldet. Es ist sehr heiß in Wien. Wir sitzen in der Teestube, weil es im Gruppenraum nicht auszuhalten ist. Außerdem sind einige TeilnehmerInnen - mehr oder weniger überraschend ausgefallen - . Peter hat einen Totalabsturz erlebt, wahrscheinlich befindet er sich zur Zeit in Ybbs zur Krisenintervention. Harald muß im Zoo arbeiten, Walter muß nun - nach dem 5. Rückfall - wahrscheinlich doch ausziehen. ... Von einigen Interessenten ist noch nicht klar, ob sie doch mitfahren können. Ein Auf und Ab, wie es immer vor solchen Veranstaltungen war. Wir besprechen nicht nur die Modalitäten für die Fahrt nach Zwettl, sondern auch erste organisatorische Belange. Ernstl wird ein Plakat für die Aufführung am 19.8. erstellen und sich wegen Bühnenbauelementen im Metropol erkundigen. Michi und unser neuer Zivi(ldiener) Thomas werden uns mit den Bussen nach Zwettl chauffieren und auch wieder abholen. Eines ist klar: PRO-95 ist nicht mehr aufzuhalten. Wermutstropfen: Unverhofft werden wir damit konfrontiert, daß Harti die zugesagte PRO-95- Kostenübernahme (25.000,-) nicht ins Jahresbudget übernommen hat. Darüber sind wir nicht glücklich, aber die neue Heimleitung steht zu den gemachten Zusagen. Claudia hat vergangene Woche ihr Kind verloren. Walter muß bis Ende Juli ausziehen.
Ende Juli 1995
Ernstl hat das Plakat für die Aufführung am 19.8. entworfen. Christian und Ludwig vervielfältigen das Plakat und erstellen auch Handzettel, die mit der August-Aussendung mitgeliefert werden. Horst hat zugesagt, sich um die Bühnenelemente zu kümmern. Die Intervention beim Metropol durch Ernstl war leider erfolglos.
4.8. - 13.8.1995:
Arbeitsphase in Zwettl
Freitag, 4.8.1995
20 Personen kommen zum Abendessen im Bildungshaus Zwettl wohlbehalten an. Abgesehen davon, daß sich die Busse bei der Anreise nach KIosterneuburg verirrt haben, landen alle TeilnehmerInnen ohne Komplikation am Ort der Begegnung. Michael und unser Zivi Thomas haben die Busfahrten organisiert, Sabine, Birgit und Ernst sind mit den Privatautos unterwegs. Wir werden sie in der kommenden Woche für die Materialeinkäufe in Zwettl immer wieder brauchen. Nach dem Abendspaziergang, der nach kurzem Regenschauer am frühen Abend, doch stattfinden kann, moderieren Sabine und Birgit ein "warming up". Leute werden unter einem Tuch "gemischt", die Partner werden unter dem Tuch hervorgezogen. Es folgt ein Paarinterview, dessen Ergebnisse im Plenum präsentiert werden. Der Abend klingt aus mit Gesprächen, Musik und Nachtspaziergängen. Unsere tägliche Teamreflexion findet um Mitternacht herum statt.
Samstag, 5.8.1995
"Was könnten wir machen?" Mit dieser Frage beginnt unsere erste Gruppenarbeit (in vier Gruppen). Die Gruppen verteilen sich über das Stiftsgebiet und sammeln erste Ideenvorschläge. Freies Brainstorming. Diese Ideen werden noch vor dem Mittagessen vorgestellt, besprochen und sortiert. In der Nachmittagsarbeitsphase werden aus den vorhandenen Ideen drei Hauptideen (nun doch per Stricherl-Wertung) ausgewählt. Drei Gruppen werden gebildet, die Aufgabe bis zum Abendessen: Aus den drei Ideen soll ein Stück entworfen werden, eventuell schon mit konkreten Szenenentwürfen. Die zugrundeliegenden Begriffe/Ideen: Szenen am Westbahnhof, Ritterspiele und ein Sozialarbeiterdrama, in dem es darum geht, daß einE SozialarbeiterIn so gut "sozialarbeitet", daß sie/er sich schließlich überflüssig macht. Die Gruppen verteilen sich wieder auf Wiesen und Bänke. Das Arbeitsklima ist gut, und es entstehen mehr oder weniger drei szenische Gerüste. Mehr als wir für den ersten Arbeitstag erwartet hatten. Manche erleben dieses Tempo vielleicht auch als Streß. Schon am Beginn dieser Woche sind wir mit der Unterschiedlichkeit und den unterschiedlichen Grenzen der Persönlichkeiten konfrontiert. Am Abend erleben wir eine intensive Feedbackrunde, die bestimmt ist von psychischen Spannungszuständen einiger TeilnehmerInnen. Reinhard betont, daß er mehr Zeit braucht, um sich an Menschen, Ort und Aufgabe zu gewöhnen. Wolfgang S. kämpft schon seit einigen Tagen mit Depressionen bzw. Aggressionen, aber er spricht es in der Feebackrunde an, was uns alle etwas entlastet. Ossi erleben wir als verwirrt und verwirrend. Die abendliche Feedbackrunde hat er beinahe verschlafen. Wolfgang H. erscheint zur Feedbackrunde gar nicht. Freude jedoch haben wir alle am Besuch von Alfred, Brigitte und Josef. Der Abend endet mit einem lustigen Beisammensein in der Stiftstaverne. Alfred hat alle eingeladen. Niemand bleibt der Einladung fern.
Sonntag, 6.8.1995
Da einige die Hl. Messe besuchen wollen und einige den Wunsch nach Freiraum haben, beschließen wir, den Vormittag freizunehmen. Einige fahren zum Stausee Ottenstein, einige sind in der Messe, einige durchwandern die Zwettler Natur. Mit der Arbeitsbesprechung am Nachmittag beginnt die "Kompilation" der drei Szenen-Folgen, die am Vortag ausgearbeitet wurden. Per Abstimmung beschließen wir, daß eine Gruppe aus Interessierten aus den drei vorhandenen Stücken ein einziges formt. Diese Gruppe formiert sich auf dem Hauptarbeitsplatz, der Wiese vor dem Haus. Andere haben einen weiteren freien Nachmittag. Schon während des ganzen Tages verfolgen alle mit, daß es Wolfgang S. bedeutend schlechter geht. Allerdings erscheint er sehr wohl in der abendlichen Feedbackrunde und artikuliert seine depressive Verstimmung. Er hat außerhalb des Hauses getrunken und verheimlicht es uns in der Runde nicht. Die Reflexionsrunde des Leitungsteams dauert dieses Mal beinahe zwei Stunden. Aber es entstehen schon konkrete Arbeitspläne für den nächsten Tag. Eines ist uns klar: ab Montag muß handwerklich gearbeitet werden.
Montag, 7.8.1995
Nach der Arbeitsbesprechung im Plenum geht es los. Die Dramaturgiegruppe vollendet ihren Stückentwurf, der gestern noch nicht fertig geworden ist. Dennoch steht soviel fest: unser Werk wird 10 Szenen haben, im Mittelalter spielen und vier Bühnenhintergründe benötigen. Die andere Hälfte der Gruppe fährt in die Stadt, um die Einkäufe für die Bühnendekoration zu tätigen. Wolfgang S. ist wie neugeboren, er möchte die Bühnenbilder malen. Wir freuen uns, daß er seine Krise überstanden hat. Durch Wolfgang K. bekommen wir beim hiesigen Baumax günstige Konditionen für die Malutensilien. Am Nachmittag nimmt auch schon die Musikgruppe ihre Arbeit auf: Birgit, Sabine und Wolfgang S. werden Livemusik erarbeiten. Diesmal gehört der begehrte Wiesenarbeitsplatz vor dem Stift ihnen. Aus Baden wird ein Liedertext gefaxt. Wir erfahren, wie so oft in dieser Woche, daß das Bildungshauspersonal überaus kooperativ und geduldig mit uns ist. Nach dem Mittagessen beginnen im kleineren Saal (kurz "Probenraum") die Proben zu den ersten beiden Szenen. Der mittelalterliche Sozialarbeiter als "Streetworker" begegnet mittelalterlichen Saufbrüdern. Überraschenderweise hat sich ein Hauptdarsteller gefunden, der große Akzeptanz in der Gruppe hat: Ludwig. Er spielt den mittelalterlichen Sozialarbeiter, Pauline spielt seine keifende Gattin Gundi, Franz führt an diesem ersten Spieltag Regie, damit das Spiel in Gang kommen kann. Wolfgang H. arbeitet im Probenraum parallel zu den Proben an der Tonregie. Die Arbeit am Stück ist in Gang gekommen. Keiner zweifelt daran, daß es das Stück geben wird. Das Tempo und die Ernsthaftigkeit, mit der gearbeitet wird, ist einigen jedoch ein Problem. Wir werden daran erinnert, daß diese Woche eine "Arbeitswoche" und keine "Urlaubswoche" sein wird. Dienstag, 8.8.1995 Morgenbesprechung. An die mangelnde Pünktlichkeit der Teilnehmer müssen wir uns scheinbar gewöhnen. Der Wunsch, daß in der Nacht die Türen nicht zugeknallt werden, erinnert an Hausversammlungen in der Gfrornergasse. Der Arbeitstag steht im Zeichen der weiteren Szenenerarbeitung. Das Regieteam Franz und Ernst will bis zur 5. Szene vordringen. Darunter fällt auch die erste Probe der Walkürenszene von Birgit und Sabine, die für allgemeine Erheiterung sorgt. Wolfgang S. arbeitet am Zauberwald-Bühnenbild. Sylvia schreibt Texte für ihre Hexen-Szene und läßt sich dabei von Goethes Faust inspirieren. Giselher kämpft mit der Rolle des mittelalterlichen Arztes. Die Dekorationsgruppe um Christian bastelt an Walküren-Brustpanzern und Helmen. Ossi formt mit Hingabe die Papiermasché-Brüste. Gegen Abend kommt es zu einem Probenabbruch bei der Erarbeitung der Hexenszene. Ludwig und Sylvia finden spielerisch nicht zueinander. Beide sind darüber wenig glücklich. Beim abendlichen Feedback landen die meisten Wertungen bei den Begriffen: Spaß und Kreative Entladung. Die Stimmung ist trotz des Probenabbruchs konstruktiv. Wegen des hohen Tempos und der raschen Fortschritte beschließen wir, den Mittwoch Vormittag wieder freizunehmen. Am späteren Abend fällt für längere Zeit im gesamten Stiftsviertel der Strom aus. Wir tappen im dunkeln und wandern mit in der Kapelle entwendeten Kerzen in der Stiftsfinsternis herum. Wolfgang S. muß die Arbeit am Zauberwald für heute unterbrechen und ärgert sich. Die Finsternis führt uns alle im Clubraum zusammen. Lagerfeuerstimmung. Übermorgen wird Vollmond sein.
Mittwoch, 9.8.1995
Trotz des freien Vormittages wird stellenweise gearbeitet (Hexeneinmaleins, Liedtexte,...). Pauline näht am Beraterkostüm für Reinhard. Das Arbeitsgespräch um 14 Uhr 30 beginnt mit einer Überraschung. Ludwig hat es sich gut überlegt: er legt seine Rolle zurück, weil er - als Alkoholiker - Probleme hat, einen betrunkenen Alkoholiker zu spielen. Außerdem belastet ihn der Probenabbruch von gestern nachmittag. Nun hat er Schuldgefühle gegenüber der Gruppe. Dennoch gibt uns diese Situation eine gute Gelegenheit, unser Problemlösungsvermögen auszuprobieren. Spontan werden Peter und Ossi für die Hauptrolle vorgeschlagen. Die Entscheidung über die Rollenvergabe soll aber erst bei den Proben erfolgen. Nicht wenig beeindruckend ist die Offenheit, mit der über diese Umbesetzung im Plenum gesprochen wird. Das erste Bühnenbild (Zauberwald) liegt gegen Abend fertig im Altenburger Saal. Sarah und Günter helfen Wolfgang S. beim Malen. Im Clubraum werden die silbernen Superbrust-Panzer für die Walkürenszene fertiggestellt, div. Schilder werden gemalt. Die gestern nicht fertiggestellte Hexenszene wird fulminant durchgespielt. Die Liedertexte sind fertig. Beim Feedback (Stimmungsbarometer) kommt Zufriedenheit mit der Arbeit zum Ausdruck. Ludwig quält sich mit Schuldgefühlen, er meint noch einmal, die Gruppe im Stich gelassen zu haben. Nach dem Feedback wird weitergearbeitet.
Donnerstag, 10.8.1995
Nach zwei düsteren Tagen scheint wieder die Sonne. Eine "Eilsänfte" wird gebaut. Das Material dazu läßt sich in der Umgebung des Stiftes (Wald- und Kartonviertel) leicht "organisieren". Allerdings zeigt sich auch die Stiftsbelegschaft wieder von der konstruktiven Seite. Bühnenbild zwei und drei wird von Wolfgang S. vorgezeichnet und von Vorbeikommenden vollendet. Verwandeln wir das Stift in einen Misthaufen? Auf den eben erst restaurierten Böden malen, kleben und schneiden wir. Bis in den Wald dröhnt unsere Tonanlage. Wir überlegen uns, ob wir je wieder nach Zwettl kommen dürfen... Ossi bewährt sich in seiner Rolle. Er wird sie behalten. Pauline bezeichnet ihr Rollenspiel als "Psychotherapie". Da sie neben ihrer Probenarbeit auch noch die ganze Näharbeit erledigt, machen wir uns ein wenig Sorgen um ihren Gesundheitszustand. So versorgen wir sie mit Getränken, Gesellschaft und zwingen sie zu Pausen. Wolfgang K. versucht sich an der Nähmaschine. Am Nachmittag ergibt sich eine Probenpause. Einige toben high durch die Gegend. Statt des üblichen Feedbacks tanzen wir unseren "Hit" Sally Gardens. Danach trägt die Musikgruppe die erarbeiteten Lieder vor. Heute ist Vollmondnacht. Im Wolfgang-Zimmer im alten Trakt sammeln sich über 30 Fledermäuse (echte!). Ein kleines Fest.
Freitag, 11.8.1995
Das Bildungshauspersonal meint, wir wären eine "ruhige Gruppe", was nicht wenig Erstaunen bei uns auslöst. Um 16 Uhr 30 sind die Proben so weit gediehen, daß ein erster Durchlauf des gesamten Stücks über unsere Probebühne geht. Die Rückmeldungen gehen in Richtung Zufriedenheit. Dauer des ersten Durchlaufs: 55 min. Auch das vierte Bühnenbild ist trotz Wolfgangs Frisby-Unfall (Frisby-Turnier im Festsaal) fertig. Säulen, Hexenkessel und Kartonbaum sind vollendet. Die Materialien fanden wir wieder in der Stiftsumgebung. Böse Zungen sprechen bereits davon, daß wir "Mistkübel- Stierln" gehen. Zumittag besuchen uns Sabines Eltern. Sie bringen Stoffe für Kostüme aus Wien mit. Am Abend stoßen Alfons, Claudia und Markus zur Gruppe. Die Stimmung: so wie es sein soll, wenn sich ein Ganzes - über Umwege aber doch - "herausstellt". Statt des abendlichen Feedbacks wird ein zweiter Durchlauf des Stücks durchgeführt. In den Nach- und Nachtgesprächen taucht die heikle Frage auf, ob in den Szenenablauf ein Erzähler eingebaut werden sollte. Wolfgang K. könnte einen Hofnarr oder einen Bettelmönch spielen. Und: inwiefern sind die Hintergrundgeräusche (=Tontechnik) während der Dialoge störend? Sollten das Schlußlied nicht alle singen? Wir sind wohl alle ziemlich ausgebrannt, aber das "Werk" ist in den Mittelpunkt getreten. Heute beschäftigen uns weder Alkprobleme, Depressionen noch soziale Konflikte. Nur noch die kleineren unerschütterlichen Probleme bleiben uns erhalten: z. B., daß alle Mitwirkenden pünktlich zur Probe erscheinen. Disziplin haben wir wenig, und es geht doch. Zu später Stunde schneidern Sabine und Birgit ihre Walküren-Kostüme in der Kapelle ("weil dort der Boden noch sauber ist."). Eine Entheiligung oder auch eine Art Liturgie?
Samstag, 12.8.1995
Wir haben das Stück im Rücken. Und so dürfen wir uns auch diesen Vormittag freinehmen. In der Gruppe machen sich Erschöpfungserscheinungen bemerkbar. Sylvia und Christian bleiben den Tag im Bett. Die SchauspielerInnentruppe bringt es immerhin auf zwei Durchläufe des Werks. Abends werden bereits die Säle geräumt. Am Sonntag soll nichts mehr gearbeitet werden.
Sonntag, 13.8.1995 Um 10 Uhr 30
- der Zeitpunkt, an dem unser großes Feedback beginnen soll - machen wir die alte Erfahrung, daß wir es nicht schaffen, alle pünktlich an einem Ort zu sein. Dennoch: die Rückmeldungsrunde findet statt. Nach dem Mittagessen treten wir die Heimreise an. Einige fahren der nötigen Erholung entgegen, andere kämpfen mit dem Abschiednehmen.
14.8. - 19.8.1995:
Arbeitsphase im Vinzenzhaus
Dienstag, 15.8.1995
Um 14 Uhr herum erste Probe im Vinzenzhaus. Harald hat den Bühnenvorhang montiert. Wir spielen schon in einem Anhauch von Dekoration. Sylvia ist leider noch krank. Christian muß als Hexe einspringen. Wir kämpfen mit Requisiten und Kostümen - im ungewohnten und größeren Raum verschwinden ständig Gegenstände. Außerdem haben wir bereits sehr viele Requisiten und Kostüme. Am Abend liefert Thomas die Lichtanlage. Die Kapelle wird zu einem Requisitenkammerl. Sakrilege sind bei dieser Produktion scheinbar nicht zu vermeiden. Ein Erzähler hat sich gefunden. Harald wird einen schwarzen Mönch spielen, der die Handlung des Stücks begleitet und Überleitungen schafft. Außerdem nimmt er sich des Bühnenbaus an. Ein Glücksfall. Christian und Pauline werden mit Kostümwünschen überhäuft. Bis zur Probe am Freitag soll alles vorhanden sein. Nach der Probe folgt eines der endlos langen Arbeitsgespräche. Wir beschließen, nach der Aufführung am Samstag uns eine "Premierenfeier" zu gönnen.
Mittwoch, 16.8.1995
Christian gebiert die Idee, die Vorrede in Versen zu sprechen und das im Kostüm eines Hofnarren - eine neue Idee für's Stück.
Freitag, 18.8.1995
Claudia, Franz, Christian und Markus holen die bereitgestellten Klick-Bühnen vom Volksoperndepot Stadtbahnbogen. Ing. Bättig von der Volksoper zeigt sich als sehr aufgeschlossen. Er entführt Christian auf den Schnürboden der Volksoper - andere Dimensionen. Der Transport der Bühnenteile erweist sich als körperliche und technische Schwierigkeit. Die Teile sind nicht nur sperrig, sondern auch noch schwer. Dennoch ist die Bühne noch vor dem Mittagessen im Kapellenraum. Am Nachmittag montieren Franz und Ernst die Lichtanlage. Christian schreibt und vervielfältigt die Programmhefte. Nach dem Abendessen findet die "Lichtprobe" statt, ein Durchlauf, bei dem man sich auf die neuen bühnentechnischen Gegebenheiten einstellen kann. Sylvia, unsere Hexe, ist wieder gesund. Da Birgit und Reinhard für diese Probe verhindert sind, springt Christian als Berater ein. Sabine muß wegen Partnermangel den Walkürenkampf gegen sich selbst spielen, und so ersticht sie sich eigenhändig auf offener Bühne. Ein Psychodrama nebenbei. Zwei Rollen sind inzwischen noch dazugekommen: Harald spielt den Erzähler (Bettelmönch Haraldus) und Christian den Hofnarr, der einleitende Worte in Versform vorträgt. Um 22 Uhr 15 trifft die Polizei im Haus ein. Die Anrufe der Nachbarn häuften sich. Tonanlage und offene Fenster haben wir übersehen. Niemand wird verhaftet. Trotz vieler Unterbrechungen eine hoffnungsvolle Probe.
Samstag, 19.8.1995
Ab 14 Uhr 30 treffen die SchauspielerInnen und Techniker ein. Eine der neuen Lampen in der Kapelle ist in Brüche gegangen. (Kunst kostet Geld). Harald, unser Erzähler, befindet sich aufgrund von Diebstählen im Haus in einer katastrophalen Verfassung. Zunächst will er seine Rolle nicht spielen. Nach einigen Gesprächen geht's dann doch (und wir haben wieder eine Krise bewältigt). Wolfgang S. kommt mit Krücken zur Probe. Es geht ihm gesundheitlich sehr schlecht. Diese Woche mußte er wegen seines kaputten Fußes ins Spital. Aber er würde er seine Rolle nie schmeißen. Christian betätigt sich nun auch als Inspizient hinter der Bühne. Er soll den Bühnenumbau organisieren. Er leistet damit Pauline, Sylvia, Günter und Peter hinter der Bühne Gesellschaft. Diese sechs sehen das ganze Stück erst auf Video. Die Generalprobe geht ab 16 Uhr inspiriert und mit wenigen Unterbrechungen über die Bühne. Wir wissen es jetzt schon: die Sache klappt. Alle Schauspieler sind bestens gestimmt. Ab 19 Uhr treffen die Publikumsmassen ein. Wir haben nicht mit einem solchen Andrang gerechnet. Nicht alle bekommen einen Sitzplatz, einige sehen wenig bis gar nichts, weil kein Platz mehr ist. Die Zusammensetzung des Publikums ist überraschend: Viele ehemalige MitarbeiterInnen sind gekommen, MitarbeiterInnen aus der Blindengasse, ArbeitskollegInnen unserer SchauspielerInnen, Ex-Hausbewohner (Mitwirkende vom letzten Theaterprojekt!), aber auch VertreterInnen der Caritas-Zentrale, der SOZAK und PÄDAK sind anwesend. Um 20 Uhr 10 geht's los. Das Stück dauert heute ca. 90 min. Die Stimmung ist inspiriert. Alle geben ihr bestes. Zusätzliche Texte und Pointen werden erfunden. In der Streitszene von Ossi und Pauline tauchen plötzlich "gefüllte Radieschen" auf. Als Sabines Walkürenschwert während des Kampfes zerspringt, haben wir einen neuen unerwarteten Bühneneffekt. Auch der erste Umbau, bei dem das Bühnenbild beinahe verkehrt aufgehängt wird, bringt Lacher. Und auch die nehmen wir dankbar entgegen. Hans geht während einer der Sandlerszenen sein Partner verloren. Er hat seinen Auftritt einfach vergessen. Zwei harte Minuten verbringt er alleine auf der Bühne und improvisiert den Monolog vom verlassenen Saufbruder - eine Sternstunde dieses Abends. Wolfgang S. verletzt sich während der Krankenhausszene. Giselher hat für heute nicht nur Lampenfieber, sondern einen zusätzlichen Text mitgebracht, der von Anspielungen voll ist, die wohl niemand gleich versteht. Sie verleihen unserem Werk ein Stück Komplexität und Intellektualität. Alles in allem dürften wir es geschafft haben, die Komplexität unserer Gruppe in unserer theatralischen Collage darzustellen. Unser Stück ist wie wir, ein Spiegel unseres Wahnsinns, unserer Sehnsüchte, unserer Grenzen. Nach der Aufführung häufen sich die Anregungen, das Stück ein weiteres Mal aufzuführen. Der Abend endet mit einer kleinen Premierenfeier in einem nahegelegen Lokal. Glückliche und gelöste Gesichter. Allen ist bewußt, daß wir ein großes Werk vollbracht haben. Wir haben die "persönlichen Geschichten" hintangestellt und optimal kooperiert. Wir haben einen uns nicht vertrauten Bühnenapparat bewältigt, wir haben ein komplexes Stück auf die Beine gestellt. Mit 18 Schauspielern auf der Bühne haben wir einen größeren schauspielerischen Aufwand als die meisten Burgtheaterstücke. Wir haben bei dieser Aufführung nicht nur einen vorbereiteten Text interpretiert, sondern Situationen, Dialoge und Pointen erfunden. Wir haben es geschafft, daß noch während der Uraufführung der kreative Prozeß zu erkennen und zu spüren war. Wir lachen über die Fehler und Irrtümer, die während der Aufführung passiert sind. Viele von uns haben in den letzten 14 Tagen Lebenserfahrungen gemacht. Wir haben uns ertragen und getragen. Wir haben uns Hände gereicht. Wir haben uns gegenseitig in unserer Kreativität angespornt und dabei unsere Grenzen erfahren. Alles das ist bei der Premierenfeier zu spüren. Über der Müdigkeit steht die Zufriedenheit mit all dem, was wir gemeinsam geschafft haben.
Sonntag, 20.8.1995
Der ganze Tag steht im Zeichen des Bühnenabbaus. Franz, Christian, Günter, Pauline, Wolfgang K. bringen im Laufe des Tages die ganze Bühne zum Verschwinden. Das Projekt neigt sich dem Ende zu.
Montag, 21.8.1995
Licht und Bühnenteile werden retourniert.
Sonntag, 10.9.1995
Der Videofilm der Aufführung wird präsentiert. Eine Versammlung, der interessierten SchauspielerInnen in der Gfrornergasse.
8.2. "So ein Theater" - Inhalt, Rollen und ihre DarstellerInnen
Irgendwo in einem Mittelalter der Gegenwart, der Vergangenheit und vielleicht auch der Zukunft. Ein Marktplatz, ein Ort, an dem Reisende ankommen und abreisen. Zwei Vagabunden, immer auf der Suche nach Arbeit, einer Flasche Schnaps und einem Extragulden, hat es hierher verschlagen. Bettelnd!
In dieser Welt von gestern, heute und morgen treibt sich auch ein Sozialarbeiter herum. Einer, der über die Theorie der Ausbildung hinausgehen will, der sich in allen Ecken des Elends herumtreibt, um so die Probleme in ihrer vollen Realität und Härte zu erfassen, zu erleben. Dabei immer Lösungsmöglichkeiten suchend - dabei immer helfen wollend. In seinem Eifer, sich anderen zu widmen, sieht er nicht wie neben ihm seine Frau an seiner Vernachlässigung zugrunde geht. Wie sie immer mehr dem Alkohol verfällt. All seine Versuche zu helfen, zu schlichten und auszugleichen, schlagen in dieser Welt der vielen Zeiten fehl. Dann aber erfährt er von den Vagabunden von einem möglichen Weg. Da soll es einen Zauberwald geben, eine Hexe die Wunder wirken kann ... Unsicher macht er sich auf den Weg und tatsächlich trifft er auf die Magierin. Er erhält von ihr das ersehnte Elixir. Dieses Mittel wirkt wahre Wunder - es dauert nicht lange, die Wunder sprechen sich herum, und es kommt zu einem großen Freudenfest.
Alle sind nun glücklich und zufrieden! Nun, genau gesagt - fast alle! Siggi's Frau trinkt mehr denn je, und auch die Obrigkeit, die Eminenzen und die reichen Händler sind mit der Situation nicht zufrieden. Das glückliche Volk ist ohne Neid, aber auch ohne Ehrgeiz ... es strebt nicht mehr nach Macht über die anderen, es läuft nicht mehr den Gulden hinterher, es ist ohne Angst und Unterwürfigkeit.
Es dauert nicht lange und "Siggi", so heißt der Sozialarbeiter in unserer Geschichte, wird zu den Obrigkeiten zitiert. Er ist es, der das große Glück in die Welt brachte - nun soll er dafür sorgen, die öffentliche Ordnung wieder herzustellen, denn dieser Zustand kann in keinem Fall toleriert werden. Die sich leerenden Kassen müssen sich wieder füllen. Die hohen Herren drohen Siggi aus dem Amte zu jagen ... Die Angst um seine Position treibt Siggi nun dazu, wieder das "Böse" in die Welt zu tragen. Gegen seine Überzeugung wird er zum Anstifter und Verführer - und er ist geschickt in dieser Intrige, die sein Auskommen retten soll. Es ist alles wie es war - die Welt nun wieder voller Lug und Trug - voll Neid und Gier. Es ist wieder wie es war, wie es ist und wie es wahrscheinlich immer sein wird. Traurig und deprimiert zieht sich Siggi in den Wald zurück. Er, der nur Glück bringen wollte, und nun das Böse bringen mußte, bleibt einsam zurück. Flötespielend auf einem Baumstumpf sitzend trägt er seine Träume zu Grabe...
8.2. Rollen und ihre DarstellerInnen:
| Sigesmund, Sozialarbeiter im Dienste des Grafen | Ossi Grötzer |
| Gundi, sein Weib | Pauline Eichinger |
| Erzähler | Harald Fetz-Heim |
| Hofnarr | Christian Wetschka |
| Sandler I | Hans Krasensky |
| Sandler II, Gnom im Dienste der Hexe | Herbert "Wichtel" Reich |
| Hexe | Sylvia Prochaska-Eberl |
| Elfe | Sarah Habres |
| Graf, Zuhälter II | Ludwig Zeissner |
| Fahrgast, Tourist, Bandlkramer, Bischof | Robert Mayerhofer |
| Berater | Reinhard Seisenbacher |
| Arzt, reicher Tuchhändler | Giselher Horner |
| Patient | Wolfgang Schrenk |
| Krankenschwester, Walküre I | Birgit Habres |
| Walküre II, Gundis Freundin Brunhilde | Sabine Schweizer |
| Sänftenträger I, Zuhälter I | Peter Steiner |
| Sänftenträger II | Wolfgang Kieberger |
| Günter Gepp | Lustknabe |
| Musiker, Sänger, Lied-Texte | Ossi Grötzer, Birgit Habres, Wolfgang Kieberger,Sabine Schweizer |
| Bühnenbild, Maske, Kostüm |
Pauline Eichinger, Wolfgang Schrenk, |
| Tontechnik | Wolfgang Hübner |
| Licht, Regie, dramaturgische und dramatische Koordination | Ernst Asenbauer, Franz Aigner |
Abschließend möchte ich einen Leitspruch aus dem Munde unseres Hauptdarstellers Ossi anfügen, der im Kontext der Alkoholprobleme unserer KlientInnen große Bedeutung hat:
"Heutzutage zählen nur mehr zwei Werte: Einkehr und Besinnung. - Zuerst kehrst Du ein und dann verlierst Du die Besinnung." DSA Siggi, alias Ossi, in "So ein Theater"99
1 Evréinoff, N.: "Das Theater im Leben" - nach Pignarre, R.: "Geschichte des Theaters", S. 7
2 Stark, W.: "Empowerment", S. 17 - Fußnote
3 Übersetzung: "Es war einmal eine Gesundheitsarbeiterin, die sich an einem reißenden Fluß ^ befand, als sie einen Hilferuf hörte. Sie sprang sofort in den Fluß, zog den Mann ans Ufer und beatmete ihn künstlich. Gerade als er zu atmen begann, hörte sie einen weiteren Hilferuf, also sprang sie zurück in den Fluß, zog den Mann ans Ufer und beatmete ihn künstlich. Gerade als er zu atmen begann, hörte sie einen neuerlichen Hilferuf, also sprang sie zurück in den Fluß. Jetzt war sie so damit beschäftigt hineinzuspringen, an das Ufer zu ziehen und künstlich zu beatmen, daß sie keine Zeit hatte nachzusehen, wer - verdammt noch einmal - all diese Leute stromaufwärts heineinstieß." - Zola, I.K.: "The politicization of the self-help movement", Social Policy, Fall 1987, S. 32-33; nach Stark, W: "Empowerment", S.11
4 vgl. Boal, A.: "Theater der Unterdrückten", S.48
5 vgl. Rogers, C.R..: Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, S. 34ff
6 Rogers, C.R..:"Gesprächspsychotherapie", S. 34
7 vgl. Rogers, C.R.: "Die Kraft des Guten"
8 Rogers, C.R.: "Gesprächspsychotherapie", S. 35
9 Aus der Suchtforschung gibt es über Jahrzehnte verstreut verschiedene Angaben zur Rückfälligkeit. Für den Alkoholismus verweise ich auf das Standardwerk von J. KÖRKEL (Hrsg.) "Der Rückfall des Suchtkranken", dort wird der Forschungsstand bis in die 90er Jahre hinein zusammengefaßt. Daraus ergibt sich für den Alkoholismus eine durchschnittliche Rückfallsquote von 80 %.
10 Wilson Schaef, Anne: "Im Zeitalter der Sucht", S. 43
11 Stark, W.: "Empowerment", S. 17
12 Faltermaier, T.: "Lebensereignisse und Alltag", Profil, München 1987, S. 35ff - nach Stark, W.: "Empowerment", S. 95
13 Stark, W.: "Empowerment", S. 95f
14 vgl. Pearlin, L./Schooler, C.: "The structure of coping", Journal of Health and Social Behaviour, 19, 1-21; 1978 - nach Stark, W.: "Empowerment", S. 96
15 vgl. Thomae, H.: "Das Individuum und seine Welt. Eine Persönlichkeitstheorie"; Hogrefe, Göttingen 1968 - nach Stark, W.: "Empowerment", S. 96
16 Antonovsky, A.: "Meine Odyssee als Stressforscher." In: Jahrbuch für kritische Medizin 17, Berlin 1991, S. 112-130 - nach Stark, W.: "Empowerment", S. 96
17 Stark, W.: "Empowerment", S. 98
18 Stark, W.: "Empowerment", S. 100
19 Herriger, N.: "Kompetenzdialog - Empowerment in der sozialen Einzelhilfe", S. 28
20 Herriger, N.: "Kompetenzdialog", S. 29
21 Im Kontext der Persönlichkeits- bzw. Motivationspsychologie ist dieser Prozeß ein Fortschreiten von externer Attribution (Außensteuerung) zur internen Attribution (Selbststeuerung) zu bezeichnen. SELIGMANN hat in diesem Kontext die "Theorie der gelernten Hilflosigkeit" aufgestellt. Empowerment ist jener Prozeß, der zur Über- windung der gelernten Hilflosigkeit führt und externe Attributionen zugunsten von interner Selbstregulierung ermöglicht. Vgl. dazu Herkner, W.: "Psychologie", S. 312ff
22 vgl. Spitzy, C.: "Skriptum zur Gemeinwesenarbeit", Anhang 1+2
23 Beispiele für derartige Eigendynamiken finden sich gegenwärtig in der Kirchenvolksbe- gehrensbewegung, in der Frauenbewegung, im Naturschutz, etc.
24 vgl. Fleisch, A.: "Entwicklungspsychologie und Erziehungslehre", S. 99f und Herkner, W.: "Psychologie", S. 390ff
25 Zembaty, A.: "Sozialarbeit und Öffentlichkeitsarbeit" in "Neue Kriminalpolitik" 3/94, S. 37 und vgl. auch Neises, G.: "Ohne Beweggründe keine Öffentlichkeitsarbeit" in "Sozialarbeit" 94/92, S.42f und "Sozialmagazin" 3/94 - LeserInnenbefragung vom September 1993
26 vgl. Pkt. 6.2.2. - Interview mit Mag. C. Wetschka
27 Marcus, St.: "Their brother's keepers: an episode from english history". In: Gaylin, W.: Lasser, I; Marcus, S.: Rothman, D.J. (eds): Doing Good. The Limits of Benevolence. Pantheon Books, New York,1978; - aus Stark, W.: "Empowerment", S. 30
28 Wilson Schaef, Anne: "Co-Abhängigkeit", S. 53ff und "Im Zeitalter der Sucht", S. 36ff
29 Wilson Schaef, Anne: "Co-Abhängigkeit", S. 42
30 vgl. Wilson Schaef, A.: "Im Zeitalter der Sucht", S. 47ff
31 PRO-95: "So ein Theater" - Auftrittsmonolog des Hofnarren
32 V. E. Frankl nennt immer wieder drei Dimensionen, in denen menschliches Dasein Sinnerfüllung findet: Erleben, Erschaffen und Erleiden. Herausragend ist in seinem Ansatz, daß der Mensch jeder Lebenssituation, und so auch der leidvollen, einen Sinn geben kann. Dies geschieht meist dadurch, daß der Betroffene die leidvolle Situation (bei Frankl war es das Konzentrationslager) als Aufgabe annimmt.
33 Huizinga, J.: "Homo Ludens", S. 11f
34 vgl. Colloredo-Mannsfeld, T.: "Theater in der Sozialarbeit", S. 15ff
35 vgl. Vater, Gudrun: "Psychodrama" nach Stumm G./Wirth B.: "Psychotherapie - Schulen und Methoden", S. 136ff; Ruch, F.L./Zimbardo, P.G.: "Lehrbuch der Psychologie", S. 478ff; Strotzka, Hans: "Psychotherapie und Tiefenpsychologie", S. 82ff; Keller, J.A./Novak F.: "Kleines Pädagogisches Wörterbuch", S. 292f; Petzold, H.G.: "Dramatische Therapie", S.13ff und "Psychodrama-Therapie", S. 24ff
36 Moreno, J.L. (1970) - nach Vater, Gudrun: S. 138
37 Man kann sagen, daß Psychodrama ein Versuch ist, den Dualismus zwischen Phantasie und Realität auf zuheben und die ursprüngliche Einheit wiederherzustellen. Moreno, J.L. (1964) nach Vater, Grudrun: S.136
38 Vater, Gudrun: S. 138
39 U. LAMBROU beschreibt in ihrem Buch Rollen als Überlebensmuster. Sie unterscheidet bei in Alkoholikerfamilien aufgewachsenen Kindern die Rollen: das Chamäleon, der Macher, das unsichtbare Kind, der Sündenbock und das unterhaltsame Kind. Vgl. Lambrou U.: "Familienkrankheit Alkoholismus", S. 138ff
40 Moreno, J.L. : "Gruppenpsychotherapie", S. 78 - nach Ottomeyer, K.: "Lebensdrama und Gesellschaft", S. 43
41 vgl. Iljine, V.N. 1909 - nach Petzold, H.G.: "Psychodrama-Therapie", S. 24
42 vgl. Petzold, H.G.: "Einführung - Dramatische Therapie"S. 11 in Petzold, H.G. (Hrsg.): "Dramatische Therapie"
43 Petzold, H.G.: "Psychodrama", S. 26
44 Petzold, H.G.: "Psychodrama", S. 27
45 aus einem Gespräch mit Barbara Guwak, klinische Psychologin, Wien, 2.2.1997
46 vgl. Petzold, H.G.: "Psychodrama", S. 126 ff
47 Petzold, H.G.: "Psychodrama", S. 127f
48 vgl. Pilkey 1961 - aus Petzold, H.G.: "Psychodrama", S. 128
49 Boal, A.: "Theater der Unterdrückten - Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht- Schauspieler", S. 164
50 vgl. Boal, A.: "Theater der Unterdrückten", S. 9
51 Lindenthal, Peter: "Teatro Popular", S. 3f
52 vgl. Lindenthal, Peter: "Teatro Popular", S. 4
53 Boal, A.: "Theater der Unterdrückten", S. 164f
54 vgl. Spinu, M./Thorau, H.: "Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-Schau- spieler - Vorwort" nach Boal, A.: "Theater der Unterdrückten", S. 171ff
55 Boal, A.: "Theater der Unterdrückten" S. 87f
56 Thorau, H.: "Augusto Boal und Die Probe auf die Zukunft" - nach Boal, A.: "Theater der Unterdrückten", S. 14f
57 Thorau, H.: "Augusto Boal" - nach Boal, A.: "Theater der Unterdrückten", S. 14
58 Boal, A.: "Theater der Unterdrückten", S. 30ff
59 Boal, A.: "Theater der Unterdrückten", S. 54
60 Boal, A.: "Theater der Unterdrückten", S. 60f
61 nach Lindenthal, P.: "Das Teatro Popular", S. 1
62 Lindenthal, P.: "Teatro Popular", S. 5
63 vgl. Interview mit Norbert Tauber in "Zusammenhang" Nr. 2/Dez.1996, S. 10f
64 vgl. Pkt. 6.2.1. - Interview mit Dr. J. Guttmann, Wien am 12.2.1997
65 vgl. auch meinen Praktikumsbericht über das vierwöchige Kurzzeitpraktikum vom Juni 1995, das ich im Vinzenzhaus absolviert habe und wo ich weitreichenden Einblick in die Belange des Hauses gewinnen konnte.
66 vgl. Pkt. 6.2.1. - Interview mit Dr. J. Guttmann
67 Friedrich Schiller z.B. hat das Theater als eine "moralische Anstalt" bezeichnet. Diese Ansicht wurde vielfach kritisiert und ist heute auch nicht mehr haltbar. Ethik ist sicherlich eine Dimension des Theaters, Theater ist aber primär ein ästhetisches Phänomen, unter das die Moral untergeordnet wird. Dies gilt auch für das epische Theater.
68 Brecht, B.: "Schriften zum Theater" Bd.3, S. 45ff
69 Brecht, B.: "Schriften zum Theater", S. 55
70 Gepp, G.: Projektbericht PRO-95, S. 42
71 Krasensky, H.: PRO-95, S. 44
72 Zeissner, L.: PRO-95, S. 50
73 Eichinger, P.: PRO-95, S.50
74 vgl. Pkt. 6.2.1. - Interview mit Dr. J. Guttmann
75 Keller, J.A./Nowak, F.: "Kleines pädagogisches Wörterbuch", S. 218f
76 vgl. Preiser, S.: "Kreativitätsforschung"
77 SCHUMANN weist darauf hin, daß Kreativität dann zustande kommt, wenn rechte und linke Gehirnhälfte mit all ihren Funktionen zusammenwirken. Daraus ergibt sich eine vertiefte Begegnung mit der Umwelt (R. MAY), eine "Liebe zum Objekt" (J.S. BRUNER) und eine erhöhte Anpassungsfähigkeit des Ichs (E. LANDAU). - vgl. Schumann, H.E.: "Gezielt Helfen", S. 270ff
78 vgl. Kraft, H. (Hrsg.): "Psychoanalyse, Kunst und Kreativität heute"
79 Winnicott, D.: "Kreativität und ihre Wurzeln" nach Kraft, H.: "Psychoanalyse", S. 69
80 Franzke, E.: "Der Mensch und sein Gestaltungserleben", S. 20
81 PREISER bringt in seinem Buch eine vergleichende Zusammenstellung der verschiedenen Phasentheorien zum kreativen Prozeß von 1910 bis 1960. - vgl. Preiser, S: "Kreativitätsforschung", S. 42 ff
82 Kast, V.:"Der schöpferische Sprung", S. 24ff bzw. vgl. auch Schumann, E.H.: "Gezielt helfen", S. 271
83 vgl. Pkt. 6.2.2. Interview mit Mag. C. Wetschka, Wien am 31.1.1997
84 vgl. Preiser, S.: "Kreativitätsforschung", S. 87ff
85 Preiser, S.: "Kreativitätsforschung", S. 92f
86 vgl. Pkt. 6.2.3. - Interview mit L. Zeissner
87 Habres, B.: PRO-95, S. 29
88 Das sind BesucherInnen der Teestube, der Meßvorbereitungsgruppe, VolontärInnen, und ehemalige Hausbewohner.
89 vgl. Pkt. 6.2.2. - Interview mit Mag. C. Wetschka
90 PRO-95: Projektbericht, S. 19
91 vgl. Pkt. 6.2.3. -Interview mit L. Zeissner, Wien am 22.1.1997
92 Schweizer, S.: PRO-95, S. 55
93 vgl. Pkt. 6.2.3. - Interview mit L. Zeissner
94 vgl. BAS Wien 10 :"PUPPE - Leitfaden für Projektentwicklung", S. 35ff und S. 83ff
95 PRO-95: "Projektbericht", S. 5
96 Von Mag. Wetschka früher durchgeführte offene Gruppe, die einmal pro Woche zusammentraf, um sich mit Persönlichkeit, Glauben, Leben, etc. auseinanderzusetzen. Die Arbeitsmethoden beinhalteten immer sehr viel Kreativität. Meßvorbereitung hieß es deshalb, weil es sich im Laufe der Jahre aus der Runde zur Vorbereitung der sonntäglichen Hausmesse entwickelt hatte.
97 nach Colloredo-Mannsfeld, T.: "Theaterarbeit in der Sozialarbeit", Eingangszitat
98 Nestriepke,S.: "Das Theater im Wandel der Zeit.", S. 527 - nach Colloredo-Mannsfeld, T.: "Theater in der Sozialarbeit", S. 50
99 PRO-95: "Projektbericht", S. 28
-
- AGB-Arbeitsgemeinschaft für Gruppen-Beratung: "Das Methoden-Set", Band 1- 5, AGB-Vlg., Linz 1993
- ALBRECHT, Günter/SPECHT, Thomas/GOERGEN, Guido/GROSSKOPF, Helga: "Lebensläufe - Von der Armut zur Nichtseßhaftigkeit oder wie man Nichtseßhafte macht", VSH-Vlg. Soziale Hilfe, Bielefeld 1990
- BATZ, Michael/SCHROTH, Horst: "Theater zwischen Tür und Angel, Handbuch für Freies Theater", Rowohlt-Vlg., Reinbek 1985
- BRECHT, Bertold: "Schriften zum Theater", Bd. 3, Suhrkamp-Vlg., Frankfurt/ Main 1963
- BOAL, Augusto: "Theater der Unterdrückten - Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht- Schauspieler", Edition Suhrkamp, Frankfurt/Main 1989
- BRAUNECK, Manfred: "Theater im 20. Jahrhundert", Rowohlt-Vlg., Reinbek 1982
- COLLOREDO-MANNSFELD, Theresita: "Theater in der Sozialarbeit", Diplomarbeit, BAS Wien 1993
- FITTKAU, Bernd/MÜLLER-WOLF, Hans-Martin/SCHULZ V. THUN, Friedemann: "Kommunizieren lernen (und umlernen)", Agentur Pedersen Vlg., Westermann 1977
- FLEISCH, August: "Entwicklungspsychologie und Erziehungslehre", Vlg. Franz Deuticke, Wien 1982
- FRANZKE, Erich: "Der Mensch und sein Gestaltungserleben", Vlg. Hans Huber, Bern 1977
- GRONEMEYER Marianne: "Die Macht der Bedürfnisse", Rowohlt-Vlg., Reinbek 1980
- GROTOWSKI, Jerzy: "Für ein armes Theater", Orell Füssli-Vlg., Zürich 1986
- HARRIS, A. Thomas: "Ich bin o.k. Du bist o.k.", Rowohlt-Vlg., Reinbek 1988
- HERKNER, Werner: "Psychologie", Springer-Vlg., Wien 1986
- HERRIGER, Norbert: "Empowerment - Annäherungen an ein neues Fortschritts- programm der sozialen Arbeit" in: Sozialmagazin Nr. 7/91, o.O. 1991; S.26-34
- HERRIGER, Norbert: "Empowerment in der sozialen Arbeit", Unterlagen f. Fort- bildungsseminar: Quo vadis, Sozialarbeit?, o.O. 1993
- HERRIGER, Norbert: "Empowerment - oder: Wie Menschen Regie über ihr Leben gewinnen" in: Sozialmagazin Nr. 3/95, o.O. 1995; S. 34-40
- HERRIGER, Norbert: "Empowerment und das Modell der Menschenstärken. Bausteine für ein verändertes Menschenbild der Sozialen Arbeit" in: Soziale Arbeit Nr. 5/95, o.O. 1995; S. 155-162
- HERRIGER, Norbert: "Empowerment und gelingendes Lebensmanagement" in: SUB "Sozialarbeit" Nr. 2/94, VBSA, Wien 1994
- HERRIGER, Norbert: "Kompetenzdialog. Empowerment in der sozialen Einzelhilfe" in: Soziale Arbeit Nr. 6/96, o.O. 1996; S.190-195
- HUIZINGA, Johan: "Homo Ludens", Rowohlt-Vlg., Reinbek 1987
- KAST, Verena: "Der schöpferische Sprung - Vom therapeutischen Umgang mit Krisen", DTV, München 1989
- KELLER, Josef A./NOVAK, Felix: "Kleines pädagogisches Wörterbuch", Herder Vlg., Freiburg i. Breisgau 1993
- KÖRKEL, Joachim (Hrsg.): "Der Rückfall des Suchtkranken - Flucht in die Sucht?", Springer-Vlg., Berlin 1988
- KRAFT, Hartmut (Hrsg.): "Psychoanalyse, Kunst und Kreativität heute - Die Entwicklung der analytischen Kunstpsychologie seit Freud", DuMont Vlg., Köln 1984
- KRAMER, Michael: "Authentisches Theater, Theater der sozialen Prozesse", Burckhardthaus- Laetare Vlg, o.O. 1989
- KREFT, Dieter/MIELENZ, Ingrid: "Wörterbuch Soziale Arbeit/Sozialpädagogik", Beltz-Vlg., Weinheim-Basel 1985
- LAMBROU, Ursula: "Familienkrankheit Alkoholismus - Im Sog der Abhängigkeit", Rowohlt-Vlg., Reinbek 1993
- LANDWEHR Rolf/BARON Rüdiger: "Geschichte der Sozialarbeit", Beltz-Vlg., Weinheim 1991
- LINDENTHAL, Peter: "Das Teatro Popular", Skriptum BAS Wien 1996
- MÜLLER, Siegfried/OTTO, Hans-Uwe/PETER, Hilmar/SÜNKER, Heinz: "Handlungskompetenz in der Sozialarbeit/ Sozialpädagogik", Band I und II, AJZ-Druck & Verlag, Bielefeld 1982
- NEISES, Gerd: "Ohne Beweggründe keine Öffentlichkeitsarbeit" in Sozialarbeit Nr. 94/92, o.O. 1992, S. 42f
- OTTOMEYER, Klaus: "Lebensdrama und Gesellschaft", Vlg. Franz Deuticke, Wien
- PETZOLD, Hilarion G. (Hrsg.): "Dramatische Therapie", Hippokrates-Vlg., Stuttgart 1982
- PETZOLD, Hilarion G.: "Psychodrama-Therapie", Junfermann-Vlg., Paderborn 1985
- PIGNARRE, Robert: "Geschichte des Theaters", Vlg. Johannes Maria Hoeppner, Hamburg o.J.
- PREISER, Siegfried: "Kreativitätsforschung", Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1976
- PRO-95: Projektbericht "So ein Theater...", PRO-95, Caritas-Wien 1995
- PUPPE: "Leitfaden für Projektentwicklung", Projektarbeit, BAS Wien 1995
- RAUCHFLEISCH, Udo: "Begleitung und Therapie straffälliger Menschen", Matthias-Grünewald-Vlg., Mainz 1991
- ROGERS, Carl R.: "Klientzentrierte Gesprächspsychotherapie", Fischer- Vlg., Frankfurt/Main 1991
- RUCH, F.L./ZIMBARDO P.G.: "Lehrbuch der Psychologie", Springer-Vlg., Berlin 1974
- SCHUMANN, Hanna E.:"Gezielt helfen", Rowohlt-Vlg., Reinbek 1980
- SCHWÄBISCH, Lutz/SIEMS, Martin: "Anleitung zum sozialen Lernen für Paare, Gruppen und Erzieher", Rowohlt-Vlg., Reinbek 1974
- SPITZY, Christine: "Skriptum zur Gemeinwesenarbeit", BAS Wien 1996
- SPOLIN, Viola: "Improvisationstechniken für Pädagogik, Therapie und Theater", Junfermann, Paderborn 1983
- STARK, Wolfgang:"Empowerment", Lambertus Vlg., Freiburg im Breisgau 1996
- STAUB-BERNASCONI, Silvia: "Systemtheorie, soziale Probleme und Soziale Arbeit - lokal, national, international", Haupt-Vlg., Bern 1995
- STROTZKA, Hans: "Psychotherapie und Tiefenpsychologie", Springer-Vlg., Wien 1984
- STUMM, Gerhard/WIRTH, Beatrix: "Psychotherapie - Schulen und Methoden", Falter-Vlg., Wien 1994
- TAUBER, Norbert: Interview in: Zusammenhang Nr. 2/96, Caritas, Wien 1996
- WATZLAWICK, Paul: "Anleitung zum Unglücklichsein/Vom Unsinn des Sinns oder vom Sinn des Unsinns", Picus-Vlg., Wien 1992
- WILSON SCHAEF, Anne: "Co-Abhängigkeit", Heyne-Vlg., München, 1996
- WILSON SCHAEF, Anne: "Im Zeitalter der Sucht",DTV, München, 1991
- ZEINTLINGER, Karoline E.: "Analyse, Präzisierung und Reformierung der Aussagen zur psychodramatischen Therapie nach J.L. Moreno", Dissertation, Salzburg 1991
- ZEMBATY, Andreas: "Sozialarbeit und Öffentlichkeitsarbeit" in: Neue Kriminalpolitik Nr. 3/94, o.O. 1997, S. 37
Inhaltsverzeichnis (Vollständig)
- Vorbemerkung / Danksagung
1. Einleitung
2. Empowerment2.2.1. Die Bewältigung von Lebensereignissen und -situationen
2.2.2. Empowerment als Methode der Gemeinwesenarbeit
2.2.3. Die Stellung von Empowermentprozessen in der sozialtherapeutischen Praxis
2.2.4. Kritik an Stark - Individuum vs. Kollektiv
2.1. Zum Begriff des Empowerment
2.2. Empowerment nach Stark
- 3. Theater in der sozialen und therapeutischen Praxis
3.1.1. Therapeutisches Theater
3.1.2. Behaviourdrama
3.1.3. Psychodrama empirisch gesehen
3.2. Theater der Unterdrückten nach Boal3.2.1. Formen einer "Allgemeinbildung "
3.2.2. Das Spiel mit der Bewußtseinsbildung - Methoden nach Boal
3.2.3. Ziel des Theaters der Unterdrückten
3.1. Psychodrama
- 4. Versuch der Charakterisierung von KlientInnen sozialtherapeutischer Einrichtungen am Beispiel des Vinzenzhauses der Caritas
- 5. Theater als Methode zum Empowerment
5.3.1. Die Institution
5.3.2. Das Projektteam
5.3.3. Die Gruppe
5.3.4. Das Individuum
5.1. Ziele
5.2. Kreativität und Empowerment
5.3. Bedingungen für Empowerment-Theater
- 6. Praxisteil
6.1.1. Die Grundlagen
6.1.2. Die Geschichte eines Teams
6.1.3. Das Konzept
6.1.4. Die Finanzierung
6.1.5. Die TeilnehmerInnen
6.1.6. Die Phasen
6.1.7. "So ein Theater" - Prozeß, Produkt und das Leben danach6.2.1. Die Institution (Dr. Jutta Guttmann)
6.2.2. Das Team (Mag. Christian Wetschka)
6.2.3. Die KlientInnen (Ludwig Zeissner)
6.2.4. Die Politik (Petra Bayr)
6.1. Was war PRO-95 ?
6.2. Theater und Empowerment - Interviews
- 7. Zusammenfassung
- 8. Anhang
8.1. Kalendarium zu PRO-95
8.2. "So ein Theater" - Inhalt, Rollen und ihre DarstellerInnen
- 9. Anmerkungen
- 10. Quellenverzeichnis
Ich erkläre, daß ich die Arbeit selbst verfaßt und keine außer der angegebenen Literatur verwendet habe.
Kontakt: Sabine Schweizer via Email
© Diese Seiten wurden erstellt von