Namenssachen aus Neukölln
Die "Arche" darf nicht mehr "Landowsky" heißen
KOLUMNE VON DUNJA BATARILO
Namen sind Schall und Rauch? Von wegen. Das Diakonische Werk Neukölln hat der Treptower Wärmestube in der Bekenntniskirche verboten, sich "Landowsky" zu nennen. Wo Arche drin ist, soll auch "Arche" draufstehn, findet der Träger der Sozialeinrichtung. Und: Wer das für falsch hält, fliegt raus.
Dabei tragen den fürsorglichen Namen "Arche" mittlerweile gleich drei soziale Einrichtungen in Berlin. Die meisten kennen unter diesem Namen das Kinderhilfsprojekt Hellersdorf, einige das ökumenische Frauenzentrum "Evas Arche" und nur sehr wenige das Treptower Obdachlosenprojekt. Hier, in den Räumen der Bekenntniskirche, bekommen Obdachlose ein warmes Essen und eine spartanische Unterkunft für eine Nacht.
Um sich wieder eindeutig erkennbar zu machen, hatten die Mitarbeiter der Wärmestube ihrem Projekt im vergangenen Frühjahr kurzerhand einen neuen Namen gegeben: "Nachtcafé Landowsky" - nach jenem Klaus-Rüdiger Landowsky, der lange die CDU-Fraktion führte, Vorstand der Bankgesellschaft war und infolge des Bankenskandals wegen Untreue zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Welch feine Ironie: Hatte doch Landowsky in Bezug auf Armut von "Ratten und Gesindel" gesprochen.
Die Namengebung schien niemanden zu stören, die Medien stürzten sich auf den Gag. Mit Aktionen wie "Benefizkonzert für Landowsky" kam Geld in die Kasse und die Presse ins Haus. "Endlich gab es mal eine interessierte Öffentlichkeit", sagt Karsten Krampitz, 38, der Wortführer des Projekts, "weil der Name nicht nur nach sozialem Elend klingt, sondern auch eine politische Aussage hat".
Das Nachtcafé war 1991 im Rahmen des grün-ökologischen Netzwerks "Arche" entstanden, aus dem zuvor auch die DDR-Grünen hervorgegangen waren. Entsprechend basisdemokratisch sind die Gewohnheiten der Mitarbeiter bis heute: Dem Träger erzählten sie von ihrem neuen Namen nämlich nichts.
Das Diakonische Werk Neukölln hatte den Medienrummel offenbar völlig verschlafen und bekam erst vor drei Wochen Wind vom "Landowsky": Das Team hatte den selbst gewählten Namen in den Schaukasten gestellt, woraufhin sich ein Gemeindemitglied bei der Geschäftsführung beschwerte. "Da hat wohl jemand den Witz nicht verstanden", frotzelt Krampitz. Geschäftsführer Siegfried Lemming sieht das nicht so locker: "Das Nachtcafé heißt 'Arche', und da ändert sich nichts dran. Alle Öffentlichkeitsarbeit geht über meinen Tisch", sagt er, so stehe es schließlich im Vertrag. Krampitz ist vor wenigen Tagen vom Dienst suspendiert worden; die traurige Nachricht überbrachte der Gemeindepfarrer.
Eine Disziplinarstrafe? 2004 hatte die Gemeinde der Bekenntniskirche das Diakonische Werk gebeten, die Trägerschaft für die "Arche" zu übernehmen. "Die haben die Infrastruktur, um die Bürokratie zu bewältigen", sagt Gemeindepfarrer Paulus Hecker. Das Diakonische Werk kümmert sich seitdem um die lebenswichtigen Zuschüsse von Bezirk und Land. Geschäftsführer Lemming fürchtet, dass das Spiel mit dem Namen des CDU-Politikers die politische Neutralität der gesamten Einrichtung gefährden könne: "Wir haben einen Ruf zu verlieren. Die Politik wechselt ja alle paar Jahre, wir sind aber auf zuverlässige Zuwendungen angewiesen." Das Diakonische Werk Neukölln-Oberspree ist Träger von über 30 sozialen Einrichtungen in Berlin.
Krampitz selbst fühlt sich persönlich gedemütigt. "Seit 17 Jahren mache ich das hier. Der Geschäftsführer hat sich ja noch nicht mal an mich persönlich gewandt." Er ist außerdem enttäuscht von seinen Teammitgliedern: "Es ist erschreckend, wie schnell das mit der Entsolidarisierung geht." Als von der Diakonie das Ultimatum kam, der Name "Landowsky" müsse innerhalb von zwei Tagen aus allen Webseiten und Schaukästen verschwinden, andernfalls werde man die gesamte Belegschaft austauschen, habe das Team so gut wie keinen Widerstand geleistet. "Die sind sofort eingeknickt aus Angst um ihre Jobs." Die meisten Mitarbeiter sind Studierende, die auf 600-Euro-Basis Nachtschichten in der Wärmestube übernehmen. "Die geben so viel Freiheit auf für ein nichts an Sicherheit", sagt Krampitz, "ich bin da sehr traurig."
Der Journalist und freie Autor würde am liebsten einen Verein gründen und das Nachtcafé wieder frei betreiben. Aber erst einmal muss er seine Uniprüfungen abschließen. Eine hat er schon bestanden - vor wenigen Tagen: "Ich hab eine 1,3 gemacht - Thema: Säkularisierung im Armenwesen".
© taz Entwicklungs GmbH & Co. Medien KG, Vervielfältigung nur mit Genehmigung des taz Verlags
Guten Tag!
Die Krankenwohnung in der Lehrter Straße ist seit dem Sommer des Jahres 2008 geschlossen und wurde von der Berliner Stadtmission gekündigt. Ganz offenbar eine Folge des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes, nachdem eine Pflichtversicherung für alle besteht und offenbar davon ausgegangen wird, dass auch Obdachlose unkompliziert in Krankenhäusernbehandelt werden können: Ganz eindeutig wurden von den Berliner Bezirken - trotz ausgesprochener Überweisungen durch die Ärzte - keine Kostenübernahmen mehr ausgestellt.
Nun ist es völlig absurd, zu glauben, ein obdachloser Mensch könne seine Krankheit auf der Parkbank auskurieren - solange Menschen mehr oder weniger auf der Straße leben und im besten Fall nur langsam wieder integriert werden können - ist eine Krankenwohnung oder besser Krankenstation mit ärztlicher Betreuung - notwendig und wird es auch bleiben. Das sieht auch die AG Leben mit Obdachlosen so, die sich mit dieser Thematik auf ihrer Herbsttagung 2008 befaßt hat. Die Senatorin für Soziales ist jetzt in der Verantwortung, mit allen Beteiligten zu reden, insbesondere auch mit den Krankenkassen zu verhandeln, die Finanzierung sicher zu stellen und unverzüglich durch eine Ausschreibung und Vergabe dafür Sorge zu tragen, dass dieses Angebot fortgesetzt wird.
Nachstehend dokumentiere ich den offenen Brief der AG Leben mit Obdachlosen vom 16.10.2008 an die Senatorin.
Berlin, 16.10.2008, Dr. Stefan Schneider
Hannes Kiebel
Untergang — Berliner Obdachlosen GmbH
Anregungen zu einem Film für die Gemeindearbeit
-
Die Filmemacher, Ingolf Seidel und Holger Wegemann, berichten:
Unter der Schlagzeile „Berliner Obdachlose machen Theater" wurden wir im März 1991 auf das Theaterprojekt „Untergang" der Berliner Obdachlosen GmbH & Co. KG aufmerksam: für uns als Theaterfilmemacher ein spannendes Thema.
Doch es kommt anders: Neben der Theaterarbeit begannen uns immer mehr die Menschen zu interessieren. Über mehrere Probenbesuche kamen die Beteiligten und wir uns näher.
Wir entschlossen uns, über einen Theaterfilm hinaus ein Porträt einzelner „Obdachloser" zu zeichnen. Durch die gemeinsame Arbeit selbstbewußter geworden, berichteten Betroffene über ihre Erfahrungen und Erlebnisse, über ihr Leben auf der Straße. Von der Straße auf die Bühne - der Film zeigt auch Bilder einer Aufführung, die das Ergebnis sechsmonatiger Gruppenarbeit ist. Die „Obdachlosen GmbH &Co. KG" ist keine Gruppe von „stinkenden Arbeitsscheuen", sondern eine von Individualisten, die etwas zu sagen haben.
Wir haben uns bemüht, einzelne zu Wort kommen zu lassen.
„Für mich gab es noch nie was Wichtiges. Ich bin 25 Jahre am Leben vorbeigeschwommen" (ein Obdachloser). Sich ernst zu nehmen, versteckte Talente zu entdecken, Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen und die Freude am Zusammensein sind die positiven Erfahrungen, die die Betroffenen bei der Gruppenarbeit sammeln konnten.
„Wir im Westen haben seit 40 Jahren gelernt, mit Obdachlosigkeit umzugehen. Da saß auf dem Ku-Damm alle 2 Kilometer ein Bettler, jetzt alle 2 Meter. Die aus der ehemaligen DDR konnten sich nie vorstellen, obdachlos zu werden, arbeitslos, für die bricht eine ganze Welt zusammen" (ein Obdachloser). Gerade mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten hat das Problem Obdachlosigkeit eine neue Brisanz erfahren.
-
Das Theaterstück „Untergang"
Theatralischer als das Theater sei das Leben der Obdachlosen, Abhängigen, Bedrohten, schreibt der Regisseur des Stücks, Bernard Wind, im Programmheft. „Untergang" beginnt mit der Schwelle, die das gesicherte Leben von der Obdachlosigkeit scheidet: Ein alter Mann, Heinz Kreitzen, schubst wütend die Zuschauer, die zwischen wartenden Obdachlosen mit Bittschildern aus Pappe einzeln und kulturinteressiert in die Parochialkirche träufeln. Zehn Bilder und Szenen reihen sich aneinander. Fest umrissen - als Frau vom Sozialamt, als arrogante Tante vom Heiratsvermittlungsinstitut, als ausgebeutete Putze am Bahnhof, 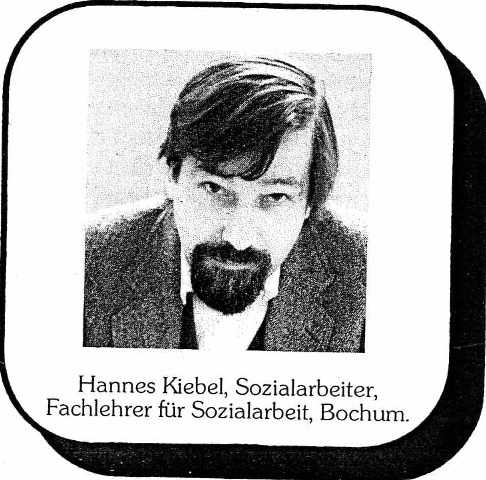 als Taubstumme, die im Gefängnis ihren Mann besucht, als Gefängniswärter, als Bahnbulle, als Pförtner im Asyl - bereiten die Profis den Boden, auf dem das Spiel der Laien lebendig wird. Die Obdachlosen wiederholen, variieren, verwandeln die Demütigen, denen sie beim Arbeits- oder Sozialamt, im Asyl, aber auch untereinander passiv ausgesetzt sind, und werden als Schauspieler, die ihr Leben spielen, zum Subjekt ihrer eigenen Geschichte. Der „Landstreicher" bewahrt seine Würde vor den Rassismen im Obdachlosenheim dadurch, daß er als „Bananen-Joe" den Urwaldaffen macht, für den sie den „Neger" halten. Mit einer Intensität und Fülle, die nur wenigen Schauspielern eigen ist, füllt seine Stimme die Kirche.
als Taubstumme, die im Gefängnis ihren Mann besucht, als Gefängniswärter, als Bahnbulle, als Pförtner im Asyl - bereiten die Profis den Boden, auf dem das Spiel der Laien lebendig wird. Die Obdachlosen wiederholen, variieren, verwandeln die Demütigen, denen sie beim Arbeits- oder Sozialamt, im Asyl, aber auch untereinander passiv ausgesetzt sind, und werden als Schauspieler, die ihr Leben spielen, zum Subjekt ihrer eigenen Geschichte. Der „Landstreicher" bewahrt seine Würde vor den Rassismen im Obdachlosenheim dadurch, daß er als „Bananen-Joe" den Urwaldaffen macht, für den sie den „Neger" halten. Mit einer Intensität und Fülle, die nur wenigen Schauspielern eigen ist, füllt seine Stimme die Kirche.
-
Zum Hintergrund
„Untergrund" ist ein Theaterstück, das an mehreren Tagen im Juni 1991 im kalten Mauerwerk der Berliner Parochialkirche aufgeführt wurde. „Die Stärke des Stücks ist die Verknüpfung von Lebenserfahrung mit der Kunst" (Bernard Wind).
Was Bernard Wind, der jugoslawische Regisseur, hier mit einer Gruppe Berliner Obdachloser — unterstützt durch fünf professionelle Schauspieler - unternimmt, ist der Versuch, die sozialen Erfahrungen des Lebens auf der Straße auf eine emotional-künstlerische Weise weiterzugeben, zu sensibilisieren für Szenen, die nicht fiktiv sind. Denn solche Szenen können wir, wenn wir wollten, auch „live" beobachten: auf dem Bahnhof, in der Wärmestube, auf dem Amt. Und: Bis vor einigen Monaten hätten wir auch dieselben „Darsteller" erleben können in diesen Szenen auf der Straße.
Seit Anfang des Jahres 1991 wohnten alle „Schauspieler" gemeinsam in einem halb verfallenen Haus im Berliner Stadtbezirk Mitte. Doch als die Lichter auf der Bühne in der Parochialkirche nach der letzten Aufführung verloschen waren, mußten die Obdachlosen mal wieder ihren Kram zusammenpacken. Sie waren wieder da, wo sie auch schon vorher waren, nämlich auf der Straße. Weder für den Verbleib der gespendeten Kleidungsstücke, der Requisiten noch des Bühnenbildes war gesorgt, vieles landete einfach auf dem Müll, und für viele Obdachlose war der Sturz nicht weniger tief. Nach Lesungen auf dem Berberkongreß in Uelzen und in Halle entstand die Idee, einen Obdachlosenverein zu gründen, ein eigenes Theaterstück zu entwickeln und weitere Lesungen zu veranstalten.
Seit September 1991 existiert der Verein „Unter Druck — Kultur von der Straße" mit dem Rahmenkonzept eines Hilfe- und Selbsthilfeansatzes, den Schwerpunkten „Beratung/Kontakt" und „Kultur- und Bildungsarbeit".
-
Einsatz
Auch wenn „die Obdachlosen" im Film in ihrer Offenheit und Selbstreflexion nicht unbedingt repräsentativ sind für die vielen, die inzwischen zum „normalen" Erscheinungsbild unserer Städte gehören, so verdeutlichen sie doch, was es bedeutet, in den Kreis von Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit zu kommen.
Dieser Film, der betroffen macht, wirbt gleichzeitig dafür, diesen Menschen mit Achtung und Menschlichkeit zu begegnen. Eine mögliche Wirkung dieses vielschichtigen Films könnte darin bestehen, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, die bislang wenig oder nichts miteinander zu tun haben oder zu tun haben wollen. Ganz allgemein schafft dieser Film Grundlagen für Gespräche zu „Menschenwürde", „Mitmenschlichkeit" und „Solidarität"; für lebendige Gespräche mit notwendigen Folgen in Gemeinden.
-
Daten
Untergang - Die Berliner Obdachlosen GmbH & Co. KG. Ein Film von Ingolf Seidel und Holger Wegemann. Eine Produktion der IRA Theateratelier in Zusammenarbeit mit Tele Potsdam. Bundesrepublik Deutschland, 1991. BETA-SP, 29 Min. Buch/Regie/Kamera: Ingolf Seidel und Holger Wegemann; Redaktion: Sylvia Kemffeldt und Lew Hohmann; Musik: Herrmann Naehring; Schnitt: Frank Schleuder.
-
Verleih
Videofilm auf VHS.Medienwerkstatt Freiburg e. V, Konradstr. 20, 79100 Freiburg i. Br.; Tel. 0761/709757; Fax 0761/701796.
-
Autor
Hannes Kiebel, Sozialarbeiter, Fachlehrer für Sozialarbeit, Bochum
Erschienen in d. + d. - Medienarbeit 1994, S. 179-180.
Nachwort:
Ich veröffentliche diesen Text, weil es zum einen ein wichtiges Dokument zur Entstehung des Wohnungslosen-Kulturprojekts Unter Druck - Kultur von der Straße ist, ein Projekt das bis heute (Sommer 2008) existiert und das auch immer wieder von Menschen ohne Wohnung geleitet wird, so gegenwärtig von Jan Markowsky, dem mein höchster Respekt gehört.
Zum anderen möchte ich mit diesem Text erinnern an Hannes Kiebel (14. Juli 1936 — 28. März 2008), einem großartigen Menschen, vor dem ich deshalb eine hohe Achtung habe, weil er wohnungslose Menschen durchweg gleichberechtigt freundschaftlich und auf Augenhöhe behandelt hat. Zahlreiche Sammlungen von Texten, Fotos, Zeichnungen, Gedichten, Texten wohnungsloser Menschen belegen das. Von Hannes Kiebel habe ich unendlich viel gelernt, vor allem aber die Haltung, mit denen der Menschen von der Straße begeget ist, hat mir wesentlich dabei geholfen, eine eigene Position zu finden.
Danke.
Stefan Schneider, 29.06.2008
In der wohnungslos ist ein weiterer Nachruf erschienen, den ich ebenfalls an dieser Stelle dokumentieren möchte:
Nachruf auf Hannes Kiebel (1936 – 2008)
Hannes Kiebel war von Beruf Sozialarbeiter. Von 1974 an war er als Hochschullehrer an der Ev. Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe tätig, dazu langjähriges Vorstandsmitglied des Westfälischen Herbergsverbands und weiterer Verbände. Für den Zentralverband Sozialer Heim- und Werkstätten e.V. (ZHW) hat er bei vielen Tagungen mitgewirkt. Für die Ev. Obdachlosenhilfe war er immer wieder engagiert und hat u.a. am Band "Bürger & Bettler" mitgearbeitet.
Hannes Kiebel hat sich intensiv mit Geschichte, Wirkungsweise und Wandel der Wohnungslosenhilfe befasst und dabei z.B. die Entwicklung von stationären Einrichtungen zu fachlich differenzierten Hilfesystemen analysiert, kritisch begleitet und unterstützt. Auf diesem Spezialgebiet Wandel der Wohnungslosenhilfe war er ein „wandelndes Lexikon“, versehen mit einzigartigem Wissen, zuhause in allen einschlägigen Archiven.
Sein Themenspektrum war breit und seine Expertise an vielen Stellen gefragt. Für eine Reihe von Verbänden bzw. Einrichtungen leistete er Grundlagenarbeit für Jubiläumsschriften, erstellte diese teils und recherchierte dafür beharrlich. Seine Publikationen haben fachliche Tiefe und sozialhistorische Qualität, in wissenschaftlichen Arbeiten wird er häufig zitiert. Ganz sicher ist es auch seinem Bemühen zu verdanken, dass der Begriff „nichtsesshaft“ etc. einem kritischen Diskurs ausgesetzt war und heute weitgehend überwunden ist.
Eigene Anschauung und die Nähe zu den Menschen waren Hannes Kiebel wichtig, er ist deshalb viel gereist. Als er beispielsweise das „Kochemer Netz“ beforschte, hat er die Wege großenteils selbst erwandert.
Er war ein in sich ruhender, oft fröhlicher Mensch, der es sehr genoss sein großes Wissen weiterzugeben. Geschichte, Fakten und Anekdoten reihte er mühelos und unnachahmlich wie Perlen auf eine Schnur.
Hannes Kiebels Triebfeder war neben einem ausgeprägten Drang zu wissenschaftlicher Präzision und historischer Wahrheit sein tiefer christlicher Glaube, aus dem heraus er einen ganz besonderen Zugang zu obdachlosen Menschen und Menschen in anderen sozialen Notlagen hatte. Er war auf Berbertreffen zu finden und lebte in Beziehung mit Betroffenen. Der Kontakt zu ausgegrenzten, an die Ränder gedrückten Menschen war ihm wichtig; für seine Arbeit als Hochschullehrer verschaffte er sich auch auf diese Weise Bodenhaftung und Praxisnähe.
Im Frühjahr 2004 zeigte er bei einem Vortragsabend, den er in Anlehnung an Brecht unter die Überschrift „Wär’ ich nicht arm, wärst du nicht reich“ stellte, mögliche Konsequenzen der heraufziehenden „HARTZ – Reformen“ auf. Sein Kernsatz war: „Mit der neuen Sozialgesetzgebung ist für ganze Bevölkerungsgruppen ein würdiges Leben in Gefahr!“
Den letzten Vortrag coram publico hielt er im Oktober 2006 in Bad Honnef. Obwohl gesundheitlich stark angeschlagen hat er noch einmal in der Tiefe die ZHW-Geschichte aufgezeigt; es war zugleich die letzte Herbstarbeitstagung dieses Verbandes.
Hannes Kiebel ging es gesundheitlich schon das ganze Jahr 2006 nicht gut, bis sich herausstellte dass er an Krebs im fortgeschrittenen Stadium litt. Am 28. März 2008 ist er verstorben. Seinen letzten Weg auf dem Bochumer Hauptfriedhof begleiteten eine Vielzahl Menschen, denen er Kollege, Lehrer, Ratgeber, Wegbegleiter, Freund war.
Cora Geißler: Wie ich lernte, ein Ufo zu lieben. Hamburg 2008 (einestages)
Quelle: einestages, Zeitgeschichten auf SpiegelOnline mit freudlicher Genehmigung der Autorin
 Angriff der Außerirdischen? Nein, Sixties-Design! Vor 40 Jahren revolutionierte das Futuro-Haus die Architektur. Doch nur 22 Stück des transportablen Raumwunders im Look einer Fliegenden Untertasse wurden je gebaut. Ufo Nr. 13 fand Cora Geißler zufällig auf dem Schrottplatz - und beschloss, es zu retten.
Angriff der Außerirdischen? Nein, Sixties-Design! Vor 40 Jahren revolutionierte das Futuro-Haus die Architektur. Doch nur 22 Stück des transportablen Raumwunders im Look einer Fliegenden Untertasse wurden je gebaut. Ufo Nr. 13 fand Cora Geißler zufällig auf dem Schrottplatz - und beschloss, es zu retten.
Zwischen überwucherten Riesenradgondeln, ausgedienten Karussellpferden und rostigen Schienen bahne ich mir meinen Weg. Die flugzeugartige Treppe senkt sich knarrend und gibt den Blick in das Innere des seltsamen Ufos frei. Durch eine ovale Tür betrete ich den kreisrunden Innenraum. Blaue Mülltüten als liebloser Gardinenersatz, sperrholzverschalte Wände, unter riesigen Bergen von Elektroschrott und allerlei Müll lugt ein schäbiger Kunstrasenteppich hervor. Unzählige Fliegen umkreisen den noch gedeckten Tisch. Gummistiefel stehen unter der Garderobe und zeugen von der übereilten Flucht des letzten Bewohners.
Entdeckt hatte ich das verwunschene Objekt auf einem Spaziergang durch den Plänterwald im Ost-Berliner Stadtteil Treptow, auf dem Schrottplatz eines ehemaligen Vergnügungsparks: Ein Gebilde wie eine Fliegende Untertasse von vielleicht acht Metern Durchmesser, elliptisch im Aufriss und mit ovalen Fenstern, dazu auf hohen Stelzen stehend, die ihm zusätzlich die Anmutung einer Mondfähre verliehen.
Ich hatte etwas ganz besonderes entdeckt, soviel war mir sofort klar. Der Gedanke, das faszinierende Objekt aus seiner traurigen Umgebung zu retten, ließ mich seither nicht mehr los. Wilde Ideen kreisten in meinem Kopf: Könnte man daraus einen Eissalon machen, mit Speiseeis in den denkbar grellsten Farben? Ein Cafe am Ufer der Spree, für hungrige Bootsausflügler auf dem Weg zum Müggelsee? Eines aber war mir völlig klar: Ich wollte dieses Ufo retten.
Stasi-Abhörstation oder Skihütte?
Nur gestaltete es sich schwieriger als erwartet, das Haus zu erwerben. Obwohl es auf dem Schrottplatz stand, verlangte der Eigentümer einen hohen Preis. Die Verhandlungen waren zermürbend und führten über zwei Jahre zu keinem Erfolg.
In dieser Zeit begann ich intensiv, die Geschichte und Herkunft des seltsamen Objekts zu erforschen. Jedes Foto, jeder Zeitungsartikel und jedes noch so kleine Detail aus der Historie des Futuro brachte mich meinem Lebenstraum näher, auch wenn ich ihn noch gar nicht besaß. Durch Zufall entdeckte eine Bekannte das achtlos im Keller einer benachbarten Ruine entsorgte Fotoarchiv des Kulturparks mit wunderbaren Aufnahmen aus den Anfangstagen des Kulturparks mit "meinem" Ufo.
Ich traf ehemalige Mitarbeiter des Kulturparks, deren Anekdoten und persönliche Erinnerungen die Verbundenheit mit der ungewöhnlichen Behausung noch verstärkten. Manche Geschichten erwiesen sich allerdings als skurrile Gerüchte, etwa, dass die Staatssicherheit aus dem Ufo heraus Ost-Punks beobachtet hätte. Über viele Umwege und Zufälle entdeckte ich schließlich das Geheimnis der vermeintlichen Jahrmarktattraktion: Mein Ufo war in Wirklichkeit eine Skihütte.
Haus der intergalaktischen Utopien
Im Jahr 1965 war der finnische Architekt Matti Suuronen von einem Schulfreund gebeten worden, ihm eine Berghütte zu entwerfen. Das Ergebnis war eine ellipsoide Konstruktion aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 16 symmetrisch angeordneten ovalen Fenstern. Die Behausung konnte per Hubschrauber leicht in unwegsames Gebirge transportiert werden und ließ sich dank seines geringen Raumvolumens günstig und schnell beheizen. Die kreisrunde, 50 Quadratmeter große Wohnfläche beherbergt eine offene Küchenzeile, einen Schlafbereich für zwei Personen, eine Nasszelle mit integrierter Dusche und Toilette sowie drei Liegesessel, radial entlang der gekrümmten Außenwand aufgestellt und um einen in der Mitte plazierten, offenen Kamin gruppiert.
Schnell erregte die ungewöhnliche Architektur des Prototyps weltweite Aufmerksamkeit. Das "Futuro" getaufte mobile Heim war 1968 in London die Hauptattraktion der Ausstellung "Finnfocus" und wurde bald vom New Yorker Museum of Modern Art gezeigt. Ermutigt von der großen Resonanz begann die Serienfertigung. Die Firma Polykem nahm das "Futuro" als Freizeithaus ins Programm und präsentierte es auf zahlreichen Messen weltweit.
Suuronens spacige Skihütte vereinte wie wenig andere Designobjekte die zentralen Tendenzen des Zeitgeistes der sechziger Jahre. In seiner Formgebung griff das Futuro-Haus die intergalaktischen Utopien der frühen Raumfahrt auf, die mobile Funktionalität entsprach dem neuen Freizeitgedanken am Ende der Nachkriegsgenügsamkeit. Die Erwartung, mit einer seriellen Großproduktion eine für Jedermann bezahlbare, revolutionäre Wohnform geschaffen zu haben, erfüllte sich allerdings nicht. Die Ölkrise von 1972 verdreifachte den Preis für Kunststoff und machte die Produktion unrentabel, und die aufkommende Umweltschutzbewegung verteufelte Plastik als Bedrohung für den Planeten. So verließen insgesamt nur 22 "Futuro"-Häuser das finnische Werk, die unter anderem nach Südafrika, Japan und Argentinien verkauft wurden.
Alle Kinder wollen Ufo fliegen
Heute existieren vom "Futuro" noch ganze elf original erhaltene Exemplare. Während meiner Recherchen versuchte ich den Weg jedes einzelnen nachzuverfolgen. Ich entdeckte ein Futuro in Tarnfarben als Fischerhütte auf einer finnischen Insel. Eines steht, der ursprünglichen Idee gemäß, als Skihütte in den Bergen Dombais in Russland. Ein sehr gut erhaltenes Exemplar spürte sich bei den designbegeisterten Japanern auf, in Neuseeland einen Nachbau, der ehemals als Bankfiliale diente. In Deutschland gibt es in einem Jugendclub bei Frankfurt immerhin noch eine knallgelbe Futuro-Hälfte.
Auch die Geschichte meines Ufos kenne ich inzwischen. Das Futuro mit der Seriennummer 13 wurde 1968 als Ausstellungspavillon des Chemiekonzerns Bayer auf der Hannover-Messe eingesetzt. Von dort fand es seinen Weg in den Osten. Als 1969 zum 20. Geburtstag der DDR der Ost-Berliner Kulturpark eröffnet wurde, diente das Futuro dort als Parkfunkstudio, von dem aus der gesamte Park mit Musik beschallt werden konnte.
Außerdem war das markante, ovale Flugobjekt auf Stelzen Anlaufstelle für verlorengegangene Kinder, die von dort ihre Eltern ausrufen lassen konnten. Allerdings standen bald lauter Kinder vor dem Ufo Schlange, die angeblich ihre Eltern verloren hatten - in Wirklichkeit aber nur das Innenleben der spektakulären Raumstation erleben wollten. Da der Plattenunterhalter so nicht mehr arbeiten konnte, musste die Kindersuchstation umsiedeln.
Flucht nach Südamerika mit Karussell
Nach dem Ende der DDR wurde das Gelände von einer Firma namens Spreepark GmbH übernommen. In deren Pläne, im Kulturpark einen kommerziellen Freizeitpark einzurichten, passte das Futuro nun nicht mehr. Fortan führte es ein tristes Dasein am Rande des Geländes, zwischen ausgedienten Karussells und Jahrmarktschrott. Irgendwann 2002 sah ich durch Zufall einen Fernsehbeitrag über die spektakuläre Flucht des dubiosen Eigentümers der Spreepark GmbH: In wenigen Nächten hatte er einen Großteil der geleasten Fahrgeschäfte abbauen, auf Lkw verladen und über Bremerhaven nach Südamerika verschiffen lassen, um in Lima einen neuen "Lunapark" zu eröffnen. Der Abgang des hoch verschuldeten Investors zerstörte die Existenz vieler gutgläubiger Schausteller. Für mich entwickelte sich die neue Situation zum Glücksfall. Endlich konnte ich mit den neuen Verwaltern den ersehnten Kaufvertrag unterzeichen.
Aber wohin damit? Und wie? Ein Straßentransport war ausgeschlossen. Die von spektakulären Fotos aus Schweden inspirierte Idee, das Futuro per Transporthubschrauber umzusetzen, platzte kurz vor dem Abflugtermin: Aus bis heute unerfindlichen Gründen wiegt das Futuro mit der Seriennummer 13 unglaubliche 4,5 Tonnen, volle zwei Tonnen mehr als seine Brüder.
Eine andere Lösung musste her - und zwar schnell. Ich fand eine Werft, die einen Schiffsponton mit geeigneter Größe bereitstellen konnte. Als das Futuro am Haken eines Krans weit über der Spree hing und langsam auf den Ponton herabsank wie ein wirkliches Ufo bei der Landung, reckten die Passagiere der Ausflugsdampfer ungläubig die Hälse. Es war unvergesslich. Die Anspannung war immens, denn nun hatte ich die Verantwortung für ein museales Designobjekt übernommen - und ein wenig Angst vor meiner eigenen Courage.
Blickfang mit Vorbildwirkung
Das Haus befand sich einem verwahrlosten Zustand. Die Außenhülle war brüchig, die meisten der Plexiglasfenster hatten Sprünge, waren zerkratzt oder fehlten völlig. Die ursprüngliche Innengestaltung war durch diverse Einbauten nicht mehr zu erkennen, wichtige Elemente fehlten.
Glücklicherweise gelang es, Museen, Institute und Hochschulen für die Begleitung der fälligen Restaurierung zu gewinnen. Mittlerweile befindet sich das Futuro weitgehend wieder im originalen Zustand; der Denkmalschutz möchte es in seine Bestandsliste aufnehmen. Das Futuro13 ist heute wieder ein echter Blickfang am südöstlichen Spreeufer. Endlich bekommt es die wieder die Aufmerksamkeit, die ein so kühner und zugleich charmanter Entwurf verdient.
Und durchaus nicht nur von Ausflüglern. Andere Designer nehmen heute Matti Suuronens Vision wieder auf und entwerfen mobile Behausungen für globale Nomaden - der Berliner Werner Aisslinger etwa mit seinem "LoftCube". So strahlt Suuronens Futuro, das weit mehr als eine Skihütte war, auch nach 40 Jahren weiter den Geist einer gelebten Utopie aus.
Ab Juli 2008 besteht die Möglichkeit das FUTURO13 am Ufer der Spree zu besichtigen. Anfragen per Mail an Futuro13 at berlin.de









