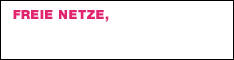Resignation auf Herbstchrysanthemen
Er liegt immer noch da, der Berg mit dieser verzauberten und bezaubernden Aussicht und mit dieser Stimmung, der sich keiner zu entziehen vermag. Die schimmernde Fläche des Sees, die Wucht der Berge, und die fast tropische Vegetation des durch die Alpenkette vor allen rauhen Winden abgeschirmten 46. Breitengrades. Und mitten auf dem Berg das Hotel, offen für Licht und Luft, durchleuchtet von Sonne. Aus hellem Beton und Glas, Nickel und Edelhölzern, mit kostbaren Teppichen und den ausgesuchtesten Kunstwerken aller Zeiten.
An einem bescheidenen Eckplatz des Restaurants sitzt mir gegenüber ein sonnengebräunter Mann in eleganter Kleidung, mit untadelig gebundenem Schlips. Er trinkt Mokka und raucht Zigaretten. Er macht einen tief in sich selbst ruhenden, behaglich harmonischen Eindruck. Die Nervosität der großen unruhigen Welt scheint ihm nichts anhaben zu können. Sein Blick ist offen, mild und sicher.
Es ist Dr. Eduard Freiherr von der Heydt, der Besitzer des Monte Verita. »Der Baron« sagen die Leute, wenn sie von ihm sprechen. Sein zuweilen etwas müdes Lächeln erinnert an den Zug weiser Nachsicht im Antlitz buddhistischer Skulpturen. Wenn er sich auf seinem Stuhl etwas vorbeugt, kann ich etwas von dem Kissen aus feinem asiatischem Seidenbrokat sehen, auf dem er sitzt. Er sieht sehr spannend aus.
Wir sprechen von den vergangenen zwei Jahrzehnten, über den Zweiten Weltkrieg, über geschlossene Grenzen, unbehagliche Auswirkungen in der Schweiz, über die jetzige [73] allgemeine Unsicherheit, und eine darauf zurückzuführende stillere Periode des Berges. Der Baron ist während des Krieges Schweizer Staatsbürger geworden. Den bedeutendsten Teil seiner Kunstsammlungen schenkte er dem Museum der Stadt Zürich. Wir kommen auf jene Generation von Liebhabern des Berges zu sprechen, die am Aussterben ist, die in einem chaotischen Europa ihr Leben lassen mußte, die auf der Flucht oder im Exil Selbstmord beging, die über den ganzen Erdball verstreut wurde.
Das Gesicht des Barons bekommt einen versonnenen Ausdruck. Sein Blick scheint Erinnerungen zu streifen, verweilt in Gedanken an Vergangenem, und gleitet wieder in die Gegenwart zurück.
»Wünschen Sie ein Glas Kognak zum Kaffee?« sagt er halblaut und um von etwas anderem zu sprechen.
Er erzählt, daß er jetzt den gesamten Betrieb des Berges verpachtet hat. Damit ist er sozusagen ein Gast in seinem eigenen Heim geworden. Dann kommen wir auf Skandinavien zu sprechen, das er liebt. Wir amüsieren uns über eine skandinavische Pressenotiz die >>etwas voreilig<<, wie er es bezeichnet, die Nachricht von seinem Tode brachte. Und dann frage ich nach dem Schicksal des berühmten roten Tessiner Sonnenschirms. Darauf erzählt der Baron von seiner langwierigen Krankheitsperiode, die ihn schließlich zwang das Lufthemd abzulegen, und damit auch den Sonnenschirm, und sich wieder an bürgerliche Kleidung zu gewöhnen.
Und der Monte Verita?
»...eine Zufluchtsstätte für Menschen, die Ruhe und Frieden suchen... nein, hier werden wohl keine größeren Veränderungen mehr geschehen...« [74]
Es ist, als wollte er noch etwas hinzufügen, aber er schweigt.
Mein Blick fällt auf die kostbare Umgebung. Die Sonne spiegelt sich in dem goldrandigen Kognakglas, auf dem das Emblem des Monte Verita, eine Palme und einige Bergkonturen, in Gold glänzt. Einen Moment streifen meine Gedanken die »Langhaarigen« und die »Nackten«, die sich hier einst mühten, unter primitivsten Verhältnissen, und anspruchslos lebten, darauf bedacht, die Wahrheit zu finden und sie der Menschheit mitzuteilen.
Auf dem fein registrierenden Gesicht des Barons zeichnet sich die Andeutung eines resignierenden Lächelns ab.
»Der alte Geist ist immer noch da«, sagt er still, »aber wenn man selbst nicht mehr mit gutem Beispiel vorangehen kann...«
Sein Blick umfaßt die herrlichen Kunstwerke an den Wänden. Seine tiefste und innigste Botschaft, die Signatur der Seele aller Zeiten und aller Völker, der mit Inbrunst, Liebe und Leidenschaft um letzte, ewig gültige Klarheit ringenden Seele.
Hat man die Flammenschrift an seinen Wänden gelesen und zu deuten vermocht, hat man ihn verstanden? Ist man sich darüber klar geworden, was von der Heydt eigentlich gegeben hat?
Schweigend nimmt der Berg eines weisen Mannes edle Resignation zur Kenntnis.
Wir erheben uns von den Stühlen, und jetzt kann ich das asiatische Brokatkissen in all seiner Herrlichkeit sehen: Schmetterlinge und Chrysanthemen – die uralten östlichen Symbole des Traumes und der himmlischen Erhabenheit, strahlend wie des Herbstes goldener Tau, leuchtend wie das milde Silberlicht des Herbstmondes. [75]
Zu meinem Besitztum hat jeder Zutritt!
Der Ruf nach der Wahrheit verstummte. Der Monte Verita sah wechselnde Pächter und wurde zum Verkauf ausgeboten. Es wurde öde und leer. Der Park wuchs zum [70] Dschungel. Carlo Vester hatte die Aufsicht über dieses verwildernde Terrain bekommen, das langsam verfiel und doch immer gleich zauberhaft schön blieb.
Einige Besitzer versuchten es auf kürzere Dauer mit dem unregierbaren Berg. Sie kamen und verschwanden. Dann begegnete Baron von der Heydt seinem Schicksal. Er bekam ein Angebot, den Monte Verita zu kaufen. Er wollte nicht. Aber er kannte den Berg, und die Erinnerung suchte ihn heim. Vielleicht versuchte er sich zu einem Nein zu überlisten, als er endlich die Hälfte der geforderten Kaufsumme bot. Zu seiner Überraschung erfuhr er eines Tages, daß er Besitzer des Monte Verita geworden war. Sein Angebot wurde angenommen: 160 000 Schweizer Franken, einschließlich Inventar. Das geschah im Februar 1926.
Der verödete Berg erwachte zu einem neuen Dasein. Die alten Dogmen fielen, alles wurde so liebenswürdig frei. Das neue Leben begann nicht mit festgemauerten Grundsätzen, sondern mit harmonischen Betrachtungen: Wie lassen sich alle modernen Bequemlichkeiten am besten mit ausgesuchter Schönheit und träumendem Frieden vereinen? Warum soll es für alle nur eine einzige Möglichkeit zur Erlangung von Gesundheit und neuer Lebenskraft geben? Wer ein gutes Beispiel braucht, der nehme sich eins!
Wie ein Tessiner Gandhi, mager und von der Sonne dunkelbraun gebrannt, nur mit kurzen weißen Shorts bekleidet und dem lose herabhängenden Lufthemd ohne Kragen und Ärmel, so bewegte der Baron sich nun ungezwungen zwischen seinen Gästen. Seine nackten Füße steckten in Sandalen und in der Hand hielt er den traditionellen, roten Tessiner Sonnenschirm. Gern wollte er seinen Gästen ein Vorbild sein, nie aber sich als Vorbild aufdrängen.[71]
So begann die Aera von der Heydt auf der Akropolis von Ascona.
Der Baron war eine international bekannte Persönlichkeit, seine einzigartigen Sammlungen asiatischer Kunst genossen Weltruf. Nun verwandelte er den Monte Verita zu einer Stätte auserlesener Kunstwerke. Im Park wurden Statuen aufgestellt, diskret, niemals das Landschaftsbild störend, nie prahlend. Alle Zimmer, Korridore, Hallen des Sanatoriums und der umliegenden kleinen Häuser wurden mit asiatischen sowie europäischen und afrikanischen Skulpturen und Malereien geschmückt. Unermeßliche Werte standen da in aller Öffentlichkeit. Und es ging, es ging gut. Sie wurden geachtet und geschätzt, und vor allem respektiert. Weder nennenswerte Beschädigungen noch Diebstähle kamen vor. Vielleicht -- weil es im Tessin war, und auf dem Monte Verita? Man wagt sich dieses Experiment kaum an jedem beliebigen Ort wiederholt vorzustellen. Etwas sträubt sich in einem bei dem Gedanken, Kunstwerke von Weltformat, die seltensten Schätze, draußen in unbewachten Parks oder in offen zugänglichen Gebäuden auszustellen und zu sagen: »Bitte, zu meinem Besitztum hat jeder Zutritt!« Von der Heydt wagte es zu tun.
Stimmte das wirklich? Wieder lauschte die Welt. Europas Kunstfreunde kamen zum Monte Verita gepilgert und sahen. Es stimmte!
Der Berg der Wahrheit wurde ein ungezwungenes Paradies für Erholungsuchende, ein Symbol für Frieden, Geist und Schönheit, ein Mekka der Kunst-Enthusiasten. [72]
Ein anständiger Mensch besitzt kein Geld!
Nirgends in Europa schien die Luft so mit Spannung geladen zu sein wie auf dem Monte Verita. Nur die wirtschaftlichen Verhältnisse gerieten nun völlig ins Stocken. Ganz gewiß ließ es sich hier immer noch unglaublich billig leben, und die durchschnittliche Auffassung war geprägt von dem Schlagwort: »Ein anständiger Mensch besitzt kein [65] Geld!« Doch Oedenkovens sehr vermögende aber über dieses Experiment entsetzte Familie, die den einen großen Geldzuschuß nach dem andern im Nichts verschwinden sah, dachte entschieden anders darüber.
Verständlich, wenn man bedenkt, daß Ida Hofmann und Oedenkoven ihr ganzes Vermögen der Idee geopfert hatten. Mit dem, was sie besaßen, hätten sie sich zurückziehen und den Rest ihres Lebens ein Idealdasein führen können. Aber sie waren bestrebt, auch anderen Menschen glücklichere Bedingungen zu schaffen. Die Enttäuschungen wurden grenzenlos.
Vielleicht war es der schwerste Schlag, als sie einsehen mußten, daß die strengen vegetarischen Prinzipien des Sanatoriums viele zahlende Gäste abschreckten. Nun hatten sie die kostbaren Anlagen für elektrische Beleuchtung durchgeführt, hatten das Luft- und Sonnenbad ausgebaut, für Wasser, Zentralheizung und viele andere Bequemlichkeiten gesorgt, neue Umbauten und Zubauten entstehen lassen. Neue Reklamebroschüren waren ausgesandt. Sie hatten sich von der irrationellen, weltanschaulich betonten Verwaltung auf eine rationell betonte und zu vielen Konzessionen bereite Verwaltung umstellen müssen. Nichts schien zu helfen. Sie revidierten nochmals die strengen Vorschriften. Immer noch waren Butter, Kochsalz, Käse, Eier, streng verpönt, und jeglicher Genuß von Tabak, Fleisch, Alkohol und Kaffee grundsätzlich untersagt. Aber sie entschlossen sich nun, Kartoffeln, Blumenkohl, Spargel und Bohnen in den Kostplan einzubeziehen, und sie gestatteten den Gebrauch von Kokos- und Haselnußfett. Doch das große Fiasko war da und wollte nicht mehr weichen.
Es schlug 1914. Der Weltkrieg warf seinen Schatten über [66] den Berg und jegliches Interesse erlahmte. Bitter enttäuscht mußte man erkennen, daß die Menschheit sich von dem Evangelium des Vegetabilismus nicht erlösen lassen wollte oder konnte.
Und 1917 begrub Oedenkoven die letzten Illusionen. Er gab seine Zustimmung, daß im Sanatorium Fleisch gegessen werden durfte und die Reformkleidung nicht mehr obligatorisch war.
Es schien, als hätten sich alle dunklen Mächte verschworen, um Oedenkovens Werk heimzusuchen, zu beschmutzen und zu vernichten. Nichts sollte ihm erspart bleiben. Der Untergang schien unaufhaltbar, als ein Herr Theodor Reuß aus England auftauchte, sich als Großmeister mehrerer Londoner Freimaurerlogen ausgab und angeblich mit Rudolf Steiner eng befreundet war. Oedenkoven wurde mißtrauisch, er hielt von all diesen religiösen Kreisen nichts. Aber jede Aussicht, sein Unternehmen zu retten, war ihm jetzt willkommen. Und der Magier Reuß machte seinen suggestiven Einfluß geltend, entwickelte phantastische Pläne und versprach dem Monte Verita unbegrenzte Geldmittel. Oedenkoven überlegte lange, unbehaglich berührt. Er schwankte, er zögerte, aber es gab wohl keine andere Wahl mehr für ihn. Vielleicht hoffte er immer noch auf ein Wunder.
Und er erlebte sein blauestes Wunder.
Reuß gründete mit Oedenkovens Erlaubnis auf dem Berg den OTO, den Ordenstempel des Ostens. Was der Sinn, Zweck und das Ziel dieses Ordens sein sollte, hat nie jemand erfahren. Es gab keine Erklärungen. Bedingungsloser Glaube und restlose Hingabe wurde gefordert. Alles verblieb ein tiefes Mysterium, hinter dem sich eine zynische [67] Geschäftigkeit verbarg, das schmutzige Spiel eines durchtriebenen Hochstaplers.
Alles wurde jetzt mit Geheimnissen umgeben, in magisches Dunkel gehüllt. Mystische Feste und Feierlichkeiten wurden arrangiert. Mary Wigman und Laban mit seinen Schülern traten bei nächtlichen Tanzvorführungen auf, beteiligten sich an Fackeltänzen im Freien und an undurchsichtigen Zeremonien.
Es wurde immer wilder. Den Brüdern und Schwestern des Ordens wurden religiöse Räusche in Aussicht gestellt, Andeutungen erotischer Art und wüster Orgien wurden gemacht. Reuß brauchte alle Mittel, weckte die schamlosesten Gelüste, brauchte alle verlockenden Möglichkeiten, um die Phantasie zu erhitzen, schwüle Stimmungen zu erzeugen und alles in den Nebeldunst des Geheimnisvollen zu verschleiern. Geschäftstüchtige Mitglieder des Ordens warben vermögende Leute und veranlaßten sie zu großen Geldspenden. Liebesbeziehungen und erotische Verbindungen wurden im Namen des Ordens aufgenommen und geschäftlich ausgenützt. Das war geradezu eine Forderung, die den Brüdern und Schwestern der höheren Grade gestellt wurde. Der Gottesgesandte Reuß führte sie dabei an. Die Frauen verfielen seinem dämonischen Reiz. Sie umschwärmten ihn. Alle wollten ihn haben. Und er nahm sie alle.
Ida Hofmann hatte früher schon deutliche Tendenzen geäußert, den Vegetarismus als eine Art Religion zu betrachten. Nun hatte sie sich offen den Okkultisten und Theosophen zugewandt. Abermals enttäuscht, stand Oedenkoven allein. Doch der Berg schien nicht gewillt zu sein, für ihn Gnade walten zu lassen. Ein junges Mädchen, mit dem sich Oedenkoven nun anfreundete, beging plötzlich [68] Selbstmord. Einige Zeit später lernte er eine Engländerin kennen. Die Zuneigung war gegenseitig und stark, aber die Engländerin Isabella war nicht zu einer freien Ehe zu bewegen. Der vielgeprüfte Oedenkoven steckte auch diese Niederlage ein und ließ sich in aller Stille standesamtlich trauen. Als aber seine Frau Isabella sich auch als eine fanatische Verehrerin des gottgesandten Hochstaplers Reuß entpuppte, und der Berg der Wahrheit zum Berg des Irrsinns gemacht worden war, wurde der gute Oedenkoven doch vom Zorn gepackt. Er räumte gehörig auf und jagte den Gesandten Gottes samt Orden zum Teufel.
Die frechste Scharlatanerie auf dem Monte Verita war beendet. Man versuchte sich wieder zu sammeln und zu sich zu kommen. Doch ein weiterer Selbstmord war nicht gerade geeignet, den in Verruf geratenen Berg in ein besseres Licht zu rücken.
Wenn auch im Laufe der Zeit wieder berühmte Maler, Dichter, Tänzer und Musiker den Monte Verita besuchten, die richtige Stimmung wollte nicht mehr aufkommen, – die Überzeugung fehlte. Es war zu viel kaputtgegangen.
»Die ethischen Wegelagerer«, wie Erich Mühsam einmal die zweifelhaften Elemente des Berges genannt hatte, gewannen nun am Rande des Zusammenbruchs die Oberhand und zogen viele andere mit sich. Aberglauben und Gespensterkult blühten. Die Inkarnations-Theorie war nun die große Mode. Ein jeder versuchte den anderen zu übertrumpfen. Sie wetteiferten in krankhaften Übertreibungen und überspannten Besessenheit. Alle waren auf einmal in einem früheren Leben weltberühmte Dichter, Könige, Hetären und Weise gewesen. Nur der aufrichtige Carlo Vester erzählte mit leiser Ironie und mit seinem herzlichsten Lä-[69]cheln, daß er leider in seinem früheren Dasein nur ein einfacher Galeerensträfling gewesen sei, der sich auf dem Lago Maggiore zu Tode gerudert hätte.
Das tollwütige Irrenhaus hatte sich zu einem Tummelplatz lallender Narren verwandelt.
Endlich gab Oedenkoven auf.
Dieser unbändige Berg wollte sich nicht regieren lassen. Im Januar 1920 verließ Oedenkoven zusammen mit seiner Frau Isabella und der kameradschaftlich zu ihnen haltenden Ida Hofmann für immer den Monte Verita und zog nach Brasilien. In Brasilien gründete er eine neue Kolonie, die heute noch in Catalao bestehen soll. Und wenn sie nicht gestorben sind... Sie sind, sie verblieben in Brasilien.
Mit der Götterdämmerung auf dem Monte Verita war es vorbei. Der Berg hatte einen Ausschnitt des Besten und des Schlimmsten erlebt, was die Menschheit hervorzubringen vermag – Genie und Wahn, Beglückte und Selbstmörder, tiefste Aufrichtigkeit und plattesten Schwindel, Fleiß und Faulheit, Kameradschaft und Egoismus, alle Hoffnungen und alle Enttäuschungen mußten über ihn hingehen.
Die Geschichte der Kindheit und Jugend, der Sturm- und Drangjahre des Berges der Wahrheit war abgeschlossen.
Der Monte Verità ruft Europa
So unfaßbar es klingt, Oedenkoven schuf inmitten dieses siedenden Hexenkessels einen mustergültigen Sanatoriumsbetrieb mit verblüffend hohem Niveau. Er hatte seinen ausführlichen Reklame-Prospekt »Provisorische Statuten der Vegetabilischen Gesellschaft des Monte Verita« ausgesandt, und Ida Hofmann konstatierte:
»Das gesamte Leben auf Monte Verita nimmt einen merklichen Aufschwung. Die gesamten Bedingungen für Beteiligte und Mitarbeiter am Unternehmen des Monte Verita sind festgesetzt, und die unablässig einlaufenden [63] Anfragen beweisen das vorhandene Bedürfnis nach veränderten Lebensbedingungen. Der Besuch unserer Anstalt von heilungsuchenden Kranken, Pensionsgästen und Besuchern wird stabiler; Pirzte bilden darunter einen großen Prozentsatz. Henris angeborene Heilgabe hat die günstigsten Erfolge aufzuweisen. – Der Monte Verita ist keine Naturheilanstalt im gewöhnlichen Sinne, sondern vielmehr eine Schule für höheres Leben, eine Stätte für Entwicklung und Sammlung erweiterter Erkenntnisse und erweiterten Bewußtseins, befruchtet vom Sonnenstrahl des Allwillens, der sich in uns offenbart – vielleicht ein Hort für spätere Zeiten, wenn der Kontrast zwischen Idealismus und Materialismus, zwischen Freund und Feind, zwischen gesundem und krankem Leben, zwischen Lüge und Wahrheit oder Gut und Böse zu groß geworden ist, und der Kampf ums Dasein entweder Untergang oder Rettung erheischt.«
Tatsächlich wurde der Berg in jenen Jahren ein geistiges Zentrum, zu dem die Welt draußen mit gewisser Spannung hinsah. Vertreter des fortschrittlichen europäischen Geisteslebens trafen sich nun hier. Die Stimmen vom Berge gaben ein Echo über ganz Europa. Die kulturellen Bestrebungen und Veranstaltungen auf dem Monte Verita fingen nun an, in die Welt hinauszudringen, und übten eine überraschende Anziehungskraft aus.
Die interessante Atmosphäre zog bedeutende Künstler und Wissenschaftler, Revolutionäre, Rebellen und Politiker zum Berg der Wahrheit. Unzählig sind die Namen, unmöglich sie alle zu nennen. Aber wer hätte je geglaubt Bakunin und Krapotkin, Lenin und Trotzki auf dem Monte Verita anzutreffen? Hierher kamen Leoncavallo, Dr. Rudolf Steiner, Emil Ludwig, Erich Mühsam, die Gräfin Reventlow, [64] Arthur Segal, Mary Wigman und der Tänzer Rudolf Laban, Leonhard Frank, Else Lasker-Schüler, Stephan George und Klabund, Paul Klee, Isidora Duncan und Hermann Hesse. Und in späterer Zeit kamen George Kolbe und Victor Adler, Max Piccard, Ernst Toller, die Tänzerin Trümpy, Henri van de Velde, Edwin Fischer, Gustav Stresemann, Alfred Flechtheim und viele, viele andere. Sie alle verbrachten eine Zeit hier, oder sogar ganze Abschnitte ihres Lebens.
Gleichzeitig trafen Ärzte aus den verschiedensten Ländern ein und viele, die an sozialen Experimenten interessiert waren, kamen, um die kooperative Verwaltung des Berges zu studieren und zu diskutieren. Einer der Väter des Sozialismus, der alte August Bebel, kam um zu sehen und Vorträge zu halten.
Es war eine blühende Zeit, positiv und lebendig, in der alle denkbaren und undenkbaren Formen des Geistes- und Seelenlebens ihre große Erneuerung feierten.
Wahrlich, der Berg war geduldig. Er ertrug alles mit der milden Erhabenheit eines Weisen – und dachte sich seinen Teil.