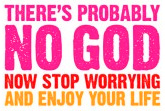25.09.2006 - ana tv - Interview mit Hotte (TV)
Hallo,
auf der Homepage von www.rabensoft.net
ist unter dem Link www.rabensoft.net/webtv/hartzecke.html
ein Interview mit Hotte (Horst Hädrich), einem Verkäufer vom Strassenfeger zu finden.
Klick hier, um es zu sehen.
14.09.2006 - taz: Jan Feddersen: Die unterirdischen Behelliger
Sie geistern durch die U-Bahnen der Metropolen und geben sich alle Mühe, uns zu nerven
Mit der Zeit kann man sie erkennen. Scannen die U-Bahn-Züge kurz vor dem Türenschließen längsseitig ab, meist positionieren sie sich in der Mitte eines Waggons - ihre Tribüne. Dann sagen sie, was sie zu sagen haben: dass sie obdachlos sind, nichts zu essen haben, aber dieser Not könne man abhelfen, spendet man oder kauft eine Zeitung. Stets etwas leiernd, was doch appellativ beim Publikum ankommen möchte. Sie haben ein perfektes Timing gelernt, immer sind sie mit ihrer Klage fertig, um noch den Waggon mit ihrer Ware, der Zeitung, zu durchstreifen oder mit einem Kaffeebecher, in den wir Münzen legen können. Läuft die U-Bahn in die nächste Station, haben sie ihre Aufgabe getan - um in den nächsten Waggon zu wechseln.
Wir, das Publikum, sind bei diesen Akten der Aufdringlichkeit niemals froh. Bei keiner Gelegenheit habe ich erlebt, dass einer oder eine sagt, hey, das ist ja super, da kommt ein Bettler, ein Bedürftiger, dem ich zuhören kann. Alle wirken genervt, aber keiner spricht darüber. Es gibt ja den bösen Scherz, dass einer beim ersten Ton einer Bettlerrede auf diesen zugelaufen wäre, einen Zehn-Euro-Schein in der Hand, sagend: "Schweigen Sie, nehmen Sie dieses Geld und tun Sie, was wir alle tun. U-Bahn-Fahren. Ruhig, sinnierend, lesend, unbehelligt und unbehelligend."
Der Unterschied zur Bereitschaft, die eigenen siechenden Eltern ins teure Pflegeheim zu verbringen, um sich nicht selbst kümmern zu müssen, ja, nicht einmal den Gedanken zuzulassen, dass Pflege der Eltern etwas tödlich Anstrengendes nicht nur sein kann, sondern ja auch meist ist, dieser Unterschied ist gering. Die U-Bahn-Armutsagitatoren wissen dies womöglich nicht bewusst, aber intuitiv spielen sie diese Karte - und müssen es auch, sonst würde man sie ja brüsk als Störer nicht nur erkennen, sondern auch als solche brandmarken wie Jugendliche, die in der U-Bahn überlaut quatschen, weil es nervt und übergriffig ist.
Die Bettelei aber macht uns hilflos, stumm. Armut beißt, sie wirkt so ausgestellt fast obszön. Das Problem ist ja außerdem, dass viele der BettlerzeitungsverkäuferInnen so ausgesprochen routiniert wirken - im Grunde wie Büroangestellte, die ihre Ablage sortieren oder ihren Mailordner verwalten. Das macht wütend, denn arm kann man sein, aber nicht mit ihr kokettieren. Niemand weiß, es bleibt immer ein Verdacht, ob diese behelligenden Aktionen wirklich nötig sind: Verdient die oder der mit ihren Verkäufen nicht, um sich ein auskömmliches Leben zu organisieren? Und verbreiten sie nicht den Verdacht, dass sie eigentlich ganz froh sind, in der U-Bahn Menschen in Verlegenheit zu bringen, statt sich in Büros oder Verwaltungen vom Computer ersticken zu lassen? Kurzum: Genießen die womöglich das, worunter sie nicht so strikt leiden - denn Armut, nicht wahr, setzt bei uns das Gefühl des Leidens frei, der des anderen, der dies aber nicht mehr tun soll, deshalb überhaupt unsere Fantasie, etwas zu spenden oder es zu lassen. Im Übrigen muss man diese Tribunale der Armut aushalten. Tag für Tag. So wie Fahrscheinkontrolleure. Einfach eine Wegelagerei ohne Notausgang, immer versehen mit so etwas wie Gewissen. Letzte Beobachtung: Menschen, die als Einwanderer erkennbar sind, betteln nie. Sie gieren nach Erfolg. Ohne Caritas.
aus: taz, 14.09.2006
28.08.2006 - Die Linkszeitung - LIZ: Ein Leben lang Generalstreik
Was "Strassenfeger" und Dreigroschenoper verbindet
Bei jeder Vorstellung stehender Applaus: Die Dreigroschenoper im Berliner Admiralspalast wird bis 1. Oktober verlängert.
«Ein Leben lang Generalstreik»
Tiefe Freundschaft: Tombrock und Brecht
Berlin (LiZ). Eine Sonderausgabe widmet die Berliner Obdachlosen-Zeitung "Strassenfeger" ihrer Medienpartnerschaft mit der Inszenierung der Dreigroschenoper im neuen Berliner Admiralspalast mit Klaus-Maria Brandauer und Campino, dem Sänger der "Toten Hosen". Der "Strassenfeger" wird vom Selbsthilfeverein für Obdachlose und Arme in Berlin, "mob", herausgegeben und dieser verweist auf eine 70-jährige gemeinsame "Vorgeschichte" mit der Dreigroschenoper.
Bereits in den zwanziger Jahren habe es eine Bruderschaft der Vagabunden gegeben, die recht aktiv gewesen sei, Ausstellungen und einen legendären Vagabundenkongress in Stuttgart organisiert habe. Jene Vagabunden- Bruderschaft habe damals ebenfalls eine eigene Zeitung herausgegeben, den "Kunden", später den "Vagabunden", eine Art historische Vorform des "Strassenfeger" also. Ihre Parole lautete: "Generalstreik ein Leben lang". Einer aus dieser Gruppe nun sei Hans Tombrock gewesen. Tombrock lernte Bert Brecht in Schweden kennen, im Exil. Beide verband von da an eine tiefe Freundschaft.
Die Aufführung der "Dreigroschenoper" in Berlin ist trotz schlechter Kritiken ein wahrer Publikumserfolg und Kassenschlager geworden. Mit 60.000 Eintrittskarten sei die Produktion die "erfolgreichste Theaterinszenierung des Jahres", so der Produzent Lukas Leuenberger. Jede Vorstellung sei vom Publikum mit stehendem Applaus gefeiert worden. Inzwischen ist die "Dreigroschenoper" um eine Woche verlängert worden. Bis 1. Oktober wurden sechs zusätzliche Vorstellungen angesetzt. Eine weitere Verlängerung sei jedoch wegen der Terminverpflichtungen der Darsteller nicht möglich, so die Veranstalter.
linkszeitung.de/content/view/49754/52/
15.08.2006 - Esslinger Zeitung - Verena Großkreutz: Weder Haifisch noch Zähne
Brandauer inszeniert Brechts "Dreigroschenoper" und scheitert auf niedrigem Nivea
Berlin - Schon lange war sie als Sensation zum 50. Todestag Bertolt Brechts angekündigt und gehypt worden: Klaus Maria Brandauers prominent besetzte Inszenierung der Brecht-Weillschen "Dreigroschenoper". Gleichzeitig sollte sie die Wiedereröffnung des Admiralspalastes in der Berliner Friedrichstraße feiern, jenes Gebäudes, das 1910 als Vergnügungsprachtbau seine Pforten aufgetan hatte und 1998 als "Metropol"-Operetten-Theater geschlossen worden war. Mit der Restaurierung des neoklassizistischen Theatersaals war man zwar zur Premiere fertig geworden, das übrige Haus aber war immer noch eine Baustelle. An den Sektgläsern klebte Baustaub.
Brandauer hatte mit dem "Tote-Hosen"-Frontman Campino die Rolle des Mackie Messer besetzt und den Medien damit ein delikates Häppchen in die Arena geworfen. Doch dass der Abend zu einer langweiligen Peinlichkeit werden sollte, zeigte sich bereits, als das Licht im Zuschauerraum ausging. Der Vorhang öffnete sich zu Edgar Elgars berühmtem "Pomp-and-Circumstances"-Marsch, und flugs war im Raum, was Brecht und Weill verbannen wollten: Pathos und Sentimentalität. Hier war einer ohne Konzept und musikalischen Sachverstand ans Werk gegangen.
Personenführung? Fehlanzeige
Was folgte, war eine spannungslose Aneinanderreihung von uninspiriert vorgetragenen Musiknummern und oft dilettantisch gespielten Sprechszenen, die nichts von der bissigen Unterweltstragikomödie übrig ließen. Eine Personenführung war nicht erkennbar. Gottfried John spielte den profitgierigen Bettlerchef Peachum steif und farblos, Katrin Sass als seine Frau setzte auf Ohnesorg-Theater, und Campino war weder Haifisch, noch hatte er Zähne: ein grauer Herr, der nur einmal ein wenig gewaltbereit wirkte, als er seinem Gaunerkollegen völlig unmotiviert eine Flasche auf den Kopf schlug, so dass der arme Mann noch längere Zeit mit den Glassplittern in seinem Hemdkragen zu kämpfen hatte.
So gab die eine Länge der nächsten die Hand. Das konnten auch Birgit Minichmayr als naive Polly Peachum, Michael Kind als korrupter Polizeichef Tiger Brown und Maria Happel als Spelunkenjenny nicht verhindern, die trotz hohem Potenzial weit unter ihrem Niveau blieben. Und Jenny Deimling drehte als Mackie-Geliebte und Polly-Konkurrentin Lucy am Ende zwar mächtig auf, wirkte aber bald hysterisch, weil so viel Extrovertiertheit ins eintönige Einerlei eben auch nicht mehr passte.
Die restlichen Figuren - Huren und Ganoven - standen meist unbeteiligt herum und machten traurige oder debile Gesichter. Das beziehungslose Nebeneinander wurde durch unnötige Umbaupausen noch ermüdender. Einfallslos auch das Bühnenbild. Mit Klavier, Strohballen oder Holzbeingestell ausstaffiert und von einem Stahlgerüst mit Treppe dominiert, langweilten vor allem seine überdimensionierten, übereinander gestapelten Holzschränke, die nur einmal wirklich bespielt wurden: In der Bordell-Szene hurten darin die Huren oder rasierten sich die Beine.
Die Kostüme im Stile der 20er-Jahre wurden bald durch Handygebrauch in Frage gestellt, und warum man die Moritat "Und der Haifisch, der hat Zähne", die im Original am Anfang steht, mitten im Stück brachte, blieb ebenso ungeklärt wie der Sinn der Maßnahme, viele der Songs in einem von oben herabgelassenen, von Lämpchen eingefassten Goldrahmen vortragen zu lassen. Am Ende wurde es zur unfreiwillig komischen Symbolik für den Abend: Brandauer hat seine Schauspieler zu unbeweglichen, gehemmt agierenden Pappkameraden gemacht, denen jegliche Spielfreude fehlte. Zudem wurden die Songs lediglich vorgetragen statt interpretiert. Auch wenn Birgit Minichmayr und Maria Happel ein paar schöne Momente gelangen: Das Deutsche Filmorchester Babelsberg unter der Leitung von Jan Müller-Wieland machte aus Weills knallharter, unsentimentaler Musik ein seichtes, gefälliges Geplänkel.
Dass das Programmheft als Ausgabe der Berliner Obdachlosenzeitung "Strassenfeger" daherkam und von Obdachlosen vor den Türen des Admiralspalastes verkauft wurde, war immerhin eine gute Idee, die allerdings in der Inszenierung weder Widerhall noch Fortführung fand. Ein Bettler, der den Vorhang auf- und zuzog, eine selbstmordgefährdete Hure: Sonst war nichts zu sehen von den Hungernden, den Erniedrigten, den Arbeitslosen.
Weitere Vorstellungen täglich außer montags bis 24. September.
Quelle: Esslinger Zeitung 15.08.2006