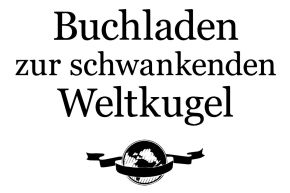15.04.2007 - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - Kristina Vogt: Der Obdachlose als tragische Figur?
Die Grenzen der aristotelischen Poetik: Wie erzählen Zeitungen über die Bewohner der sozialen Exklusionszone? Und wie tun es die Zeitungen der Obdachlosen selber?
VON KRISTINA VOGT
Tagtäglich begegnet man im Stadtbild obdachlosen Menschen, dennoch kommt ein Kontakt so gut wie nie zustande. Über ihre Identität, ihre Herkunft, die Ursachen ihrer Lage ist kaum etwas bekannt. Über ihren täglichen Kampf um Nahrung und um einen sicheren Schlafplatz hört man wenig. Es gibt keine national einheitliche Definition dieser Bevölkerungsgruppe und nur in Teilen, auf regionaler Ebene, unregelmäßig erscheinende, statistische Erfassungen, was die „Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe“ seit langem anprangert.
Das Bild der obdachlosen Menschen wird darum vor allem durch die Medien geprägt. Doch wie wird dort die Wirklichkeit dieses Personenkreises dargestellt? Welche ihrer Geschichten werden erzählt? Sichtet man beispielsweise Artikel der zwei auflagenstärksten Berliner Tageszeitungen – „Berliner Zeitung“ und „BZ“ – und der drei Berliner Straßenzeitungen, „Stütze“, „motz“ und „Strassenfeger“, dann wird deutlich, dass die Skripte der Genres „Bericht über Obdachlose“ kaum Gemeinsamkeiten aufweisen. Wonach wählen die Medien aus, was sie berichten?
Schon Aristoteles beschrieb am Beispiel von Ödipus, dass die Essenz einer guten Tragödie ein in sich geschlossener Plot ist. So solle bei dem Zuschauer Mitleid mit und Furcht um den tragisch unschuldig schuldig gewordenen Helden bewirkt werden. Eine weitere Komponente sei die Furcht, selbst schuldlos falsch zu handeln. Katharsis oder Reinigung werde möglich durch die empfundene Läuterung des Zuschauers und seinen Erkenntnisgewinn nach Betrachtung des Schauspiels.
Die Tragödien, von denen die Zeitungen berichten, haben jedoch den Anspruch auf Wahrheit: Werden Obdachlose in den untersuchten Tageszeitungen überhaupt plastisch dargestellt und bleiben nicht nur anonyme Objekte der Hilfeleistungen, so entwerfen die Artikel vornehmlich ein stereotypes Bild des männlichen „Penners“. Wird dem Pariser Clochard traditionell Charme und Esprit angedichtet, so geht dieser dem deutschen Äquivalent aber gänzlich ab. Auch Frauen, Kinder und Jugendliche kommen in den Berichten der Tageszeitungen kaum vor. Dies trotz der Tatsache, dass schon 2004 unter den 6973 „Wohnungslosen“ 950 alleinstehende Frauen und 454 Minderjährige verzeichnet waren und insgesamt noch mit einer weitaus höheren Dunkelziffer gerechnet wird.
Als tragische Figuren taugen die „Penner“ der Tageszeitungen nicht. Für Deutschland konstatiert der französische Soziologe Serge Paugam einen nicht reflektierten Umgang mit dem Phänomen „Armut“: In der Leistungsgesellschaft verstörten die stigmatisierten Armen durch die Möglichkeit des Scheiterns. Ihnen werde entsprechend der Maxime des Wohlfahrtsstaates geholfen, ohne jedoch ihre Reintegration anzustreben oder spezifische Problemlagen zu erörtern. Doch wer sind dann die Helden in den allwinterlichen Obdachlosenepen, in denen die Obdachlosen selbst zu Nebenfiguren werden? Es könnten die Helfenden sein: Staatliche und private Organisationen, die anlässlich von Weihnachten und Winterkälte Spendenappelle an die Bevölkerung richten; Prominente aus Showbusiness, Politik und Wirtschaft, die auf Weihnachtsfeiern Obdachlose bewirten und unterhalten; die alte Dame, die gegen die Kälte eigens gestrickte Socken spendet. Antagonisten scheint es in diesen Erzählungen nicht zu geben. Die Lösung des Konfliktes scheint schon die Hilfeleistung per se zu sein, die Besänftigung der Normabweichung. Eine Katharsis findet durch die Bekräftigung barmherziger Einstellungen beim Leser statt. Parallel dazu werden wohlfahrtsstaatliche Werte revitalisiert.
Den lobbylosen Obdachlosen aus einer bewusst linken Perspektive heraus Gerechtigkeit zu verschaffen, machen sich die Straßenzeitungen zur Aufgabe. Ihre Redaktionen setzen sich in Berlin partiell aus ehedem Obdachlosen zusammen, und allesamt bieten sie Reintegrationsprojekte an, die maßgeblich durch den Straßenzeitungsverkauf der Berliner Clochards finanziert werden. Sie schreiben ein anderes Stück: Obdachlose sind unschuldig schuldig gewordene Protagonisten mit vielgestaltigen Biographien und Fähigkeiten. Hier gibt es Antagonisten: der Abbau des Wohlfahrtsstaates, der Kapitalismus und die gleichgültige Konsumgesellschaft, deren Hilfe den Straßenzeitungen bis auf wenige Ausnahmen unzulänglich erscheint. Die Katharsis kann hier nur Labsal sein vor Beginn des nächsten Aktes der unendlichen Tragödie.
Wie zumindest in den Leserbriefen der Straßenzeitungen deutlich wird, sind die Leser nach der Überwindung erster Barrieren offen für das alternative Skript. Es mangelt den Tageszeitungen jedoch an Anreiz und den Straßenzeitungen an Ressourcen, um eine neue Wirklichkeit massenwirksam zu entwerfen. Man liest also weiter alte und neue Tragödien und hofft auf Katharsis.
Lektürehinweis: Paugam, Serge, „Armut und soziale Exklusion: Eine soziologische Perspektive“, in: Hartmut Häußermann u. a. (Hrsg.), An den Rändern der Städte. Armut und Ausgrenzung. Frankfurt am Main 2004
aus: FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG, 15. APRIL 2007, Nr. 15
10.04.2007 - Tagesspiegel - Christian van Lessen: Doppelte Freude
Christian van Lessen ist dankbar für die begeisterungsfähigen Reisenden
In diesen Tagen aber stellen wir fest, dass der Typ mit der weinerlichen Stimme, die obdachlose Frau und die Musiker ein wirklich dankbares Publikum haben. Sie verkaufen Magazine, sie scheffeln Münzen und ihre Musik wird unter Bravo- und Zugaberufen beklatscht. Wie schön, dass so viele Touristen in der Stadt sind. Die Berlin-Besucher freuen sich über das bunte Berlin und wir Berliner sind froh, dass wir zu Ostern ein paar Tage in Ruhe gelassen werden. http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/10.04.2007/3190263.asp
03.04.2007 - Gransee Zeitung - Mit dem Straßenfeger auf Tour
Olaf Müller aus Hohen Neuendorf ist Berlin-Brandenburgs fleißigster Zeitungsbote
Einfach faul zu Hause auf der Couch herumzuliegen, das kommt für Olaf Müller aus Hohen Neuendorf nicht in Frage. Der 53-jährige Hartz IV-Empfänger trägt schon seit mehr als zehn Jahren den „Straßenfeger“ aus. So kommt er unter Menschen und hat eine spannende Aufgabe.
Von Georg-Stefan Russew
„Nichts ist schlimmer, als zum gar nichts Tun verdonnert zu sein!“, sagt Olaf Müller. Der 1953 in Wildau bei Königs Wusterhausen geborene Müller hat in Berlin den Beruf des Bierbrauers von der Pike auf an erlernt.
Viele Millionen Hektoliter des Gerstensaftes hat er in seiner langen Zeit an den Sudkesseln zusammengebraut. „Hauptsächlich Exportbier wurde bei uns gemacht.“ Er hat bei Bärenquell in Berlin gelernt und später bei Engelhardt in Berlin-Stralau gearbeitet. „Als die Firma zugemacht hat, wurde ich 1994 arbeitslos. Einen neuen Job gabs für mich als Bierbrauer nicht. Viele Bewerbungen waren erfolglos“, so Müller.Zeit, sich lange zu grämen, hatte Olaf Müller nicht. Als er vor 13 Jahren mit der S-Bahn nach Berlin fuhr, traf er einen Verkäufer der Obdachlosenzeitung „Straßenfeger“. „Ich habe ihn angesprochen und er hat mir die Adresse im Prenzlauer Berg gegeben. Ich habe mich gleich beworben und wurde genommen“.
Seitdem ist er ständig für die Straßenzeitung auf Achse.„Wenn ich auf Tour bin, fühle ich mich pudelwohl. Klar wäre ein richtiger Job besser. Aber so liege ich dem Staat nicht so auf der Tasche“, meint der Bierbrauer.Am Verkauf einer normalen Zeitung ist er mit rund 80 Cent beteiligt.
Bei der Zustellung für Abonnenten gibt es nichts. „Der Verdienst wird mir ganz klar auf die 345 Euro Hartz IV angerechnet. So bekomme ich neben Miete für meine Ein-Raum-Wohnung rund 297 Euro vom Staat“, erklärt Olaf Müller.Wenn er als Bierbrauer wieder einen Job finden würde, würde er mit wehenden Fahnen an seine Kessel zurückkehren, „aber ich in meinem Alter bin leider nicht mehr gefragt. Dabei kenne ich die Geheimnisse des Bieres aus dem FF“, so Müller.
Als „Straßenfeger“-Verkäufer ist der 53-Jährige auch die Wucht in Tüten. Geschickt versteht er es, seine Hefte an den Mann oder an die Frau zu bringen. „Früher habe ich auch vor Einkaufsmärkten gestanden und versucht, Kasse zu machen. Aber das war keine gute Idee“. Heute hat er sich fast ganz Brandenburg als Revier ausgesucht. Für diese Zwecke hat sich Müller eine Gesamtnetzkarte der Bahn für Berlin-Brandenburg gekauft und klappert Fürstenberg genauso ab wie Perleberg, Neuruppin, Zossen oder Teltow. „Ich habe mir richtige Touren zusammengestellt, die ich im 14-Tage-Rhythmus abfahre“.
Und dabei geht Müller auf die Menschen zu, geht in die Geschäfte und bietet die Zeitung zum Kauf an. „Hier kann ich meine Kunden direkter ansprechen, und die Verkaufsquote ist tausendmal besser als vor einer Kaufhalle“, berichtet er. Aber nicht immer klappt es. „Ganz oft muss ich unverrichteter Dinge abziehen.“ Und das tut weh, auch wenn Müller dies versucht zu kaschieren.
In seinem Alter geht es die Treppen nicht mehr so gut hinauf. Immer wieder muss er schnaufend pausieren. Auch hier murrt er nicht und zieht seine Tour weiter durch. Ab und zu muss er sich hinsetzen. Dies dauert nie länger als fünf Minuten. Dann geht es weiter. Sein strikter Zeitplan wird von den Zugverbindungen diktiert. Gestern startete er von Oranienburg aus kurz nach 9 Uhr, um kurz vor 10 Uhr auf seine Fürstenberger Runde zu gehen. Gegen 11 Uhr machte er sich in Richtung Gransee auf.
Bei seinen Touren legt er jährlich über 20000 Kilometer zurück. Immer ist er freundlich, nett und ehrlich. Als ihm eine Kundin in der Fürstenberger Schloss-Parfümerie einen Euro zu viel gab, machte er sofort die Frau darauf aufmerksam und gab ihn ihr sofort zurück. „Ehrlichkeit ist für mich das Wichtigste. Wo würde ich hinkommen, wenn es nicht so wäre“, sagt Müller leise.Mit seinem Leben ist er zufrieden. „Klar habe ich noch Träume. Die behalte ich aber lieber für mich, weil die nur mir gehören“, sagt Müller, zählt seine Zeitungsexemplare durch und trottet in Richtung Bahn. In 14 Tagen wird er wieder nach Fürstenberg und Gransee aufbrechen. In der nächsten Woche ist Neuruppin und Oranienburg dran.
Kurze Schlemmerpause beim Fleischer in Fürstenberg. Eine Bockwurst gibt wieder Kraft.
Nur mit Hemd und Weste bekleidet raus bei Wind und Wetter.
01.04.2007 - fluxx - Sarah Zimmermann/Anja Kammer: Die nackte Wirklichkeit
Die unangenehm riechende Dame ist nach anfänglicher Scheu überraschend freundlich. Sie ist ungefähr 40 Jahre alt, arbeitete früher für den Tagesspiegel und verkauft seit fast einem Jahr die „Motz“, wobei sie damit angeblich sogar mehr Geld verdient als in ihrem früheren Job. Durch den Verkauf der Straßenzeitung erhofft sie sich für ihre Zukunft einen Pressepass. Sie selbst behauptet, bisher vorwiegend gute Erfahrungen mit dieser Art von Arbeit gemacht zu haben. Allerdings meint sie: „Man wird mehr von Kollegen angeschimpft, als von Fahrgästen.“ Revierneid spiele dabei eine große Rolle. Ihre Fahrkarte und alles andere muss sie natürlich selbst bezahlen. Alles in Allem kommt sie sehr gut mit ihren Einnahmen aus, wobei zu bedenken ist, dass sie lediglich für einen ihrer drei Söhne Kindergeld bekommt. Bei den drei bis vier Stunden, die sie täglich mit dem Verkauf verbringt, verdient sie bis zu zwanzig Euro am Tag.
Unser Ziel ist der berühmte Bahnhof Zoo, der bereits eine allgemein bekannte Anlaufstelle für Obdachlose und Stricher ist. Im Bahnhofsgebäude sind wir einer Flut von multimedialen Reizen ausgesetzt; die neuesten X-Boxen und Großbildfernseher ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Direkt hinter dem Bahnhof allerdings riecht es unangenehm nach Kot und anderen Exkrementen. Hier befindet sich auch eine von zwei
Sein Name ist Hans* und er wirkt verstört. Er klingt weniger optimistisch und zufrieden als Elke. Seit 10 Jahren verkauft er den „Straßenfeger“ und ist in seiner Verkaufslaufbahn nicht nur beleidigt, sondern auch des Öfteren verprügelt worden. Motz-Verkäufer könne er gar nicht ausstehen, erzählt er. Da gebe es oftmals Ärger. Das Verhältnis zu den Straßenfeger-Kollegen sei hingegen gut, ein richtiger Zusammenhalt.
Wir machen eine kleine Pause am Brandenburger Tor und treffen zufällig einen weiteren Straßenfegerverkäufer; dies ist seine Geschichte.
Als nächstes machen wir uns auf den Weg zur Prenzlauer Allee 82, der Zentrale des Straßenfegers. Ein dreckiger Altbau-Durchgang führt in eine Art überdachten Innenhof. Das ist das „Café Bankrott“. Man sieht Menschen an sperrmüllartigen Tischen sitzen und ein Barmann verkauft zu sehr niedrigen Preisen Getränke und Imbissküche. Das Radio spielt „Kung Fu Fighting“ von Carl Douglas. In der hintersten Ecke kann man einen Mann entdecken, der aufmerksam am einzigem Internet -PC nach Arbeitsstellen sucht. Die Atmosphäre ist entgegen aller Erwartungen herzlich und zuvorkommend, Sitzplätze werden angeboten und Interesse bekundet. Am anderen Ende des Hofes ist ein kleiner Raum mit etwa 7 Personen, die angestrengt vor ihren Arbeitsplätzen hocken. Durch eine große versiffte Glasfassade kann man nichts näheres erkennen.
*Wodurch werden Ihre Arbeitsplätze finanziert?
Von Sarah Zimmermann und Anja Kammer