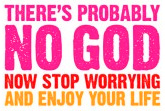Klaus Stark über die Berliner U-Bahn und Berufe, die man nicht wirklich haben will
Wenn man viel mit der Berliner U-Bahn unterwegs ist, trifft man ab und zu einen Trupp Plakatierer. Die nehmen die riesigen Werbetafeln an der Wand über den Schienen herunter, bestücken sie auf dem Bahnsteig mit neuen Plakaten, klettern übers Gleis zurück und bringen sie wieder an ihren alten Platz. Da verschwindet dann das angeblich klimaneutrale Atomkraftwerk schon mal blitzschnell unter dem neuesten Harry-Potter-Film.
Zwei kleben, einer hält die Leiter, ein Vierter trägt die Verantwortung. Ganz so wie im realen Leben, denkt man sich. Und das alles in den kurzen Pausen zwischen zwei U-Bahn-Zügen.
Das Schlimmste, was einem in der U-Bahn passieren kann, am frühen Morgen, ohne Kaffee und ohne Frühstück im Magen, ist aber eine Schulklasse. Alle drängeln wild durcheinander, reden gleichzeitig und ihre schrillen Stimmen vertreiben die letzten Reste von Schlaf und Traum.
Man fängt die gequälten Blicke der berufsmäßigen Betreuer auf und wenn dann innerhalb von nur fünf Stationen zum dritten Mal einer die Obdachlosenzeitung „Straßenfeger“ verkaufen will, denkt man sich: Ach, eigentlich ist man doch ganz zufrieden mit dem eigenen Job.
1800 Jugendliche und junge Erwachsene sind obdachlos. Manche sind trotz Kontakt zu den Ämtern auf der Straße gelandet - weil die richtigen Hilfen fehlen.
Still und geduldig wartet der junge Punk. Wartet darauf, dass sich die schwere Eisentür endlich öffnet. Reden möchte er jetzt nicht, und deshalb bleibt die Frage nach seinem Namen unbeantwortet. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, sitzt er auf dem Boden, starrt ins Leere und bläst den Rauch einer Zigarette in die kalte Winterluft. Neben ihm, das Gesicht zwischen den Armen versteckt, schläft zusammengekrümmt seine Freundin. Es ist 14 Uhr, und am Berliner Zoo warten die zwei Jugendlichen auf die Essensausgabe der Bahnhofsmission.
Alltag und Legende
Aus der Geschichte der Oderberger Straße
Von Albrecht Molle
Mit nur knapp 600 Metern ist sie einer der eher kurzen Verkehrswege in Prenzlauer Berg. Doch in der Beliebtheitsskala rangiert die Oderberger Straße, die 1873 nach der nordöstlich von Berlin gelegenen Kleinstadt Oderberg benannt wurde, auf einem der vorderen Plätze. Das war nicht immer so. Nachdem sie 1871 im Zuge der Berliner Stadterweiterung zwischen der Kreuzung Schönhauser Allee/Choriner Straße und der Eberswalder Straße durch das Gelände einer Baumschule gelegt und danach im Akkordtempo mit Mietskasernen flankiert worden war, herrschte für das Gros der auf der Suche nach Lohn und Brot zumeist aus ländlichen Gebieten zugezogenen Neu-Berliner der graue Alltag jener Zeit. Sie wohnten in den Seitenflügeln und Quergebäuden und verrichteten ihre Notdurft auf Abtritten in den engen Hinterhöfen, während die Vorderhäuser mit ihren spätklassizistischen Fassaden, die der Straße einen vornehmen Anstrich gaben, den Gutsituierten vorbehalten waren.
Feuerwache und Stadtbad
Dennoch war es schon damals in mancher Hinsicht durchaus vorteilhaft, in der Oderberger Straße zu leben. Denn nachdem 1883 in der Nr. 24 ein Feuerwehrdepot eingerichtet worden war, das heute als älteste noch in Betrieb befindliche Feuerwache Deutschlands gilt, lebte es sich hier zumindest im Brandfall einen Tick sicherer als anderswo. Und als am 1. Februar 1902 am anderen Straßenende die vom damaligen Stadtbaudirektor Ludwig Hoffmann erbaute Volksbadeanstalt mit Schwimmhalle sowie Brause- und Wannenbädern öffnete, erwies sich auch dies für die Bewohner des Viertels, in dem nur sehr wenige Wohnungen ein Bad hatten, als wahrer Segen, zumal man die Nutzungsgebühr »im Interesse der Volkshygiene« niedrig hielt.
Die Ereignisse, denen die Oderberger Straße ihren legendären Ruf verdankt, liegen dagegen nicht so lange zurück. In den 1980er Jahren –die Straße lag im Grenzgebiet und war eine Sackgasse, die Mauer verlief quer über die angrenzende Bernauer Straße– gab es Pläne, die Gründerzeithäuser abzureißen und durch Plattenbauten zu ersetzen. Dagegen formierte sich Widerstand in Gestalt der Bürgerinitiative »EntwederOderberger«, der es gelang, den Wohnbezirk der Nationalen Front (WBA) zu unterwandern und mit dem findigen Kiezaktivisten Bernd Holtfreter den Vorsitzenden zu stellen. Gemeinsam mit Anwohnern und Architekten wandte man sich gegen die Abrisspläne, bis der Berliner SED-Chef Günter Schabowski sie im Panzerschrank verschwinden ließ. In den maroden Wohnungen, aus denen viele Altmieter in Neubaugebiete an der Peripherie verzogen waren, fanden vor allem jene Unterschlupf, die auf dem »ordentlichen« Weg wohl niemals eine Bleibe in Berlin gefunden hätten - Künstler, Freiberufler und Hochschulabsolventen, aber auch systemkritische Aufmüpfige. So entstand eine illustre Mischung aus Leuten mit hoher Qualifikation, eigensinnigen Ansprüchen und ausgeprägtem Selbstbewusstsein.
Einen weiteren Coup landete die Bürgerinitiative mit dem Projekt »Hirschhof«, einer Zusammenlegung mehrerer verödeter Hinterhofflächen im Blockinnenbereich zwischen Oderberger Straße und Kastanienallee, die mit Unterstützung des Gartenamts, zu einem grünen Refugium gestaltet wurde, in dem man ohne staatliche Reglementierung diskutieren, musizieren, Theater spielen und Filme anschauen konnte. Das Amt hatte dafür 360.000 Mark locker gemacht und Baumaterial zur Verfügung gestellt. Die taz sprach damals von einem »wohl einmaligen Bündnis zwischen Bürgerinitiative und lokaler Staatsmacht«.
Nach der Wende stand das Kürzel WBA dann für »Wir bleiben alle!«, denn in den frühen 90er Jahren bildete sich, von den Aktivisten in der Oderberger Straße initiiert, ein Aktionsbündnis gegen die im Zuge der Modernisierung einsetzende Mietervertreibung. Den Bevölkerungsaustausch in den Sanierungsgebieten konnte es nicht verhindern. Auch im Kiez an der Oderberger Straße lebt heute nur noch etwa ein Fünftel der damaligen Mieterschaft. Dafür hat sich die Zahl der Kneipen, Restaurants, Schankvorgärten, Bars, Mode- und Second-Hand-Läden vervielfacht und für ein neues Flair gesorgt.
Albrecht Molle
aus: VorORT, Nobember 2007, Seite 13
Quelle: http://www.mieterberatungpb.de/download.php
Herausgeber: Mieterberatung Prenzlauer Berg, Gesellschaft für Sozialplanung mbH
Redaktion und V.i.S.d.P.:
Albrecht Molle & Hartmut Seefeld
E-Mail: \n
Anderes Foto als das hier verwendete im Originalbeitrag!
15.05.2003 - Oderberger Str. 12 / Wohnungspolitische Selbsthilfe 1999 - 2004
Vorarbeiten und Sanierung (1999 - 2003)
|
Zeitgleich zum Abschluß des Erbbaurechtsvertrages mit der Eigentümerin hat der Verein bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Programms „Wohnungspolitische Selbsthilfe", ModInst RL 96 gestellt. Der Fördervertrag konnte im Jahr 2000 abgeschlossen werden. Das Förderprogramm sieht dabei vor, daß wenigstens 15% des Bauvolumens durch die Selbsthilfegruppe in Eigenleistung erbracht werden („Muskelhypothek").
Ausschlaggebend für die Entscheidung des Vereins, mit der Eigentümerin einen Erbbaurechtsvertrag abzuschließen und bei der Senatsverwaltung einen Antrag auf Förderung zu stellen, war die Überlegung, daß auf diesem Wege zunächst Arbeits- und später Wohnmöglichkeiten für obdachlose, ehemals obdachlose, arme und ausgegrenzte Menschen geschaffen werden. Außerdem wird dieses Vorhaben als weiterer Schritt der Institutionalisierung, Verstetigung und Nachhaltigkeit des Selbsthilfeansatzes des Vereins gesehen.
Neben der Nutzung des Hauses durch Wohnungen und gemeinnütziges Gewerbe (Vereinsbüro und Trödelladen) ist die Schaffung von Gemeinschaftsflächen (hier: Ausbau der Durchfahrt des Quergebäudes) sowie eine Hofbegrünung ausdrücklich vorgesehen. Auch ist eine Solaranlage zur Energiegewinnung vorgesehen.
Nach Fertigstellung der Sanierung voraussichtlich im Mai 2003 ist die Vermietung in Selbstverwaltung durch den Verein vorgesehen. Vorrangig ist dabei der Abschluß von Mietverträgen mit armen und ausgegrenzten Menschen, Obdachlosen, ehemals obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen. Weiterhin ist vorgesehen die Nutzung durch gemeinnütziges Gewerbe; das Vereinsbüro wird im Quergebäude einziehen, und im Souterrain im Vorderhaus ist ein gemeinnütziger Trödelladen des Vereins geplant. Nach Fertigstellung der Wohneinheiten im Vorderhaus und Quergebäude in Selbsthilfe durch die zukünftigen Bewohner bzw. Nutzer werden reguläre Mietverträge abgeschlossen. Ausschlaggebend dafür ist die Überlegung, in dem Haus keine Einrichtung der Obdachlosenhilfe zu schaffen, sondern integrierend zu wirken, indem normale Wohn- und Mietverhältnisse hergestellt werden. Durch die Anbindung an den Verein und durch gewachsene Selbsthilfestrukturen, aber auch durch die Einbeziehung von Betreuungsformen im Einzelfall können die Hilfeangebote gewährleistet werden, die im Einzelnen benötigt werden.
Nach Fertigstellung der Wohneinheiten im Vorderhaus und Quergebäude in Selbsthilfe durch die zukünftigen Bewohner bzw. Nutzer werden reguläre Mietverträge abgeschlossen. Der Kreis der Selbsthelfer bildet sich aus Menschen, die über die Arbeit des Vereins „mob - obdachlose machen mobil e.V." und seiner Teilprojekte „strassen|feger" (Strassenzeitung), „Kaffe Bankrott" (Treffpunkt und Notübernachung), „Trödelpoint" (Trödel- und Wohnungseinrichtung) erreicht werden. Ihnen ist gemeinsam, daß sie arm und ausgegrenzt, häufig auch obdachlos oder ehemals obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht sind. Hinzu kommen häufig eine Reihe weiterer Schwierigkeiten.
Erläuterungen zur Finanzierung:
- Der Verein mob e.V. hat mit der Eigentümerin des Grundstücks im Jahr 1999 einen Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 50 Jahren geschlossen.
- Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt über das Berliner Förderprogramm „Wohnungspolitische Selbsthilfe", ModInst RL 96 des Landes Berlin. Die Grundsätze dieses Förderprogrammes sind:
- 42,5 % Förderung,
- 42,5 % Darlehen,
- 15,0 % Eigenanteil, der in Eigenleistung („Muskelhypothek") zu erbringen ist. - Das Programm "Wohnungspolitische Selbsthilfe", ModInst RL 96 des Landes Berlin wird gegenwärtig (Stand: Juni 2001) in Frage gestellt. Sollte es zu einer Erhöhung des zu leistenden Eigenanteils kommen, werden in Zukunft Projekte wie das unserige grundsätzlich nicht mehr durchführbar sein.
- Auch ohne diese Einschränkung ist das Programm nicht völlig unproblematisch. Die Förderung bezieht sich ausschließlich auf die Baukosten. Bei dem durchführenden Verein ist damit ein hoher Organisationsgrad vorausgesetzt, um die anfallenden Arbeiten zu leisten. Auch fallen eine Reihe von Gebühren an, deren Finanzierung nicht einfach ist, d.h. der Eigenanteil ist insgesamt wesentlich höher, als allein nur die 15% der zu erbringenden baulichen Selbsthilfe.
- Nicht gefördert sind zum Beispiel die Kosten und die Arbeit, die dem Verein aus seiner Rolle als Bauherr entstehen. Insbesondere die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten wurden ehrenamtlich erbracht. Auch sind wünschenswerte Ausbauten wie die Errichtung einer Solaranlage auf dem Dach nicht aus dem Förderprogramm heraus finanzierbar.
- mob - obdachlose machen mobil e.V.
- Land Berlin
- Investitionsbank Berlin
- Architekten
- Bauhaupt- und Baunebengewerke
- Selbsthilfegruppe
- Selbsthilfebauleiter
- Mieterberatung
- Sanierungsbeauftragter des Landes Berlin
- Bezirksamt Pankow von Berlin - Sanierungsverwaltungstelle
mob - obdachlose machen mobil e.V./ der strassen|feger
Prenzlauer Allee 87, 10405 Berlin
mail:
Tel: 030 - 46 79 46 11
Fax: 030 - 46 79 46 13