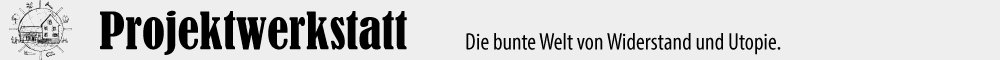von Pamo Roth, Fotos: Bernd Lammel
Obdachlosenzeitungen sind ein Sympathieträger. Oft kommen die Straßenverkäufer in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Käufern und Interessenten ins Gespräch. Meist geht es dabei um Biografien und persönliche Schicksale. Doch wieviel Einfluss haben die Obdachlosen eigentlich auf die redaktionellen Inhalte der Blätter, die sie verkaufen? Ein Besuch bei der motz-life, einer Redaktion von Obdachlosen in Berlin
Notübernachtung in der Weserstraße im Osten Berlins, sieben Uhr morgens. Die frisch gedruckte Straßenzeitung motz ist angeliefert, damit sich die Straßenverkäufer damit versorgen können. Michael Putzar, genannt Mikele, ViSdP der motz und Hauptverantwortlicher für die motz-life, sitzt an einem Tisch im Aufenthaltsraum. Der Raum ist gleichzeitig Küche, Wohnzimmer, motz-Vertriebsstation, Büro und motz-life-Redaktion. Auf dem Tisch steht eine Kanne frischer Kaffee, an der jeder sich bedienen kann. Auch das Päckchen Tabak für Selbstgedrehte ist für alle da. Die Ausstattung ist schlicht und liebevoll gepflegt. An der Wand hängen persönliche Erinnerungsfotos. Das Prinzip motz-life funktioniert auf Augenhöhe: „Man piept sich untereinander an.“ Die Themenschwerpunkte sind Monate im Voraus ersonnen.
Obdachlose – Wohnungslose, wie es formal richtig heißt –, die schreiben wollen, geben ihre Artikel sowohl handgeschrieben, per Schreibmaschine getippt oder digital an Mikele: „Das ist zum Teil ein ganz schönes Chaos. Aber es soll ja jeder sagen, was und wie er es will.“ Mikele trägt Geldbeträge in einen kleinen Quittungsblock ein.
Die Straßenverkäufer geben das, was sie gerade „auf Tasche haben“, und erhalten eine motz für 40 Cent, die sie für 1,20 Euro verkaufen. Mal sind es 20 Euro, die Mikele hingestreckt werden, mal 2 Euro. Mal wird der nächste Artikel abgesprochen oder der letzte kommentiert, manchmal fällt nur ein Wort. „Die Straßenzeitung ist ja auch aus dem sozialkritischen Aspekt entstanden, dass man den Leuten etwas in die Hand geben wollte, damit sie eine Zeitung verkaufen, Geld verdienen und in ein Kauf-Verkauf-Verhältnis und ins normale Leben treten.“ Außerdem soll Beschaffungskriminalität verhindert werden.
Die Zwei-Klassen-Redaktion
2000 entstand die motz-life aus einer Not heraus. Christian Linde, Chefredakteur und zugleich einziger angestellter Redakteur der motz, hatte sich außerstande gefühlt, alle zwei Wochen eine motz-Ausgabe zu füllen. Eine zweite Redaktionsstelle sollte helfen, doch dafür hatte der gemeinnützige Verein kein Geld. Die von der motz finanzierte Notunterkunft sprang ein. Michael Krahn, ehemals zur See gefahren, lange Jahre obdachlos und schließlich Leiter der Notunterkunft, schlug vor, eine zweite Ausgabe monatlich mit Hilfe der Wohnungslosen aus der Notunterkunft zu füllen – die motz-life war geboren. Ohne Vorlauf, ohne journalistische Kurse. Schwerpunkt ist hier die „Arbeit mit Betroffenen, die eine stark integrative Wirkung hat“, wie die motz-Homepage aufklärt.
Vom journalistischen Knowhow der motz-Redaktion kann die motz-life allerdings wenig profitieren. Linde, langjähriger Journalist, hat nach Auskunft der motz-life-Mannschaft noch kein einziges Mal die Notunterkunft besucht. „Selbsthilfe statt Hilfe“ lautet hier das Prinzip, und das hört sich auf der Homepage der motz so an: „Ganz im Sinne der Selbsthilfe-Idee wird hier sehr erfolgreich auf staatliche Finanzierung und professionelle Unterstützung durch Nichtbetroffene verzichtet.“ So gilt die motz-life als boulevardeske „Bunte von unten“ – die motz als investigativer Berliner Sozial-Spiegel.
„Geizt mit Anerkennung, Anteilnahme und Förderung“
Diese qualitativ bedingte Aufteilung der Redaktion in zwei Klassen wird durch die örtliche Trennung zementiert: Die motz-life entsteht in Friedrichshain, die motz in Kreuzberg 61 mit „Linde und zwei, drei Leuten aus seinem Dunstkreis“, so Stefan Schneider, Gründungmitglied der motz und ehemaliger Redakteur des Straßenfegers. Informationen zwischen den Redaktionen fließen nur einseitig. Während die motz-life der motz ihre Themenvorschläge für die nächsten Monate regelmäßig schickt, erfährt sie im Gegenzug das, was die motz schreibt, erst, wenn die frisch gedruckte Ausgabe an die Notunterkunft ausgeliefert wird: „Es ist noch nicht einmal ein Informationsgefälle; es herrscht Funkstille“, fasst Mikele den Workflow zusammen.
Auch personelle Überschneidungen im Autorenstamm sind die Ausnahme. Ein Zeitungsverkäufer, der bisher für die motz unter dem Pseudonym Findikus schrieb, wechselte zu den Autoren der motz-life. Über die Gründe will er nicht sprechen. Aber er hinterließ eine sprechende Kolumne in der 100. Ausgabe der motz im April dieses Jahres: „Kein Hätschelkind“. Darin sagt er über die intern als „Schmuddelmotz“ bezeichnete Zeitung: „[..] dieses Misstrauen hat sich bis heute in manchen Köpfen festgesetzt.“ Auch er bemängelt die Zwei-Klassen-Redaktion: „Anzumerken bleibt, was Kritikern innerhalb des Vereins immer wieder Wasser auf die Mühlen gibt, dass die motz-life bis heute zu keiner ‚erwachsenen‘ Zeitung herangewachsen ist. Die Frage sei aber auch erlaubt, ob ein derartiger Reifeprozess überhaupt (noch) im Interesse der Macher oder der aktiven Leserschaft liegt?“ Offen spricht er den Missstand an, dass „die Zeitung kein Hätschelkind des Herausgebers ist, der mit Anerkennung, Anteilnahme und Förderung, ja sogar mit innerbetrieblicher Kommunikation geizt“.
Motz! Mich! Nicht! An!
Gern hätten wir die Perspektive der motz-Redaktion geschildert. Leider war das unmöglich. Nachdem sich die Autorin dieses Artikels mit der motz-life im Büro der Layouter getroffen hatte, um auch über den Produktionsprozess berichten zu können, wurde sie am Telefon vom Chefredakteur der motz beschimpft. Eigentlich war ein Interview mit Christian Linde über die motz verabredet. Doch dazu kam es nicht. O-Ton Linde: „Was erlauben Sie sich, dass sie einfach zu unseren Layoutern ins Büro gegangen sind. Da haben Sie sich die Erlaubnis von der Geschäftsstelle des Vereins zu holen. Das können nicht wohnungslose Leute erlauben!“ Die Frage nach Mitspracherecht oder gar Kommunikation auf Augenhöhe, die sich nach diesen Äußerungen aufdrängte, konnte nicht mehr gestellt werden – Linde legte einfach auf.
Für Stefan Schneider ist die Antwort auf die Frage nach dem Mitspracherecht der Obdachlosen in den Straßenzeitungen eindeutig: „Nicht der Vorstand des Vereins ist der Chef, sondern die Gruppe der Straßenverkäufer.“ Für ihn ist ganz klar, dass es bei dem Projekt in erster Linie um die Verkäufer geht. In der Geschichte der Obdachlosenzeitungen in Berlin sorgte diese Frage immer wieder für Streit. 1994 gründen sich fast gleichzeitig die Zeitung MOB (Magazin obdachloser Bürger) und die HAZ (Hunnis Allgemeine Zeitung) – „einer Gruppe Punks von Rosa-Luxemburg-Platz, die sich um Uwe Hundertmark, Hunni, scharten“, so Schneider. Nach einem Jahr wurden beide Blätter von internen Auseinandersetzungen erschüttert. Zudem sollen bei der Mob unhaltbare Zustände geherrscht haben: „Leute bedienten sich aus der Kasse; ganze Zeitungspakete wurden mit einem Joint bezahlt, Verkäufer junkten, stinkende Socken lagen auf dem Computerkeyboard und Erbrochenes neben dem Tisch“, fasst Schneider einige unschöne Details zusammen. Dies und die Richtungsstreits bei beiden Zeitungen gipfelten im Zusammenschluss zur motz: Eine sprachliche Hybridbildung aus beiden Titeln.
„Variationen des gleichen Themas“
Die folgenden Überwerfungen und Neugründungen verschiedener neuer Straßenzeitungsprojekte (Platte, aufgelöst, weil der Vorstand mit der Kasse durchbrannte, ein Blatt, aus der der Straßenfeger hervorging, und Stütze, eine Koalition aus Abspaltungen von motz und Straßenfeger, seit Mai 2008 eingestellt) sind nach Auffassung von Schneider „Variationen des gleichen Themas“. Er macht auf den Grundsatz aufmerksam, nach dem beispielsweise der Straßenfeger arbeitet: Straßenverkäufer-Artikel haben Vorrang, weil sie die authentische Sicht von der Straße zeigen“. Außerdem sei der innere Redaktionskreis ganz bewusst von Straßenverkäufern besetzt worden, damit kein Entfremdungsprozess stattfinde. Eben nicht so wie bei Linde, dem Chefredakteur der motz, der immerhin auch Gründungsmitglied sei: „Der hat so wenig mit wohnungslosen Leuten zu tun, weil er sich von dieser Realität entfernt hat, beziehungsweise noch nie ein Teil davon war.“ Funkstille scheint auch gegenüber der anderen Berliner Obdachlosenzeitung zu herrschen: Während die motz (vierzehntägige Auflage: 12 000) auf ihrer Homepage ihre größere Schwester Straßenfeger (vierzehntägige Auflage: 21 000) mit keinem Wort erwähnt, ist man dort entspannter: Dort wird zu dem Konkurrenten verlinkt.
Quelle: www.berliner-journalisten.com/heft15_artikel7.php
In Berlin bieten Nichtseßhafte Politikern Schnupperkurse fürs Leben auf der Straße an - mit begrenztem Erfolg.
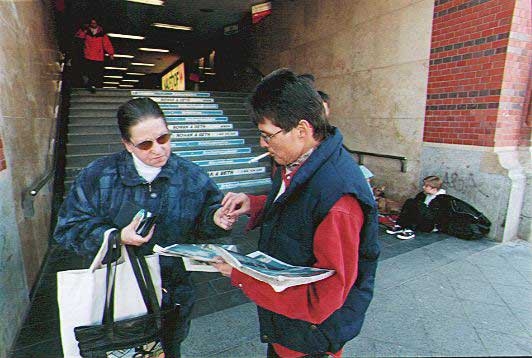 Die Matratze hatte gelbe Flecken, ein Dunst aus Fußschweiß und Alkohol hing in der Luft. In der zwölf Quadratmeter großen Notunterkunft in Berlin-Friedrichshain schnarchten sieben Obdachlose auf ihren Nachtlagern. Doch Karin Hiller-Ewers, 45, war "heilfroh", in der feuchtkalten Aprilnacht wenigstens einen überdachten Schlafplatz gefunden zu haben.
Die Matratze hatte gelbe Flecken, ein Dunst aus Fußschweiß und Alkohol hing in der Luft. In der zwölf Quadratmeter großen Notunterkunft in Berlin-Friedrichshain schnarchten sieben Obdachlose auf ihren Nachtlagern. Doch Karin Hiller-Ewers, 45, war "heilfroh", in der feuchtkalten Aprilnacht wenigstens einen überdachten Schlafplatz gefunden zu haben.
Für einen Tag probte die SPD-Abgeordnete, zu Hause im bürgerlichen Reinickendorf, das Leben auf der Straße. Im "Crashkurs Obdachlosigkeit", den der Berliner Verein "mob - Obdachlose machen mobil e. V." anbietet, gab sie frühmorgens Ausweis, Uhr, Schmuck und Geld ab - "nur die Zigaretten durfte ich behalten".
Essen und Getränke mußte die Kurzzeit-Vagabundin sich selbst verdienen. Wie, das zeigte ihr ein Obdachloser, der die Abgeordnete rund um die Uhr begleitete.
Ihr Tagwerk begann in der mobilen Vertriebsstation der vereinseigenen Zeitung strassenfeger (Auflage: 23 000), die zweiwöchentlich erscheint. Fünf Exemplare bekam Hiller-Ewers auf Kommission, jedes weitere mußte sie für eine Mark kaufen.
Jede verkaufte Zeitschrift bringt einen Verdienst von einer Mark.
Für die bis zu 100 Obdachlosen, welche die Zwei-Mark-Postille meist in Straßen und U-Bahnen vertreiben, ist das Alltag. "Zwischen 50 und 80 Mark sind drin, wenn man die guten Stellen in der Stadt kennt und keine Skrupel hat, die Leute anzuquatschen", sagt Wolfgang Hoppe, 36, seit acht Jahren auf Platte. Anfängerin Hiller-Ewers verdiente gerade mal neun Mark: "Ich war schüchtern und fühlte mich einfach nicht wohl in meiner Haut."
Das passende Outfit der Berber auf Probe wird aus Kleiderspenden zusammengestellt. "Das ist wirklich eklig", fand die SPD-Sozialexpertin Hiller-Ewers. "Die fremden Klamotten, von denen keine richtig paßt, entwurzeln einen noch mehr."
Solche Erkenntnisse sind genau das Ziel des Crashkurses, der nicht zufällig in Berlin angeboten wird. Bis zu 15 000 Menschen, schätzt der Senat, müssen sich in der Hauptstadt der Obdachlosigkeit ohne feste Bleibe durchschlagen, mit 40000 rechnen Caritas und Diakonie.
"Sie wollen mitreden?" fragte der Verein "mob" Anfang des Monats in einer doppelseitigen Anzeige im strassenfeger, einer von drei Berliner Obdachlosenzeitungen. Wer erfahren wolle, "wie es ist, auf der Straße zu leben, ohne einen Pfennig Geld, Dach überm Kopf und Privatsphäre", der könne dies unter "realistischen Bedingungen" tun.
Das Bedürfnis der Politiker, das Experiment mitzumachen, ist unterschiedlich groß. Hiller-Ewers hält es als Mitglied des Sozialausschusses in der SPD-Fraktion für ihre Aufgabe, "die Lebensbedingungen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen kennenzulernen". Es sei einfacher, in Kohlegruben zu fahren, Bierfässer anzuzapfen oder Nachtwache in Pflegeheimen zu halten, als das städtische Berberleben mitzubekommen.
Auch der sozialpolitische Sprecher der Berliner Bündnis-Grünen, Michael Haberkorn, empfiehlt den Kurs "manch einem, der im Sozialausschuß sitzt". Mit der Begründung, er habe 15 Jahre als Sozialarbeiter die Szene studiert, beschränkte Haberkorn seinen Einsatz auf zwei Stunden als strassenfeger-Vertriebschef - er mußte den recht kommoden VW-Bus am Bahnhof Zoo gar nicht verlassen.
Elegant versucht sich auch der PDS-Abgeordnete Benjamin Hoff die Erfahrungen zu ersparen. Trotz des Gefühls "tiefer Scham über den Wohlstand in der reichen BRD" und seiner "tief verwurzelten karitativen Lebenseinstellung" will der Nachwuchspolitiker nicht mitmachen. Die Aktion berge die Gefahr, "die Betroffenen zu verhöhnen". Dialektiker Hoff, 21, möchte zudem den Obdachlosen nicht "ihren Kaffee wegtrinken und ihre Stullen wegessen".
Die CDU hält das "mob"-Angebot grundsätzlich für "hochinteressant und zu begrüßen", sagt Fraktionschef Klaus-Rüdiger Landowsky. Angenommen hat es allerdings noch kein Christdemokrat - "aus Zeitgründen", wie Pressesprecher Markus Kauffmann rechtfertigt. Zudem glaubt Kauffmann, daß "niemand obdachlos sein muß, wenn er es nicht wirklich will".
"Das fehlende Wissen um den Umfang der Wohnungslosigkeit", sagt Verena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG), könne der Schnupperkurs sicher besser wettmachen als jede Statistik. Die in Bielefeld ansässige BAG schätzt, daß in ganz Deutschland knapp eine Million Menschen wohnungslos sind, sie zählt dazu allerdings alle Menschen ohne Mietvertrag.
"mob"-Vereinsvorsitzender Stefan Schneider ist durchaus zufrieden mit der Resonanz auf seine Initiative. Der Vorwurf vieler Interessenten, die Kursgebühr von 180 Mark für einen Tag als Berber sei ziemlich happig, prallt an ihm ab. Schließlich gehe davon die Hälfte an den Begleiter - "der verdient ja sonst nichts an dem Tag".
Der Rest komme der Vereinsarbeit zugute, sagt Schneider. Und: "Geld ist nun mal das wirksamste Mittel gegen Armut."
Quelle: Der SPIEGEL 1997, Nummer 18, Seite 78 sowie in SPIEGEL-Online ![]() Berber auf Probe _ Spiegel_1997_18_78.pdf
Berber auf Probe _ Spiegel_1997_18_78.pdf
Ansehen verleihen
Wenn Jürgen durch die Straßen geht, gucken die meisten Leute lieber weg. Wer will schon zusehen, wie jemand Flaschen aus Mülleimern fischt. Wer schaut in der S-Bahn schon hin, wenn einer durch die Waggons läuft und den „Straßenfeger“ anbietet.
Seit gestern ist das anders. Seit gestern steht Jürgen im Rampenlicht. Sein Kopf, überlebensgroß in Terrakotta gebrannt, ist Teil einer Ausstellung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die gestern eröffnet wurde. Der Künstler Harald Birck hat Jürgen und rund 30 weitere Obdachlose in der City-Station der Berliner Stadtmission besucht und porträtiert. Das Tagescafé für wohnungslose Menschen in Charlottenburg-Wilmersdorf wurde zu seinem Atelier. „Am Anfang mussten wir schon Überzeugungsarbeit leisten, die Leute waren erst mal sehr skeptisch, was ich da von ihnen will,“ sagt der in Berlin und Paris lebende Künstler.
„Auf Augenhöhe. Berliner Obdachlose im Porträt“ heißt sein Projekt. Die Idee dazu kam ihm zusammen mit Ralf Döbbeling, dem Leiter der City-Sation: „Wir wollten den Leuten eine Erfahrung gönnen, die sie sonst nie gehabt hätten: Einmal drei Stunden im Blickpunkt eines Künstlers zu stehen, ihnen damit buchstäblich Ansehen verleihen“, sagt der evangelische Pfarrer Döbbeling. Seitdem ist Harald Birck ständiger Gast in der City-Station. Er sucht das Gespräch mit seinen Modellen, sitzt mit ihnen zusammen bei Kaffee und Zigarette. „Mir ist wichtig, etwas über die Menschen zu erfahren, die ich porträtiere, denn deren Persönlichkeit soll sich ja in der Skulptur widerspiegeln.“
Auch Jürgen war neugierig, als er den Künstler am Porträtkopf eines Bekannten modellieren sah. „Ich fand das interessant, die Köpfe waren nicht so glatt geleckt oder aus Marmor, sondern mit Ecken und Kanten,“ sagt der schmächtige Mann mit Wollpulli und grünschwarz karierten Hosen. Er ist einer von rund zehntausend Obdachlosen in Berlin. Zwar ist er erst Mitte Vierzig, doch sein leicht nach vorne gebeugter Gang und die Furchen in seinem Gesicht lassen ihn beinahe zehn Jahre älter wirken. Das Leben auf der Straße hat Spuren hinterlassen. Wie lange er schon ohne festen Wohnsitz ist, weiß er selbst nicht mehr genau: „Das war irgendwann zu DDR-Zeiten, nach meiner Scheidung, das war wohl der Auslöser.“ Er spricht nicht gern über sich und seine Situation. Beiläufig nuschelt er etwas in seinen grauen Rauschebart, von Arbeitslosigkeit, Alkohol und schlechtem Umgang. Das „Reisefieber“ habe ihn eben immer wieder gepackt. Meistens genau dann, wenn sein Leben gerade in geregelte Bahnen kam, wenn ihm die eigene Wohnung schon sicher war. „Ich will eigentlich nicht so leben. Aber da ist so ein innerer Drang, den ich selbst nicht ganz verstehe“, sagt er.
Inzwischen gibt es Jürgens Kopf schon zweimal in Harald Bircks Terrakotta-Sammlung. „Jürgen hat ein tolles Gesicht, das hat so etwas von einem Seebären oder einem Abenteurer“, findet der Künstler, der sich durch die Zusammenarbeit sogar mit seinem Modell angefreundet hat. „Harald Birck hat es mit seiner Kunst geschafft, die Leute zu öffnen. Sie haben ihm Dinge erzählt, die sie mir oder einem Sozialpädagogen nie anvertraut haben“, sagt Pfarrer Döbbeling, der viele der Porträtierten schon seit Jahren kennt.
Dass sein Kopf jetzt im Bundesministerium zu besichtigen ist, macht Jürgen stolz. „Das ist schön zu sehen, dass es da jemand fertig gebracht hat, Kunst aus mir zu machen“, sagt er. „Und außerdem ist das etwas, was fortbesteht, wenn man selbst sich mal in die Kiste gelegt hat.“
Sandra Stalinski
Auf Augenhöhe – Berliner Obdachlose im Porträt. Ausstellung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Kleisthaus, Mauerstraße 53, 10117 Berlin (Mitte), bis 17. April. Montags bis freitags 8 bis 17 Uhr, Eintritt frei.
(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 08.03.2008)
Vorbemerkung: Obgleich im Text nicht ausdrücklich erwähnt, ist Jan Markowski seit vielen Jahren regelmässiger Autor beim strassenfeger, seit dem Jahr 2007 auch Mitglied des Vereins mob - obdachlose machen mobil e.V. und vor allem Macher der 14tägigen okb-Sendung strassenfeger - die Sendung mit dem Aufzug. Aus diesen Gründen gehört ein Portrait von Jan Markowski unbedingt in diese Rubrik.
Berlin, 10.03.2008, Stefan Schneider
Frei von Zwängen
Von der DDR-Opposition in die deutsche Armut: das bewegte Leben des Berliner Obdachlosen Jan Markowsky
BERLIN. Es ist Freitagabend, als Jan Markowsky in einem Laden im Wedding Stühle und Tische beiseite schiebt. "Unter Druck. Kultur von der Straße e.V." steht auf einem Holzschild über der Tür. Martina, Ulla, Horst und Thommy schauen Markowsky zu. Der Jüngste von ihnen ist fünfundvierzig Jahre alt, die Älteste achtundsechzig. Die Theatergruppe des Vereins probt ihr neues Stück, eine zeitgenössische Version von "Hänsel und Gretel". Ein landloser Bauer aus Mecklenburg und eine entlassene Kantinenwirtin aus Helmstedt suchen ihr Glück, das heißt einen neuen Job. Grimms Märchen im Hartz-IV-Deutschland.
Den Investor, auf den sich die Hoffnungen richten, spielt Horst. Er setzt eine Krone auf, posiert damit vor Ulla, die beiden glucksen wie zwei alt gewordene Kinder. Horsts Sporthose und das alte T-Shirt sind noch nicht bühnenreif. Seine dürftige Mimik ebenso wenig.
Markowsky schüttelt den Kopf, schickt ihn auf das Sofa, spielt die Szene vor. Wie er sie sich vorstellt. Er prüft die Finger von Hänsel und Gretel. "Immer noch zu fett!" Dann rümpft er die Nase, furcht die Augenbrauen. Horst kratzt sich am Kopf, auf dem immer noch die Krone sitzt. "Nicht schlecht, Jan. Gefällt mir. Dafür üben wa ja."
Zum Obdachlosentheater ist Jan Markowsky gekommen, als er selbst erst wenige Monate auf der Straße lebte. Anfangs wollte er lediglich zuschauen. Dann machte er mit.
Mittlerweile sitzt er im Vereinsvorstand, ehrenamtlich. Er sammelt Lebensmittelspenden, arbeitet in Zirkeln über Wohnungsnot, geht zu Sozialausschüssen.
Manchmal trifft man ihn bei Veranstaltungen über Obdachlosigkeit. Dort sucht er sich einen Platz ganz hinten. Dann sitzt er still auf dem Stuhl, konzentriert, stets sauber gekleidet, einen kleinen Rucksack an sich gepresst. Eine Randgestalt.
Es ist nicht anders als damals in der DDR. Jan Markowsky mischt sich ein für etwas, das ihm wichtig erscheint. Heute sind es Menschen, die keine Wohnung haben und kein Bankkonto, die nicht krankenversichert sind und von Armenspeisungen leben - wie er. Damals waren es Menschen, die sich in der Bürgerrechtsbewegung der DDR für ein besseres Land einsetzten, Dissidenten, Intellektuelle, Künstler
Das klingt nach einem sozialen Absturz. Wie eine traurige Pointe im Leben des Jan Markowsky, geboren 1949 in Greifswald, die Eltern Mediziner, drei Brüder. Es klingt nach einem Leben, dem immer mehr die Bedeutung abhanden kommt.
An einem Januartag vor acht Jahren, von dem an Jan Markowsky obdachlos sein wird, kann er seine Toilette nicht benutzen. Sie ist defekt. Er geht vor die Tür, seine Wohnung liegt parterre. Plötzlich fällt es ihm ein. Der Schlüssel. Der steckt in der anderen Hose. Markowsky starrt auf die Tür. Gerade erst hat er seinen Job geschmissen. Die Miete. Wie soll er die zahlen? Er dreht sich um, geht weg, einfach so, lässt alles zurück. Möbel, Kleidung, Geburtsurkunde, sein bisheriges Leben. Es kommt ihm nicht seltsam vor, nur logisch. "Wie eine Befreiung", behauptet er. Seine Finger gleiten dabei durch seinen Schnauzbart. Der zieht sich bis über die Mundwinkel. Wie bei Wolf Biermann. Zufall, sagt er.
Mit der Ausbürgerung des Liedermachers am 16. November 1976 verschlägt es Jan Markowsky zu den Bürgerrechtlern. Wegen seines Bruders Bernd, zwei Jahre jünger als er und ein Freund Wolf Biermanns.
Bernd wird in Jena verhaftet. Gerade war er aus Berlin zurückgekehrt, von Robert Havemann, dem prominentesten DDR-Dissidenten. Dort hatte Bernd Markowsky eine Protestresolution einiger Autoren um Stephan Hermlin abgeholt.
"Bernd war der Mutigere von uns beiden, der eher einen eigenen Weg suchte als ich", sagt Jan Markowsky. "Das Politische ergab sich in einer Diktatur zwangsläufig."
Er selbst wohnt damals erst seit kurzem in Berlin, als Diplomingenieur arbeitet er beim VEB Gasversorgung. Als der Bruder festgenommen wird, fährt er nach Jena. Dort lernt er dessen Freunde kennen, dann auch Oppositionelle in Berlin. Darunter den Schriftsteller Lutz Rathenow, mit dem Bernd Markowsky in Jena den staatskritischen Arbeitskreis Literatur gegründet hat.
Nach Monaten in Haft wird sein Bruder 1977 nach Westberlin abgeschoben. Der Vater folgt. Im Osten bleiben Jan, seine beiden anderen Brüder und die Mutter. Nun sind die Markowskys geteilt wie das Land.
"Eine rebellische Familie", sagt Lutz Rathenow. "Politisch eigenwillig, Unruhestifter im Guten."
Wie ein Unruhestifter sieht Jan Markowsky nicht aus, nicht auf den ersten Blick. Wie er zum Beispiel dieser Tage an einem Tisch kauert. Regungslos, still, in sich gekehrt. Es ist das Kaffee Bankrott in der Prenzlauer Allee, wo sich Menschen ohne festen Wohnsitz treffen. Im fahlen Licht der Neonröhren tagt die Redaktionskonferenz des Obdachlosenmagazins "Straßenfeger". Ein Dutzend Leute redet über Jugendgewalt, Elternverantwortung, Kapitalismus und Kriminalität. All so was. Einer grummelt dazwischen: "Das ist zu oberflächlich." Plötzlich donnert Markowsky los: "Dann hör' genau zu!" Ein Ausbruch wie ein Faustschlag. Ansatzlos, selbstgewiss. Eigentlich eine Spur zu heftig.
Jan Markowsky ist niemand, der stillhält, wenn ihm etwas nicht passt. Das war er nie. Selten ist er ganz vorn in der DDR-Opposition dabei, aber oft mittendrin. Wie im September 1981. Da fährt er nach Woltersdorf östlich von Berlin. Im Garten des Physikers Gerd Poppe, dem späteren Bundestagsabgeordneten für Bündnis 90/Die Grünen, treffen sich einige Bürgerrechtler. Es ist ein sonniger Tag, Wochenende. In der Runde sitzt Robert Havemann. Er liest einen offenen Brief vor, an den sowjetischen Staatschef. Breschnew solle die Stationierung der atomaren SS-20-Mittelstreckenraketen in der DDR zurückziehen.
Aber Havemann geht noch weiter: "Wie wir Deutsche unsere nationale Frage dann lösen werden, muss man uns schon selbst überlassen, und niemand soll sich davor mehr fürchten als vor dem Atomkrieg." Gleich dort im Garten unterzeichnen einige den Brief. Unter ihnen der Pfarrer Rainer Eppelmann und der Lyriker Sascha Anderson, der als IM der Stasi von dem Tag berichtet. Und Jan Markowsky. Kurz darauf schreiben sich im Westen einige Friedensaktivisten hinzu.
Zwei Wochen später ruft Bruder Bernd an. Er will Markowsky warnen. Der Brief werde in einigen Westzeitungen veröffentlicht, mit den Erstunterzeichnern. Jan Markowsky sagt nur: "Ist doch in Ordnung."
So erzählt er es. Er will verstanden werden. Denn es geht ihm ums Prinzip. Sein Prinzip. Alles mit vollem Namen.
Als von ihm ein Text über die Friedensbewegung der evangelischen Kirche der DDR in der Westberliner taz abgedruckt wird, steht darunter "Jan Markowsky, Ost-Berlin". Auch wenn es ihm ein Verhör bei der Stasi einbringt. Dem Amtsleiter der Abteilung Inneres von Berlin-Weißensee, der Freunde von ihm wegen vermeintlich staatsfeindlicher Aktivitäten vorführen ließ, schickt er eine Postkarte mit Auszügen aus der DDR-Strafprozessordnung. Der Leiter möge sie unterschreiben und an ihn zurücksenden. Seine Adresse steht dabei.
Nicht verstecken, das bleibt sein Credo. Auch jetzt, ohne Wohnung. Vielleicht ist er das seinem Stolz schuldig. Markowsky steht zu seinem Leben. Zu seiner Armut.
Wenn Jan Markowsky ins Erzählen kommt, schichtet er akribisch Detail auf Detail. Man kann ihn dabei schlecht zur Kürze anhalten. "Moment!" wehrt er dann ab: "Ich erzähle Ihnen die ganze Geschichte, die ganze Geschichte, ich erzähle Ihnen die ganze Geschichte."
Manchmal kommt er von den Sätzen nicht mehr los. Als würden seine Gedanken stranden, irgendwo in seinem Kopf. Weil alles zusammenhängt. So viele Dinge.
Als 1984 sein Ausreiseantrag genehmigt wird, packt er nur etwas Wäsche in eine Reisetasche. Am anderen Ende des Tränenpalastes beginnt sein neues Leben. Nichts wird damit leichter.
Ein erster Job als Energieberater ist nur befristet, seine Versuche als Freiberufler scheitern. Das Gefühl, dass auch in Westberlin nichts vorwärts geht, wird immer bohrender. Hinzu kommen Mietschulden, Beziehungsprobleme, Depressionen.
Als die Mauer fällt, sind die Kontakte in den Osten längst gekappt.
Ein Architekt, bei dem er zeitweise doch angestellt wird, hilft ihm beim Entschulden, bringt ihn in einem Haus in Prenzlauer Berg unter. Es wird seine letzte Wohnung sein.
"Jan Markowsky war hoch intelligent und sehr individuell", sagt der Architekt. "Aber als Ingenieur fehlte ihm der Sinn dafür, was praktisch durchführbar ist." Er spricht von ihm in der Vergangenheit.
Womöglich ist es so, dass sich Menschen wie Markowsky in kein System einpassen können. Weil sie sich mit Autoritäten schlecht arrangieren. Weil sie zu eigensinnig sind. Zu eigenbrötlerisch wohl auch.
Im Januar 2000 zerstreitet er sich mit seinem Chef. Dann passiert die Sache mit der Wohnungstür, mitten in einer schlechten Phase.
Das Ende? Der Neuanfang.
"Frei von allen Zwängen zu sein", sagt Jan Markowsky, "das ist das Wichtigste."
Sein jüngerer Bruder Helmut, Pfarrer in Thüringen, sagt: "Ich sehe seine Obdachlosigkeit nicht als absteigenden Ast, sondern einfach als seinen Lebensweg. Er scheut sich nicht, soziale Grenzen zu durchbrechen."
Eine Geschichte erzählt Jan Markowsky gern. Einmal schläft er in einem Park. Im Morgengrauen läuft ein Jogger vorbei. Er sieht wie ein Büromensch aus, einer, der sich quält, um fit zu wirken, belastbar. "Der hat bestimmt gedacht: Der arme Penner. Ich habe gedacht: Der arme Jogger."
Das ist seine Sicht auf die Welt. Markowsky besitzt kaum etwas. Es fehlt ihm an nichts.
Der kleine Mann hat es eilig. Er rennt durch die Schlesische Straße, seine offene Regenjacke flattert, der Schal hängt lose am Hals. Die schnellen Schritte wollen kaum passen zu dem massiven Körper. An diesem Abend nimmt die Kreuzberger Taborkirche Obdachlose auf. Menschen wie ihn. Es wird voll sein. Er ist spät dran. Jan Markowsky läuft um seinen Schlafplatz.
Als er den Vorraum betritt, sind die meisten Isomatten schon belegt. Unter seinem Arm klemmt eine blaue Ikea-Einkaufstasche. Am nächsten Morgen will er von einer Bäckerei Essenspenden für andere Obdachlose abholen.
Er setzt sich, sieht sich um, ausdruckslos. Am Tisch starrt ein bärtiger Mann verschlossen in seine Tasse. Auf dem Boden krümmt sich ein schwer zugedröhnter junger Kerl. Daneben ist noch eine Matte frei. Die letzte. Direkt an der Tür. "Ist in Ordnung", brummt Jan Markowsky. "Reicht mir doch."
Es muss reichen.