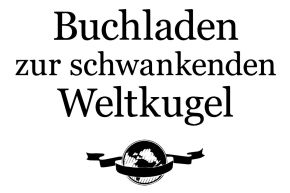Der 1. Mai hat in Berlin viele Gesichter
Der 1. Mai wurde nicht nur vom DGB oder den Autonomen begangen. Unter dem Motto "Stoppt den Krieg" fanden sich etwa 20.000 BesucherInnen auf dem Mariannenplatz im Kreuzberger Kiez ein. Diesmal wurde das traditionelle 1.-Mai-Fest mit politischen Reden bereichert. So stiegen unter anderem der bündnisgrüne Bezirksbürgermeister Franz Schulz sowie die PDS-Landesvorsitzende Petra Pau auf eine der beiden Bühnen. Allerdings begeisterten sich die meisten BesucherInnen weit mehr für die verführerischen Düfte kulinarischer Köstlichkeiten sowie die herrlichen Sonnenstrahlen.
Selbige genossen bereits gegen Mittag einige hundert Obdachlose auf ihrem Straßenfest vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte. Organisiert vom Verein "Obdachlose machen mobil" (mob), bewegte man sich zu Live-Musik und füllte sich die Mägen mit Erbsensuppe und Bier. Zahlreiche soziale Projekte stellten sich au§erdem vor.
Mit Mehl bewaffnet und teilweise in Hexenkleidung, demonstrierten bereits am Vorabend rund 200 Frauen, Lesben und Mädchen gegen patriarchiale Gewalt: "Jede Frau, die Gewalt erfährt, ist eine Frau zuviel." So bewegte sich die traditionelle Walpurgisdemo unter dem Schutz der riesigen Stoffdrachin "Futura" und ummantelt von reichlich Polizei von Neukölln zum Heinrichplatz. Der weibliche Frust fokussierte sich auch besonders auf das Kriegsgeschehen: "Kampf den Profiteuren des Krieges". Hin und wieder ließen es sich einige "böse Prinzessinen" nicht nehmen, randständig-pöbelnde männliche Gestalten mit Mehl zu bewerfen.
Katrin Cholotta taz Berlin lokal Nr. 5825 vom 3.5.1999 Seite 20 50 Zeilen
TAZ-Bericht Katrin Cholotta
© Contrapress media GmbH VervielfŠltigung nur mit Genehmigung des taz-Verlags
Beim 93. Deutschen Katholikentag wollen die Gläubigen über den Weg ins dritte Jahrtausend diskutieren. Gegenüber den Kirchenreformern wird dabei Toleranz geübt - doch die Basischristen bleiben wieder außen vor
Aus Mainz Bernhard Pötter
Jürgen Schupp ist voller Hoffnung. Mit einem Packen der Obdachlosenzeitung Straßenfeger im Arm schlendert er durch die Mainzer Fußgängerzone. Rechtzeitig zum großen Kirchentreffen versucht das Straßenblatt aus Berlin, mit einer Sonderauflage von 20.000 Exemplaren im Rhein- Main-Gebiet Fu§ zu fassen. Mit Berichten über kirchliche Obdachlosenarbeit oder seelsorgerische Hilfe für Gefangene will der Straßenfeger auch das pfälzische Herz erweichen. Für Schupp ist klar: "Nach dem Kirchgang sind Katholiken besonders barmherzig."
Der publizistische Expansionsplan könnte aufgehen. Denn noch bis zum Wochenende versammeln sich in Mainz Zehntausende von Gläubigen zum 93. Deutschen Katholikentag. Unter dem Motto "Gebt Zeugnis von Eurer Hoffnung" wollen sie über den Weg der Kirche ins dritte Jahrtausend diskutieren. Der im Vergleich zu anderen Katholikentagen erstaunlich geringen Beteiligung von 25.000 Dauergästen steht ein kaum überschaubares Mammutprogramm mit über 1.000 Veranstaltungen gegenüber. Das offizielle Programm nennt mit den Themengruppen "Bewahrung der Schöpfung", "Völkergemeinschaft, Europa, Eine Welt", "Politik, Staat, Demokratie", "Dialogfähige Kirche", "Kultur", "Wirtschaft" und "Bildung" so ziemlich alles, worüber sich zu reden lohnt. Das Angebot unfa§t den klassischen Bauchladen kirchlicher Großveranstaltungen: Gottesdienste ebenso wie politische Diskussionen, den Soldatengottesdienst und den Workshop mit Greenpeace-Aktivisten, das Männerzentrum neben dem Kreativworkshop "Sakraler Tanz".
Der deutsche Katholizismus will klären, wie es weitergehen soll. Diesen Anspruch formuliert niemand so laut wie der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), der sächsische Bildungsminister Hans-Joachim Meyer. Gerade das vergangene Jahr hat die katholische Kirche in Deutschland arg gebeutelt. Zu der ohnehin angespannten Finanzlage durch Austritte und hohe Arbeitslosigkeit trat die vatikanische "Laieninstruktion", die den Nichtpriestern, den Laien, den Platz in den Gemeinden streitig machte. Schließlich kam auch noch die Anweisung aus Rom an die Bischöfe, aus der Schwangerschaftsberatung auszusteigen. Beim Katholikentag, der vor allem ein Treffen der Laien ist, gibt es deshalb demonstrativ viel Lob für die so aus Rom gescholtenen Laien. Dazu gehört auch der Rückblick auf die 150jährige Geschichte der Katholikentreffen, die 1848 in Mainz begannen und 1948 nach dem traumatischen Erlebnis von Krieg und Naziterror ebenfalls in Mainz erstmals wieder aufgenommen wurden.
Die Amtskirche zeigt sich in Mainz konziliant. Bei der Eröffnungsveranstaltung dürfen die innerkirchlichen Reformer vom "Kirchenvolksbegehren" von der offiziellen Bühne herab fordern: "Die alten Zöpfe müssen ab." Der ob seines sozialen Engagements von Rom geschaßte französische Bischof Jaques Gaillot ist eingeladen. In der Fußgängerzone präsentieren sich neben den wenigen Papsttreuen und fundamentalistischen Lebensschützern die Mehrheit der reformerischen Kirchenverbände ebenso wie die Linksabweichler, die einen offenen Umgang der Kirche mit Homosexuellen und den Rechten der Frauen fordern.
Doch die Einheit hat ihre Grenzen. Auch die "Initiative Kirche von unten" präsentiert sich in Mainz - allerdings wie in den Vorjahren nicht im offiziellen Programm. "Das Verhältnis ist trotz der verbalen Entspannung schlechter als früher", meint ihr Sprecher Tom Schmidt. Gegen den 13-Millionen-Etat des Katholikentages nehmen sich die 100.000 Mark für die Gegenveranstaltung mit dem Motto "Unsere Hoffnung heißt Gerechtigkeit" klein aus. "Aber wir bekommen keine Unterstützung und müssen etwa jeden Einsatz des Technischen Hilfswerks voll bezahlen", sagt Schmidt.
Für ihn ist der Kirchentag von unten das Salz in der katholischen Suppe: "Das Thema des Tages ist doch zum Beispiel bei der Arbeitslosigkeit oder den Flüchtlingsfragen die Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen", so Schmidt. "Weil der Katholikentag das nicht zum Schwerpunkt macht, tun wir es." Für Schmidt bleibt die Basisveranstaltung notwendig - trotz aller Umarmungsversuche des großen Bruders ZdK: "Ohne die Drohung mit der Alternative 'Kirche von unten' wäre die Kritik im offiziellen Programm nicht möglich."
Viele Besucher suchen allerdings nicht den politischen Streit, sondern die persönliche Gotteserfahrung. "Ich will mit vielen anderen Menschen meinen Glauben erleben", sagt die Religionslehrerein aus Bad Kreuznach, die ihren Namen lieber nicht sagen will. "Im Unterricht erlebe ich, wie die Schüler mit einem Glauben etwas haben, woran sie ihre Hoffnung knüpfen können. Die anderen sind viel passiver." Gudrun Nitsche aus Offenbach dagegen hat überhaupt keine Zeit gefunden, "mir das 570 Seiten dicke Programm anzusehen". Auf ihrer Schürze prangt das Katholikentag-Logo: der springende Delphin, den die Organisatoren gewählt haben, um Zuversicht und Hoffnung auszudrücken. Und wegen des Delphins gibt es für die Speisung der Tausende aus ökologischen Gründen keinen Thunfisch. Gudrun Nitsche kümmert das an ihrem Stand wenig: Sie verkauft schließlich beim Abend der Begegnung das Traditionsrezept der Heimat: Pfälzer Saumagen.
TAZ Nr. 5554 vom 12.06.1998 Seite 7 Inland 168 Zeilen, TAZ-Bericht Bernhard Pötter
Warum Privatpersonen keine Lebensmittelspenden für Bedürftige loswerden dürfen / "Bremer Tafel" und Bahnhofsmission sind darum stark auf Spenden angewiesen
50 Lunchpakete hatte Stephanie Hoberg nach einer großen Firmenpräsentation übrig. 50 Lunchpakete, morgens frisch verpackt, beladen mit "Sandwiches, Obst und diversen anderen Sachen". Abends um 22 Uhr, so schreibt sie in einem Leserbrief an die Obdachlosenzeitung "Straßenfeger", hätten sich Kollegen aufgemacht, um der Bremer Bahnhofsmission das übriggebliebene Essen anzubieten. Doch die Essensüberbringer blitzten an dem kleinen Häuschen auf Gleis 1 ab. Ohne das Essen zu begutachten, so Hoberg, sei man weggeschickt worden. "Wie lästige Staubsaugervertreter mußten meine Kollegen wieder abziehen."
Bei der Konkurrenz versteht man die Ablehnung nicht ganz. Die "Bremer Tafel" wurde vor drei Jahren gegründet, um Obdachlose mit gespendeten Lebensmitteln zu versorgen. Damit ist sie der größte Abnehmer von gespendeten Lebensmitteln in Bremen. Zwischen 80 und 200 Menschen kann der hauptsächlich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeitende Verein so Tag für Tag versorgen. Ohne die Spenden hätte die Tafel nichts, was an die Obdachlosen ausgegeben werden kann. "Wenn uns das angeboten worden wäre und das Essen frisch war, hätten wir die Lebensmittel sicherlich abgeholt", sagt Mitarbeiter Dirk Riewe. Täglich fahren er und seine Kollegen die großen Supermarktketten in Bremen ab, um nicht mehr verkaufswürdige Lebensmittel für die Tafel zu organisieren.
Eine entscheidende Einschränkung macht Riewe, was die Annahme von Lebensmitteln angeht: "Von Privatpersonen nehmen wir grundsätzlich nichts". Höchstens Dosen und Konserven. Ein Gutmensch, der für Obdachlose kocht und mit dem gespendeten Riesentopf Spaghetti ankäme, müßte abgewiesen werden. "Da bekämen wir Probleme mit dem Gesundheitsamt". Schließlich sei bei Privatpersonen nicht klar, wie hygienisch die kochenden Hände gearbeitet hätten. Bei großen Lebensmittelketten sei das natürlich anders. Firmen, die Lebensmittel abgeben, müssen zu einer strengen Eigenkontrolle und einer Schulung der Mitarbeiter bereit sein. Geregelt wird das Verfahren seit Januar 1997 in einer Bundesverordnung.
Daß es in der "Bremer Tafel" noch nie zu einem "Hygieneunfall" gekommen ist, daß sich also noch nie jemand den Magen verdorben hat, führt man bei der Hilfsorganisation auch auf die restriktive Annahmepolitik zurück. Es käme recht häufig vor, daß Privatmenschen anrufen und Lebensmittel abgeben wollen, berichtet auch der erste Vorsitzende der Bremer Tafel, Oskar Splettstäßer. Aber zusammen mit dem Gesundheitsamt habe man sich darauf geeinigt, solche Menschen abzuweisen.
Die Bahnhofsmission hat mehr Spielraum bei der Annahme von Lebensmitteln, wie die Chefin der Bremer Bahnhofsmission, Hella Wilkening, einräumt. "Es hängt von dem einzelnen Kollegen ab, ob er die Lebensmittel annimmt oder nicht." Da direkte Lebensmittelspenden von Privatpersonen ohnehin eher selten kämen, stelle sich die Frage aber kaum. Auch die Bahnhofsmission bezieht ihre Spenden hauptsächlich von Geschäftsleuten. Ablehnungsgründe sind eher, daß die Tiefkühltruhe und der Kühlschrank bereits voll sind oder das Essen offensichtlich verdorben ist. Was mit den Lunch-Paketen des Catoring-Dienstes geschehen ist, kann sich Wilkening auch nicht so recht erklŠren. "Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist". Spenden sind willkommen, nicht nur zur Weihnachtszeit.
Christoph Dowe
TAZ-BREMEN Nr. 5709 vom 11.12.1998 Seite 24 Schlagseite 108 Zeilen
strassenfeger und mob e.V. in Prenzlauer Berg – ein kleines Portrait
Der strassenfeger und mob – obdachlose machen mobil e.V. sind weitaus mehr als nur eine Straßenzeitung und ein Obdachlosenverein. Unter dem Dach von mob e.V. gibt es zudem eine Notübernachtung für Männer und Frauen, einen offenen Treffpunkt mit Internetnutzung und sozialer Beratung, der für alle offen ist und auch von der Nachbarschaft genutzt wird, sowie ein Projekt Trödelpoint – Gebrauchtwarenkaufhaus und Wohnungseinrichtungen. Und das alles in Prenzlauer Berg. Ein Bericht von Stefan Schneider.
„Guten Tag, ich bin der Alex, bin seit zwei Jahren obdachlos, und verkaufe hier die neueste Ausgabe vom Obdachlosenmagazin strassenfeger ...“ So oder so ähnlich beginnen die Sprüche, mit denen Verkäuferinnen und Verkäufer auch in Prenzlauer Berg durch die Gegend ziehen vorstellen, um ihr Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen. Sie haben für die Zeitung den Anteil des Vereins an der Ausgabestelle bereits im voraus bezahlt, und versuchen nun, durch den Verkauf der Zeitung den anderen Teil für ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Während die Obdachlosenzeitungen wie Stütze, motz oder eben der strassenfeger stadtbekannt sind, wissen nur die wenigsten, dass der Verein mob – obdachlose machen mobil e.V., der den strassenfeger herausgibt, seit 1998 in Prenzlauer Berg ansässig ist. Es war zuerst das Kaffe Bankrott, welches in der Schliemannstraße 18 die ehemaligen Räumlichkeiten der Umweltbibliothek nutzen konnte. Es war der damalige Bürgermeister von Prenzlauer Berg, Reinhard Kraetzer (SPD), der sich gegenüber der WIP dafür stark machte, dass mob e.V. die Räume nachnutzen konnte. Der Kontakt war über den damaligen Redakteur Karsten Krampitz zustande gekommen, der Leute aus dem Umfeld von der Umweltbibiothek dafür begeistern konnnte, für den Strassenfeger gelegentlich Beiträge zu schreiben.
Ein Jahr später bezog mob e.V. weitere Räume in Prenzlauer Berg, die Geschäftsstelle und Redaktion fand 1999 ein neues zu Hause auf dem Pfefferberg. Peter Neumann, der verantwortliche Koordinator der Jugendhilfe bei der Pfefferwerk Stadtkulturgesellschaft sprach die Einladung aus. Da die Pfefferwerk Stadtkulturgesellschaft sich stark für die Anliegen von Trebe- und Straßenkinder einsetzte, erhoffte sich Peter Neumann davon eine produktive Zusammenarbeit in einem sehr schwierigen Arbeitsfeld. Auch sein erstes Trödelprojekt konnte mob e.V. in den Garagen im Nordhof der Pfefferberges eröffnen. Inzwischen mit mob e.V. fester Partner im Pfefferwerk Verbund.
Lange währte die Freude allerdings nicht, wegen dem Beginn der Sanierungsarbeiten musste und wollte mob e.V. den Pfefferberg verlassen. Eine weitere Zwischenstation war das Selbsthilfebauhaus in der Oderberger Str. 12. Die Geschäftsstelle und die Redaktion zogen dort vorübergehend ein, um das Bauvorhaben in Schwung zu bringen. Von September 2001 bis September 2002 machte der Verein hier Station.
Im Sommer 2002 fand der Verein dann in der Prenzlauer Allee 87, direkt gegenüber vom S-Bahnhof Prenzlauer Allee Räumlichkeiten, in denen er auch heute noch anzutreffen ist. In den Räumen der ehemaligen Tischlerei wurden zuerst Büroräume fertig gestellt und genutzt, dann zog die Redaktion hier ein, während eine Baugruppe kontinuierlich daran arbeitete, die Fabrikräume weiter auszubauen. Im Dezember 2003 wurde der Treffpunkt Kaffee Bankrott (vorher in der Schliemannstraße) hier neu eröffnet, eine provisorische Notübernachtung fertig gestellt. Auch diese ist inzwischen ausgebaut um beinhaltet eine separate Unterbringung für 8 Männer und 6 Frauen. Sowohl die Notübernachtung als auch der offene Treffpunkt sind ganzjährig geöffnet.
Auch das Selbsthilfehaus in der Oderberger 12 ist fertig geworden, 18 Wohneinheiten wurden komplett saniert und modernisiert und sind inzwischen komplett vermietet, zum überwiegenden Teil an die Selbsthelfer, allesamt Menschen, die aus schwierigen Wohnverhältnissen kommen oder obdachlos waren, und zu einem kleinen Teil an sanierungsbetroffene Umsetzmieter aus dem Sanierungsbezirk Prenzlauer Berg.
Mob e.V. erhält für seine laufende Arbeit keine staatlichen Zuwendungen und muss alle seine Projekte selbst finanzieren. Die Zeitung strassenfeger und der Treffpunkt Kaffe Bankrott tragen sich selbst, für die Notübernachtung wirbt eine Spendenkampagne der Zeitung mit dem Slogan „Ein Dach über dem Kopf!“ Ein wichtiges ökonomisches Standbein ist der Trödelpoint im Keller der Prenzlauer Allee 87. Auf 400 qm werden Haushaltsgegenstände aller Art preisgünstig abgegeben. Zum einen, um obdachlosen Menschen beim Start in eine eigene Wohnung zu erleichtern, zum andere, um armen Bürgern die Möglichkeit zu geben, preisgünstig hochwertige gebrauchte Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände zu erwerben. Die Erlöse dienen dazu, die Kosten zu decken und Arbeitsplätze zu schaffen.
Seit kurzem hat mob e.V. im Souterrain in der Oderberger Str. 12 in 10435 Berlin ein weiteres Standbein eröffnet. Der Laden O12 ist spezialisiert auf retro-style und die 70er Jahre. Damit ist strassenfeger/ mob e.V. weitaus mehr als nur ein Obdachlosenverein, sondern ein soziales Projekt im und für den Stadtteil.
Stefan Schneider