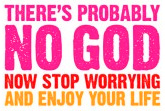31.07.2003 - Junge Welt: Chaotische Professionalität
Berlin: Der Obdachlosenselbsthilfeverein mob e.V. feiert seinen 9. Geburtstag und hat große Pläne
Böse Zungen behaupten, »mob« stehe für Mobbing. Das Gegenteil ist der Fall: »mob« steht für »Obdachlose machen mobil e.V.« und ist das älteste Berliner Selbsthilfeprojekt wohnungsloser Menschen. Am morgigen Freitag feiert der Verein sein neunjähriges Bestehen.
1994 gründeten Obdachlose und Unterstützer einen gemeinnützigen Verein, um aus der Straßenzeitung mob-magazin eine Obdachlosenzeitung zu machen. Die Idee, armen, bedürftigen Menschen ein Sprachrohr und die Möglichkeit eines Zuverdienstes zu bieten, ist heute so aktuell wie damals – und anspruchsvoll. Nach neun Jahren mob-magazin, motz, strassenfeger, straßenzeitung und straz in Berlin ist allen Beteiligten klar, daß der Versuch, Leser über die inhaltliche Qualität des Blattes zu binden, ein sehr beschwerlicher ist. Und jeder weiß, daß das Anliegen, den einzelnen Verkäufer zu unterstützen, nach wie vor im Zentrum der Kaufentscheidung steht.
Zurück zur Geschichte. Als es einige Monate nach Beginn der Redaktionsarbeit winterlich kalt wurde, verwandelten sich die Redaktionsräume schnell in improvisierte Übernachtungsstätten. Das war nur recht und billig: Schließlich waren es die Verkäufer, die das Geld verdienten, das die Redakteure erhielten. Übernachtungsregeln wurden aufgestellt: kein Rauchen im Bett, kein Drogen- oder Alkoholkonsum in den Räumen, Mitwirkung beim Saubermachen und vieles mehr. So entstand neben der Zeitungsarbeit eine an 365 Tagen im Jahr geöffnete selbstverwaltete Notübernachtung. Auch in Sachen »Komfort« tat sich einiges: Doppelstockbetten statt durchgelegener Liegen, Spinde, ein Aufenthaltsraum, Wasch- und Duschmöglichkeiten und schließlich getrennte Räume für Männer und Frauen. Selbstverständlich wurde abends in der Küche gekocht, morgens Kaffee und Frühstück gemacht. Computer, Fax und Telefon konnten für private Zwecke genutzt werden. Mit der Anmietung eigener Räume ging das Projekt in seine nächste Phase. Das Kaffee Bankrott in der Schliemannstraße im Prenzlauer Berg war nicht nur für Notübernachter geöffnet, alle Gäste konnten gegen eine kleine Spende Frühstück und Mittagessen zu sich nehmen. Heute befinden sich Treffpunkt Kaffee Bankrott und Notübernachtung in der Prenzlauer Allee 87.
Als Helfer kamen auch Menschen, die von einem Gericht zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden waren. Bald entstand eine Beratungsstelle für sozialhilferechtliche und medizinische Fragen. Wenig später konnten die ersten befristeten Arbeitsverträge mit Mitarbeitern abgeschlossen werden. Immer häufiger meldeten sich Bürger und boten gebrauchte Möbel, Küchengeräte, Bücher und Tonträger an. So entstand der TrödelPoint, der seit 2002 erfolgreich arbeitet. Der Hausrat wird abgeholt, gegebenenfalls gereinigt und repariert und an Bedürftige weitergegeben. Nützlicher Nebeneffekt: Menschen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Chance haben, können hier ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen.
Schließlich wurde der Verein von einer Hauseigentümerin im Prenzlauer Berg angesprochen, ob er nicht Interesse hätte, ein Haus zu sanieren und im leerstehenden Quergebäude Wohnraum zu schaffen. Ein Erbbaurechtsvertrag wurde abgeschlossen, und in den Jahren 2001 bis 2003 wurden mit öffentlichen Fördergeldern und einem Eigenanteil von 330000 Euro zwei komplette Altbau-Wohnhäuser saniert und modernisiert. Damit verfügt der Verein heute über die Möglichkeit, selbst Wohnungen an Wohnungslose oder an Menschen in schwierigen Wohnverhältnissen zu vermieten.
Kaffee Bankrott, die Zeitung, das Hausprojekt und der Trödel tragen sich finanziell selbst. Allein die Notübernachtung ist ein »Zuschußgeschäft«, das sich zum größten Teil durch die Spenden aus der Kampagne »Ein Dach über dem Kopf« finanziert. Im Bereich Trödel und Wohnungseinrichtungen sowie Dienstleistungen wird demnächst der Versuch unternommen, eine Firma zu gründen, um durch professionelle Angebote eigenfinanzierte Arbeitsplätze zu schaffen. Ob und wann dies gelingt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.
Das bisher Erreichte ist kein Grund, sich auszuruhen. Im Kiez hat der Verein inzwischen »Wurzeln geschlagen«. Es gibt viele Kooperationen mit anderen sozialen Initiativen. Längst bezieht sich die Arbeit nicht nur auf Obdachlose, sondern auf alle armen, sozial ausgegrenzten Menschen. Durch die anhaltende Massenarbeitslosigkeit sind immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen, da die ihnen von öffentlichen Stellen zunehmend verwehrt wird. Obwohl die Selbsthilfeangebote für Obdachlose zentraler Bestandteil der Arbeit und des Selbstverständnisses von mob
e.V. bleiben sollen, engagiert sich der Verein zunehmend in der Stadtteilarbeit, beispielsweise durch die Mitwirkung im Förderverein Helmholtzplatz und in der Arbeitsgemeinschaft Kiez und Bezirk. Außer Sozialberatung werden inzwischen auch Gesundheits- und Kulturprogramme angeboten.
Die Arbeit von mob e.V. ist multinational. Viele Zeitungsverkäufer, Notübernachtende, Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen nicht aus Deutschland. In Zukunft werden jugendliche Freiwillige aus Europa und dem nichteuropäischen Ausland die Arbeit des Vereins bereichern. Der Anteil der ausländischen Gäste und Mitarbeiter wird in den nächsten Jahren, nicht zuletzt mit der Osterweiterung der Europäischen Union, weiter zunehmen. Damit kann mob e.V. dazu beitragen, auch die Wohnungslosenselbsthilfe international zu vernetzen. Dies alles kann jedoch nur bewältigt werden, wenn die ökonomische Basis des Vereins weiter stabilisiert wird. Denkbar sind Projekte im Bereich der sozialen Wohnraumsanierung durch Selbsthilfe, in der Gastronomie, bei sozialen und allgemeinen Dienstleistungen bis hin zur Jobvermittlung. Über ein Engagements in den Bereichen Landwirtschaft, Erholung, Tourismus und Gesundheit wird ebenfalls nachgedacht.
Wenn also mob e.V. daran arbeitet, unabhängige, selbstorganisierte und selbstverwaltete gemeinschaftliche Strukturen sozialer Selbsthilfe zu etablieren, wird deutlich, welche Dimension der bisweilen von uns gebrauchte Begriff einer »Ökonomie der Armut« haben kann: Es geht um mehr als nur eine grundlegende soziale Absicherung, die das blanke Überleben gewährleistet. Es geht auch um Lebensqualität , um gelebte Nachbarschaft, Arbeit, Bildung, Kultur und Gesundheit unter dem Motto: Global denken – lokal Handeln.
stefan schneider
31.07.2003 - Junge Welt